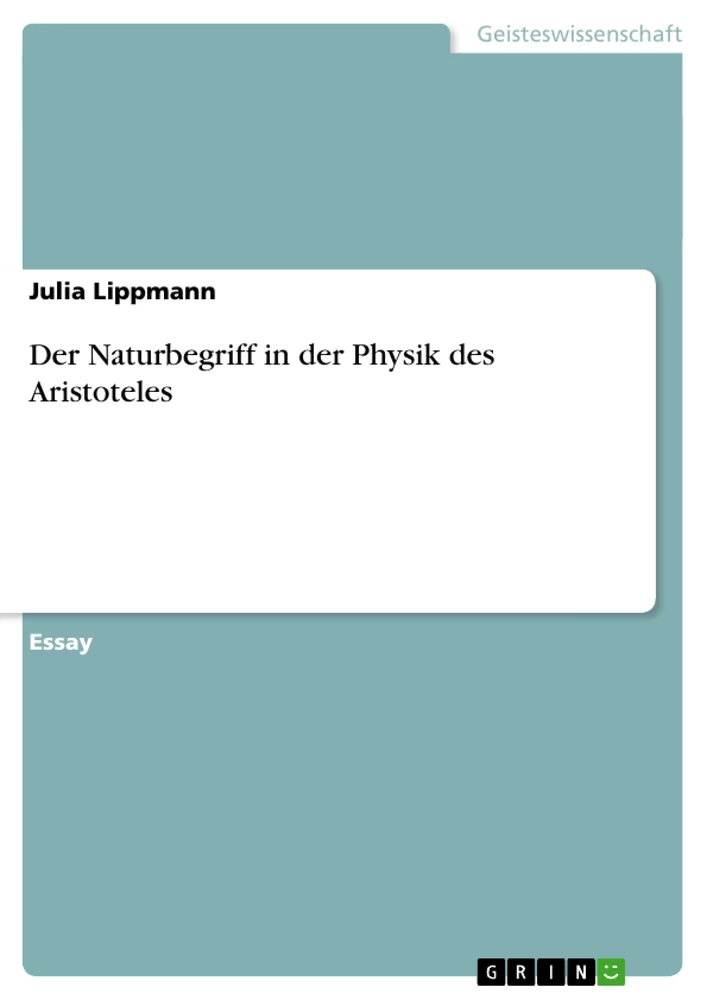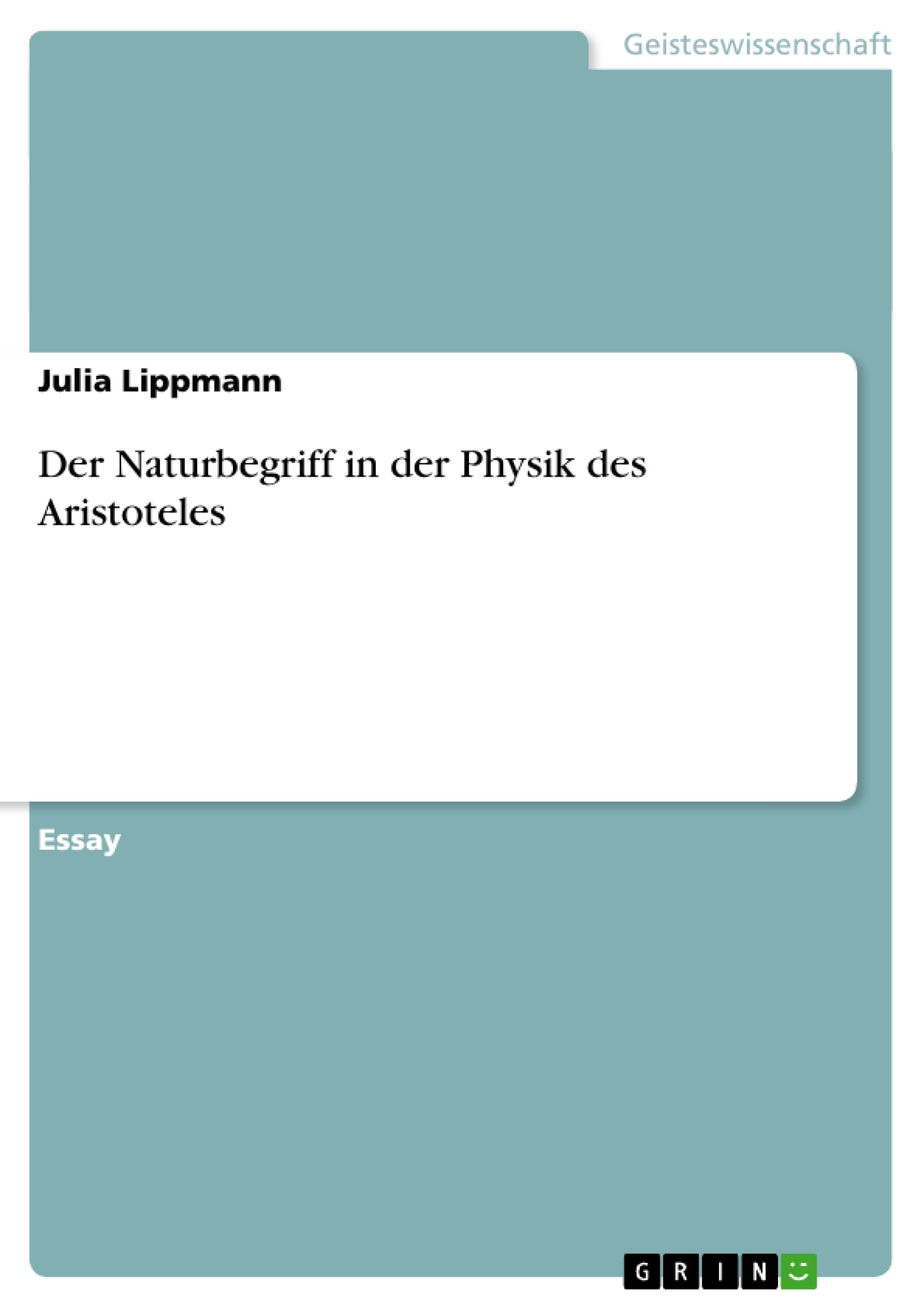Was bedeutet es wirklich, wenn wir von der "Natur" eines Dings sprechen? Diese tiefgründige Untersuchung entführt den Leser in die faszinierende Welt der aristotelischen Physik, wo der Naturbegriff einer differenzierten Analyse unterzogen wird. Entdecken Sie, wie Aristoteles die materielle Beschaffenheit, die inhärente Bewegungsfähigkeit und die vollendete Form eines Objekts in seinem Verständnis von Natur miteinander verwebt. Anhand prägnanter Beispiele, von Mensch und Baum bis hin zu unvollendeten Kunstwerken, ergründet der Autor, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und kategorisieren. Ist die Natur eines Dings in seinem Stoff begründet, oder manifestiert sie sich erst in seiner vollendeten Gestalt? Welche Rolle spielen Fähigkeiten und Potentiale bei der Bestimmung dessen, was ein Ding "wirklich" ist? Die Auseinandersetzung mit Aristoteles' Konzept von "Wirklichkeit und Möglichkeit" eröffnet neue Perspektiven auf die Frage, wann ein Ding seine wahre Natur erreicht hat. Diese philosophische Reise beleuchtet nicht nur die antiken Wurzeln unseres Denkens über Natur, sondern wirft auch ein neues Licht auf aktuelle Debatten über Identität, Potentialität und die Essenz des Seins. Tauchen Sie ein in die Welt der aristotelischen Physik und entdecken Sie die vielschichtigen Bedeutungsebenen des Naturbegriffs, der unser Verständnis der Welt bis heute prägt. Lassen Sie sich von Aristoteles' zeitlosen Weisheiten inspirieren und hinterfragen Sie Ihre eigenen Annahmen über die Natur der Dinge. Erfahren Sie, wie die Unterscheidung zwischen Stoff und Form unser Verständnis von Lebewesen und unbelebten Objekten beeinflusst. Untersuchen Sie mit Aristoteles die Rolle der "arttypischen Wirksamkeit" bei der Definition der Natur eines Dings. Die kritische Auseinandersetzung mit dem aristotelischen Naturbegriff bietet wertvolle Einblicke in die philosophischen Grundlagen unseres Weltbildes und regt dazu an, die eigene Perspektive auf die Natur neu zu überdenken. Wagen Sie einen Blick hinter die Oberfläche der Dinge und entdecken Sie die tiefere Bedeutung des Naturbegriffs in der Physik des Aristoteles.
Der Naturbegriff in der Physik des Aristoteles
Man kann zum einen das Stoffliche an natürlichen Dingen als ihre Natur bezeichnen, zum anderen kann man das den Dingen, die den Anfang der Bewegung in sich selbst tragen, jeweils Zugrundeliegende, Natur nennen. In diesem Fall entspricht „Natur“ dann dem Sinn des natürlichen Dinges, also dem, was es in vollendeter Form darstellt.
Aber was kann solchen Dingen zugrunde liegen? Zunächst erkennen wir Lebewesen, wie auch Gegenstände, an ihrer Erscheinung, oder an ihrem Anblick. Dabei nehmen wir den Stoff, aus dem sie bestehen, aber auch schon wahr. So besteht ein Mensch aus Fleisch und Knochen, ein Baum hingegen aus Holz und Blättern. Mit dieser Feststellung umgeht Aristoteles die Theorie des Antiphon, die alle Dinge auf ihre letzten Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft) zurückführt. Die Frage nach den letzten Elementen ist hier uninteressant, da es ja um das Bestimmte den Dingen Zugrundeliegende geht.
Ein weiterer Aspekt des Naturbegriffs ergibt sich, wenn die Gestalt, also die Form, eines Dinges als seine Natur betrachtet wird. So sind Fleisch und Knochen allein noch kein Mensch, dieser ergibt sich erst durch die konkrete Form und den Geist. Kinder hätten demnach für Aristoteles wohl keine Menschen sein können, sondern nur Menschen der Möglichkeit nach, denn Form bezieht sich immer auf Vollständiges. So nehmen wir einen Menschen laut Aristoteles erst auf dem Höchststand seiner Entwicklung als solchen wahr.
Menschen sehen demnach intelligent. Wir würden beispielsweise einen Baum niemals als solchen erkennen können, ohne zu wissen, was denn ein Baum ist. Anhand von Kriterien lernen wir Gebilden Begriffe zuzuweisen.
Können aber Fähigkeiten, wie zu lieben oder intelligent zu handeln, als zur Form des Menschen zugehörig betrachtet werden? Hier unterscheidet Aristoteles Wirklichkeit und Möglichkeit. Was der Möglichkeit nach ein Mensch ist, ist noch kein Mensch, sondern wird erst dann ein solcher, wenn es wie ein Mensch wirkt. Also sind nicht nur Stoff und Form, sondern auch so etwas wie „arttypische Wirksamkeit“ notwendig, um von einem Ding sagen zu können, dass es seiner Natur nach ist.
Wenn aber umgekehrt einem vollständig entwickelten Ding eine charakteristische Eigenschaft oder Fähigkeit fehlt, so bedeutet das noch nicht, dass das Ding nicht ist. Dies scheint von der Schwere des Mangels abzuhängen. Ein blinder Mensch etwa, bleibt auch ohne die Fähigkeit zu sehen doch ein Mensch.
Der Begriff „Natur“ kann des Weiteren als „Entstehen“, also als „Werdensprozess“, verstanden werden. Diese Überlegung führte uns zur doppelten Bedeutung von „Natur“ und „Gestalt“. Zum einen kann man beide am vollendeten Ding als dessen vollendete Form betrachten, zum anderen kann aber auch eine Instanz im Werdensprozess gemeint sein. Im letzten Fall spricht Aristoteles aber immer nur von der Form im Sinne des Unvollendeten. Es fehlen dem Ding noch entscheidende Charakteristika, um es erkennbar zu machen. Es ist nie die Rede von einem Unfertigen, sondern nur von etwas, dem ein Mangel anhaftet. So ist ein Stein beispielsweise als Stein gesehen ein in Natur und Gestalt vollendetes Ding. Betrachtet man ihn aber als Statue, so denn als Statue, der das entscheidende Charakteristikum der Form fehlt.
Offen blieb im 2. Kapitel die Frage, ob „fehlende Bestimmung und Gegensatz bei dem streng genommenen Entstehen etwas bedeuten oder nicht“ (Aristoteles: Physik, II, 2, 193b).
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zwei Hauptaspekte des Naturbegriffs in der Physik des Aristoteles?
Einerseits kann die stoffliche Beschaffenheit natürlicher Dinge als ihre Natur bezeichnet werden. Andererseits kann die Natur als das den Dingen Zugrundeliegende verstanden werden, die den Anfang der Bewegung in sich selbst tragen. In diesem Fall entspricht „Natur“ dem Sinn des natürlichen Dinges, also dem, was es in vollendeter Form darstellt.
Wie unterscheidet sich Aristoteles' Sichtweise von der Theorie des Antiphon bezüglich der Elemente?
Aristoteles umgeht die Theorie des Antiphon, die alle Dinge auf ihre letzten Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft) zurückführt. Aristoteles konzentriert sich auf das Bestimmte, das den Dingen zugrunde liegt, anstatt auf die Frage nach den letzten Elementen.
Wie betrachtet Aristoteles die Form eines Dinges in Bezug auf seine Natur?
Die Gestalt, also die Form eines Dinges, kann als seine Natur betrachtet werden. Fleisch und Knochen allein sind noch kein Mensch; der Mensch ergibt sich erst durch die konkrete Form und den Geist. Form bezieht sich immer auf Vollständiges.
Wie bewertet Aristoteles Fähigkeiten wie Intelligenz in Bezug auf die Natur des Menschen?
Aristoteles unterscheidet zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit. Was der Möglichkeit nach ein Mensch ist, ist noch kein Mensch, sondern wird erst dann ein solcher, wenn es wie ein Mensch wirkt. Neben Stoff und Form ist auch so etwas wie „arttypische Wirksamkeit“ notwendig, um von einem Ding sagen zu können, dass es seiner Natur nach ist.
Was bedeutet es, wenn einem vollständig entwickelten Ding eine charakteristische Eigenschaft fehlt?
Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Ding nicht ist. Dies scheint von der Schwere des Mangels abzuhängen. Ein blinder Mensch etwa, bleibt auch ohne die Fähigkeit zu sehen, doch ein Mensch.
Wie wird der Begriff „Natur“ als „Entstehen“ oder „Werdensprozess“ verstanden?
Der Begriff „Natur“ kann als „Entstehen“, also als „Werdensprozess“ verstanden werden. Dabei wird zwischen der vollendeten Form eines Dings und einer Instanz im Werdensprozess unterschieden. Im letzteren Fall spricht Aristoteles von der Form im Sinne des Unvollendeten, dem noch entscheidende Charakteristika fehlen.
Welche Rolle spielt der Gegensatz (Kontrahent) im Entstehungsprozess nach Aristoteles?
Da Gegensatz die Möglichkeit einer vollendeten Bestimmung, also den Höchststand der Entwicklung, einem Ding versagt, kann er als Kontrahent der fehlenden Bestimmung betrachtet werden. Denn auch wenn wir nur in der Retrospektive von einem Ding sagen können ihm fehle die Bestimmung, so bleibt es doch dabei, dass dem Ding das Potential seine vollständige Bestimmung zu erreichen, nicht abgesprochen werden kann.
- Quote paper
- Julia Lippmann (Author), 2005, Der Naturbegriff in der Physik des Aristoteles, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/109766