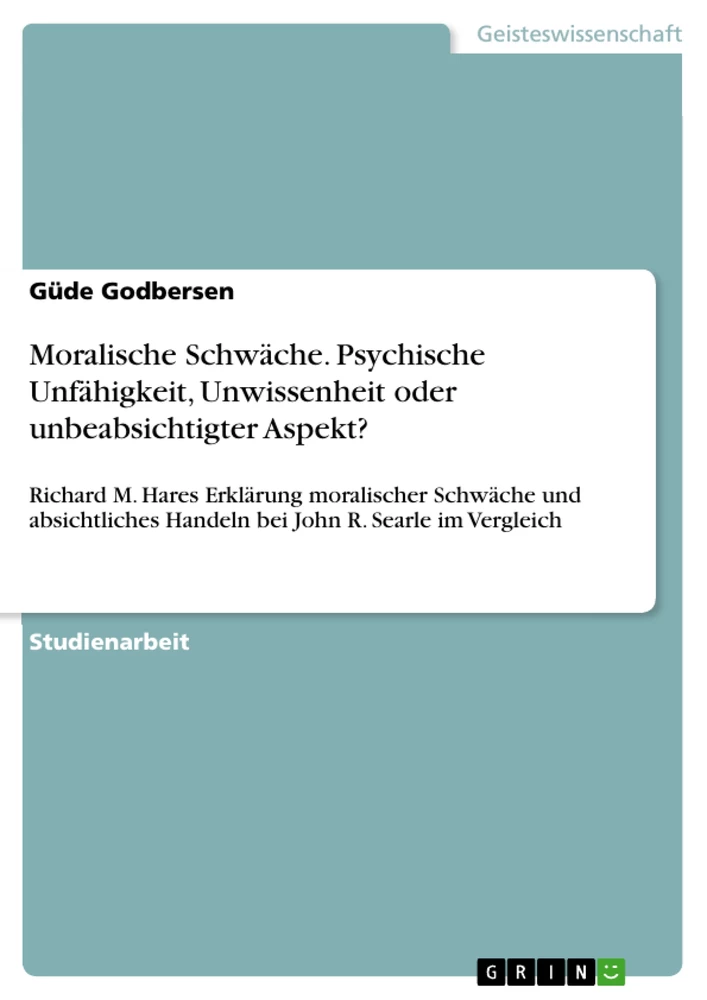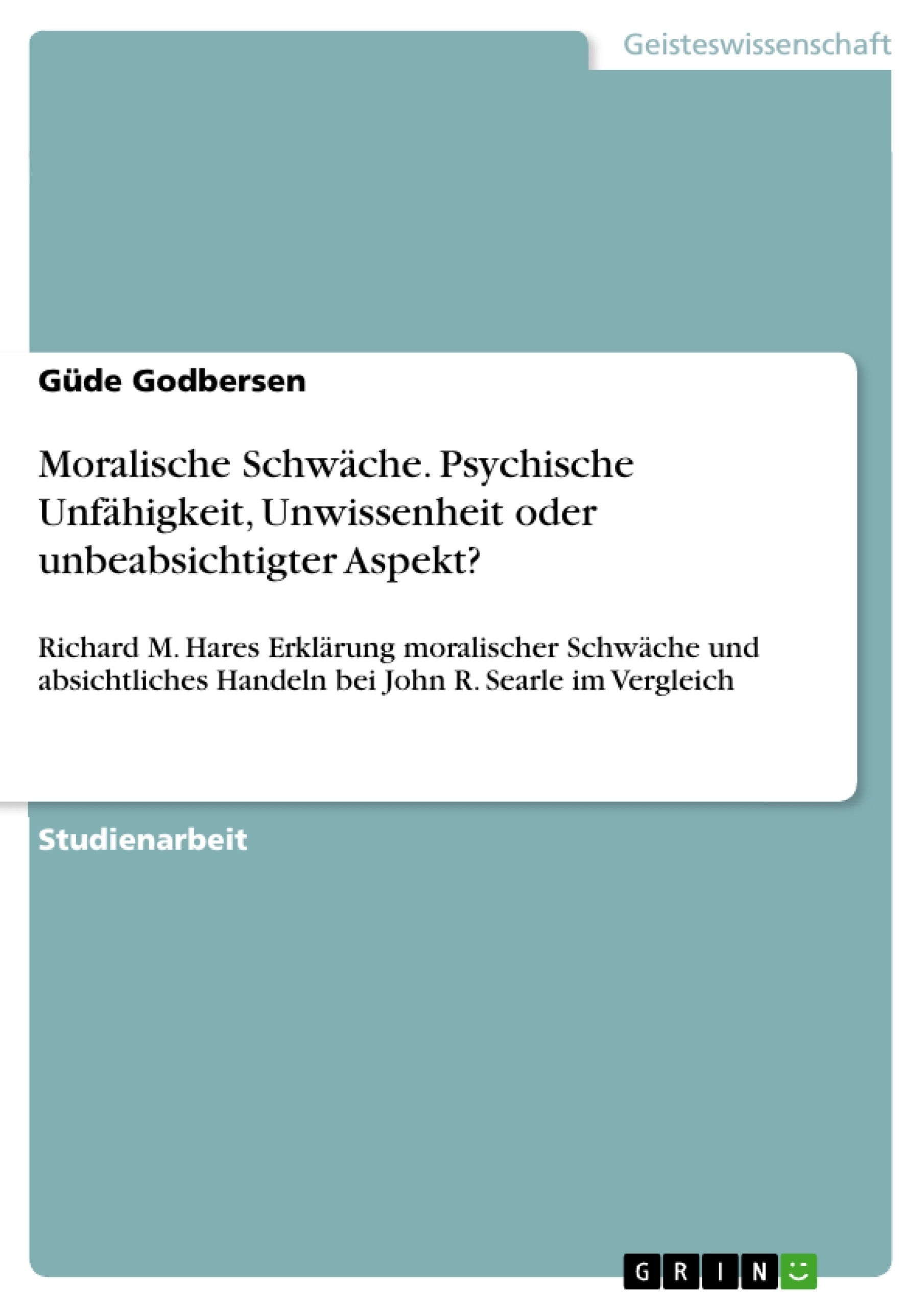Richard M. Hare folgt in seinem Buch Freiheit und Vernunft – wenn auch als Anti-Naturalist - der Tradition, Willensschwäche als eine moralische Schwäche zu behandeln.[3] Für ihn bedeutet moralische Schwäche[4], dass „jemand nicht tun kann, wovon er glaubt, daß er es tun sollte.“[5] Diese Definition weicht jedoch schon davon ab, was wir landläufig unter Willens- oder moralischer Schwäche verstehen, nämlich, dass jemand etwas tut, obwohl er meint, dass es besser wäre, etwas anderes zu tun.
Es soll in dieser Arbeit weniger um Willensschwäche im allgemeinen gehen, sondern um die Auffassung von moralischer Schwäche, mit der sich Hare in seinen Büchern Freiheit und Vernunft sowie Moralisches Denken auseinandersetzt.
Mit seinen Argumenten schadet Hare seiner eigenen Theorie, ohne dass dies unbedingt nötig wäre. Möglicherweise kann man den universellen Präskriptivismus moralischer Urteile verteidigen, ohne dem Menschen Irrationalität oder eine „Zwangsneurose“[6] zu unterstellen, bzw. ein Denken auf einer kritischen Ebene vorauszusetzen, welche von einem Menschen de facto nicht erreicht werden kann – er ist nun einmal kein allwissender Erzengel.
Ziel dieser Hausarbeit ist, Hares Auffassungen zu kritisieren und moralische Schwäche nicht als eine gescheiterte Handlung, sondern als unbeabsichtigten Aspekt einer absichtlichen Handlung darzustellen. Searle schreibt: „Eine unabsichtliche Handlung ist eine absichtliche Handlung (ob nun eine erfolgreiche oder nicht), die nicht mit ihr beabsichtigte Aspekte hat“[7]. Überträgt man dies auf moralisches Handeln, ist es also durchaus denkbar, dass moralische Schwäche sozusagen eine unbeabsichtigte Begleiterscheinung eines absichtlichen Handelns ist. Man wird ja, so Searle, auch keinem Zahnarzt unterstellen wollen, dass er bohrt, weil er dem Patienten damit Schmerzen zufügt[8].
Inhalt
Einleitung
Was ist Willensschwäche?
Handeln wider besseres Wissen bei Sokrates und Platon
Akrasia und Incontinentia bei Aristoteles und Thomas v. Aquin
Moralische Schwäche in Hares Theorie des universellen Präskriptivismus
Universeller Präskriptivismus
Moralische Schwäche in Freiheit und Vernunft
Moralische Schwäche in Moralisches Denken
Handeln wider besseres Wissen bei Davidson
Intentionalität bei Searle
Moralische Schwäche durch absichtliches Handeln und Hares universeller Präskriptivismus
Kommentar
Literatur
Einleitung
Wir alle kennen Willensschwäche aus eigener Erfahrung, und vermutlich ist jeder Mensch von Zeit zu Zeit in der Situation, etwas zu tun und gleichzeitig zu wissen, dass er besser etwas anderes tun sollte. Trotz unserer Fähigkeit, Willenschwäche recht genau zu erkennen, wenn sie auftritt, ist dieses Phänomen in der Philosophie alles andere als einheitlich definiert. Was macht Willensschwäche so problematisch?
Vom naturalistischen Standpunkt aus, der von Philosophen wie Sokrates und Platon vertreten wird, besteht das Problem der Willensschwäche darin, dass der Mensch eigentlich mit „naturgemäßer Notwendigkeit“[1] nach dem Guten strebt und das Böse meidet. Wenn nun aber die Tugend gut (und damit auch angenehm) ist, warum folgt der Mensch dann ab und zu seinen Begierden, die, zumindest vom Standpunkt eines Sokrates[2], schlecht (und damit unangenehm) sind?
Hare folgt in seinem Buch Freiheit und Vernunft – wenn auch als Anti-Naturalist - der Tradition, Willensschwäche als eine moralische Schwäche zu behandeln.[3] Für ihn bedeutet moralische Schwäche[4], dass „jemand nicht tun kann, wovon er glaubt, daß er es tun sollte.“[5] Diese Definition weicht jedoch schon davon ab, was wir landläufig unter Willens- oder moralischer Schwäche verstehen, nämlich, dass jemand etwas tut, obwohl er meint, dass es besser wäre, etwas anderes zu tun.
Es soll in dieser Arbeit weniger um Willensschwäche im allgemeinen gehen, sondern um die Auffassung von moralischer Schwäche, mit der sich Hare in seinen Büchern Freiheit und Vernunft sowie Moralisches Denken auseinandersetzt.
Um ein Phänomen wie die moralische Schwäche in seine Theorie einzugliedern, die ja behauptet, dass jedes Moralurteil aufgrund von sprachlicher Logik universell präskriptiv sei, d.h. der Mensch notwendig moralisch handelt, sobald und weil er einem Moralurteil aufrichtig zustimmt, macht Hare drei Vorschläge, die sich allesamt schwächend auf seine eigene Theorie auswirken. In Freiheit und Vernunft erklärt er erstens, die moralische Schwäche beruhe auf psychischer Unfähigkeit, zweitens seien moralische Urteile in bestimmten Situationen „abschwächbar“, und in Moralisches Denken erklärt Hare drittens moralische Konflikte mit zwei Ebenen des Denkens, dem intuitiven und dem kritischen Denken, wobei die moralische Schwäche hier als eine Art Denkfehler auf der intuitiven Ebene bezeichnet werden kann.
Mit allen Vorschlägen schadet Hare seiner eigenen Theorie, ohne dass dies unbedingt nötig wäre. Möglicherweise kann man den universellen Präskriptivismus moralischer Urteile verteidigen, ohne dem Menschen Irrationalität oder eine „Zwangsneurose“[6] zu unterstellen, bzw. ein Denken auf einer kritischen Ebene vorauszusetzen, welche von einem Menschen de facto nicht erreicht werden kann – er ist nun einmal kein allwissender Erzengel.
Ziel dieser Hausarbeit ist, Hares Auffassungen zu kritisieren und moralische Schwäche nicht als eine gescheiterte Handlung, sondern als unbeabsichtigten Aspekt einer absichtlichen Handlung darzustellen. Searle schreibt: „Eine unabsichtliche Handlung ist eine absichtliche Handlung (ob nun eine erfolgreiche oder nicht), die nicht mit ihr beabsichtigte Aspekte hat“[7]. Überträgt man dies auf moralisches Handeln, ist es also durchaus denkbar, dass moralische Schwäche sozusagen eine unbeabsichtigte Begleiterscheinung eines absichtlichen Handelns ist. Man wird ja, so Searle, auch keinem Zahnarzt unterstellen wollen, dass er bohrt, weil er dem Patienten damit Schmerzen zufügt[8].
Diese Sichtweise ist durchaus mit der Vorstellung universell präskriptiver Moralurteile verträglich, wenn auch Annahme der zwingenden Notwendigkeit zum moralischen Handeln nicht haltbar ist.
Es soll außerdem gezeigt werden, dass Hares Argumentationsprobleme auf zwei Missverständnissen beruhen, nämlich einmal auf der Annahme, dass Selbstbefehle die logische Form einfacher Allaussagen haben (was Hare in Moralisches Denken folgerichtig zur Annahme einer kritischen Ebene eines Denkens führt, die wir jedoch de facto nicht erreichen können) und zweitens, dass moralische Schwäche auf einem Konflikt zwischen zwei Absichten, einer vernünftigen, und einer begehrenden beruht, also quasi eine Entweder-Oder-Situation ist statt einer Sowohl-als auch-Situation.
Wenn man, wie hier dargestellt werden soll, davon ausgeht, dass moralisch schwaches Handeln nur eine von mehreren Beschreibungen einer Handlung ist, die andere Beschreibung aber darin besteht, dass es sich um eine gewollte und damit beabsichtigte Handlung handelt, kann man auch erklären, warum wir in einem Fall von Willensschwäche nie sagen: „Das habe ich nicht gewollt.“ aber die Formulierung „Ich konnte nicht anders.“ durchaus sinnvoll ist, ohne dadurch die universelle Präskriptivität von Moralurteilen, auf die es Hare ja ankam, in Frage stellen zu müssen.
Was ist Willensschwäche?
Hares Theorie der universellen Präskriptivität entstand nicht aus dem luftleeren Raum, sondern baut auf klassischen Positionen auf, aus denen Hare auch seine Erklärungen der moralischen Schwäche bzw. der moralischen Konflikte bezogen hat. Um zu sehen, welche „Denkfehler“ Hare aus vorausgehenden Theorien übernommen hatte, soll hier kurz gezeigt werden, wie Sokrates, Platon, Aristoteles und Thomas von Aquin Willensschwäche erklärten.
Handeln wider besseres Wissen bei Sokrates und Platon
Im sokratisch-platonischen Verständnis von Willensschwäche – genauer: von Handeln wider besserem Wissen – gibt es zwei grundlegende Auffassungen.
Die erste, die von Sokrates (oder Platon) im Protagoras vertreten wird ist, dass es Handeln wider besseres Wissen gar nicht gibt. Wenn man, so Sokrates, weiß, was zu tun am besten ist, dann handelt man auch dementsprechend. So kann man laut Sokrates auch nicht von etwas Angenehmem überwältigt werden. Natürlich wird auch Sokrates bemerkt haben, dass es Handeln wider besseres Wissen zumindest prima facie gibt. Er erklärt dieses Phänomen jedoch damit, dass der angeblich wider besseres Wissen Handelnde in der betreffenden Situation eine Handlung, die in einer gewissen Hinsicht gut ist, einer anderen Handlung vorzieht, die alles in allem gut ist. Wäre dem so, wäre es tatsächlich, wie Sokrates selbst glaubt, absurd. Denn Sokrates´ Philosophie basiert auf einem „ethischen und psychologischen egoistischen Hedonismus“[9]. Das heißt: Für ihn ist nur das für den Handelnden (egoistisch) gut (ethisch), was angenehm (Hedonismus) ist, zudem strebt der Mensch von Natur aus (psychologisch) nach dem Guten bzw. Angenehmen.
Die einzig mögliche Erklärung für „Handeln wider besseres Wissen“ kann also für Sokrates nur die Unwissenheit sein. Diese Erklärung läßt jedoch Fragen offen: Wie ist es möglich, daß wider besseres Wissen Handelnde sagen können, eine andere ihnen offenstehende Handlungsalternative sei besser als die, welche sie ausführen. [...] Zweitens geht mit Handeln wider besseres Wissen beim Handelnden ein innerer Konflikt einher: Soll er – metaphorisch gesprochen – dem Urteil der Vernunft folgen oder dem Drängen seiner Begierden nachgeben? Ein solcher Konflikt ist innerhalb des sokratischen Ansatzes (wie er im Protagoras zum Ausdruck kommt) weder verständlich noch beschreibbar.[10]
Die zweite Auffassung, die von Platon in der Politeia vertreten wird, räumt genau diesen inneren Konflikt ein. Platon unterscheidet hier drei Seelenteile: das Begehrende, das Eifernde und das Überlegende. Normalerweise handeln das Eifernde und das Überlegende gemeinsam gegen das Begehrende. Idealerweise steht das Begehrende dem Überlegenden jedoch gar nicht mehr entgegen, und so braucht auch kein innerer Kampf stattzufinden. Als Willensschwäche kann man nun den Fall beschreiben, in dem das Eifernde nicht schafft, das Begehrende zum Handeln im Sinne des Überlegenden zu veranlassen. Das Begehrende setzt sich also durch, und der Mensch wird von seinen Begierden überwältigt.[11]
Wenn dem so wäre, dann könnte man sich fragen, woher das Begehrende denn die Energie hernimmt, sich gegen das Überlegende durchzusetzen. Man müsste annehmen, dass sich Begehrendes und Eiferndes zusammentun und gegen das Überlegende vorgehen.
Akrasia und Incontinentia bei Aristoteles und Thomas v. Aquin
Für Aristoteles tritt Akrasia, d.h. Handeln wider besseres Wissen aufgrund von Schwäche, nur bei Essen, Trinken und Sexualität auf. Akrasia bedeutet für ihn, dass es im Handelnden zwei Argumentationsstränge gibt, den Syllogismus der Vernunft und den Syllogismus der Begierde.
Syllogismus der Vernunft:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten [12]
Bei Aristoteles hat der Syllogismus der Begierde keine handlungsanleitende Funktion, sondern stellt lediglich fest, dass in diesem Falle das Süße genussverheißend sei. Diese handlungsanleitende Funktion ist auch gar nicht nötig, weil bei der Begierde [...] Reflexion oder die Sinne nur anzudeuten [brauchen], daß etwas angenehm sei – und schon stürmt sie los auf den Genuß.[13]
Das bedeutet allerdings nicht, dass der Handelnde keinerlei Verantwortung mehr für sein Tun hat. Er weiß, dass er etwas anderes tun sollte. Allerdings ist dieses Wissen in dem Moment der Akrasia kein aktuelles Wissen, sonst müsste er nämlich danach handeln, sondern ein dispositionales oder höherstufig-dispositionales Wissen.[14] Höherstufig-dispositionales Wissen meint hierbei Wissen, das der Handelnde hat, aber nicht zur Anwendung bringt oder bringen kann. Als Beispiel für aktuelles, dispositionales und höherstufig-dispositionales Wissen nennt Aristoteles einen schlafenden Mathematiker.
Schläft der Mathematiker, hat er höherstufig-dispositionales Wissen von der Mathematik. Ist er wach, hat er dispositionales Wissen, und erst, wenn er ein mathematisches Problem bearbeitet, hat er aktuelles Wissen von der Mathematik.[15]
Warum nun aber der eine nach dem Syllogismus der Vernunft handelt, der andere aber nach dem der Begierde, erklärt Aristoteles damit, dass „sittliche Minderwertigkeit [...] eine Täuschung in bezug auf die Prinzipien des Handelns [bewirkt] und von ihnen ab[lenkt].“[16]
Was Aristoteles´ Theorie nicht erklärt, ist, wie es zu einem Konflikt zwischen Vernunft und Begierde kommen kann. Selbst wenn der Handelnde weiß, was er tun sollte, ist sein Wissen doch im Moment des Handelns außerhalb seiner Verfügbarkeit. Wenn die Begierde also unmittelbar die Führung übernimmt, dürfte es auch keinen Konflikt geben.
Thomas von Aquin modifiziert Aristoteles´ These insofern, dass er auch dem Syllogismus der Begierde eine handlungsanleitende Funktion zuweist.[17]
Syllogismus der Vernunft:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten [18]
Im Gegensatz zu Aristoteles glaubt Thomas also nicht , dass im Fall von Willensschwäche die Vernunft irgendwie abwesend ist, sondern dass der Willensschwache die Situation anders interpretiert, je nachdem ob er aus der Vernunft oder aus der Begierde heraus handelt. Warum sich nun der Handelnde für die Willensschwäche entscheidet, wird nicht ganz klar. Aber es scheint so zu sein, dass der Willensschwache den Untersatz der Vernunft, also „Diese Handlung ist eine Sünde.“ vergisst und er lediglich zwischen dem Obersatz der Vernunft („Man darf keine Sünde begehen.“) und dem Obersatz der Begierde („Alles Lustvolle ist zu verfolgen“) hin- und herschwankt, bis er endlich aus dem Ober- und Untersatz der Begierde („Alles Lustvolle ist zu verfolgen.“ und „Diese Handlung ist lustvoll.“) auf die handlungsbestimmende Konklusion („Dies ist zu verfolgen.“) schließt.[19]
Thomas´ Darstellung erklärt jedoch nicht, wieso der Handelnde nun ausgerechnet der Begierde folgt.
Zusammengefasst stellen sich die klassischen Positionen zur Willensschwäche bzw. zum Handeln wider besseres Wissen also wie folgt dar: Nach Sokrates, wie er im Protagoras argumentiert, gibt es kein Handeln wider besseres Wissen. Wenn jemand weiß, was für ihn am besten ist, dann handelt er auch danach, weil das beste immer auch das Angenehmste ist, und der Mensch naturnotwendig immer nach dem Angenehmsten strebt. Tut er dies nicht, dann kann es nach Sokrates nur daran liegen, dass der Handelnde nicht weiß, was für ihn am Besten ist.
Platon räumt in der Politeia ein, dass der Mensch doch wider besseres Wissen handeln kann. Für ihn besteht die menschliche Seele aus drei Teilen, dem Begehrenden, dem Eifernden und dem Überlegenden. In der Idealform arbeiten alle drei Teile harmonisch zusammen, das heißt, das Begehrende fügt sich sozusagen widerspruchslos dem Überlegenden. Normalerweise ist das Begehrende jedoch dem Überlegenden entgegengesetzt, doch letzteres arbeitet mit dem Eifernden zusammen und hält so das Begehrende in seinen Schranken. Im Fall von Willensschwäche „gewinnt“ das Begehrende und setzt sich über die beiden anderen Seelenteile hinweg.
Auch nach Aristoteles „gewinnt“ bei Willensschwäche die Begierde. Nur ist es hier so, dass Willensschwäche dadurch zustande kommt, dass sich die Vernunft auf einer dispositionalen oder höherstufig-dispositionalen Stufe befindet, die Begierde dagegen sofort auf einen Reiz reagiert. Der Willensschwache hat also sozusagen kein aktuelles Wissen davon, was richtig ist, sondern ist seiner Begierde ausgeliefert. Dementsprechend gibt es also auch keinen inneren Konflikt, sondern lediglich eine Art blinder Reaktion auf Außenreize.
Für Thomas von Aquin spielt sich dagegen bei Willensschwäche sehr wohl ein Konflikt ab. Der Handelnde weiß, was zu tun besser wäre, doch er handelt nicht dementsprechend, weil er die Situation aus einer sozusagen willensschwachen Perspektive aus beurteilt: Er sieht also nicht, dass das Handeln eine Sünde wäre, sondern lediglich, dass dieses Handeln bzw. das Ergebnis des Handeln lustvoll ist. Dementsprechend entscheidet er sich auch.
Keiner dieser vier Philosophen erklärt jedoch, warum wir im Fall von Willensschwäche die „schlechte“ Tat begehen, d.h. unserer Begierde folgen. Angesichts der Vorstellung, wir könnten zwischen gutem = vernünftigen und schlechtem = triebhaftem Verhalten wählen, ist es nicht sinnvoll, die schlechte Alternative zu wählen. Warum sollten wir etwas tun, was wir nicht nur nicht wollen, sondern was auch noch schlecht für uns ist?
Mir erscheint es plausibler, die Vorstellung von einem Konflikt zwischen Vernunft und Begierde insgesamt einfach aufzugeben und statt dessen anzunehmen, dass unser Verhalten, wenn es uns (im Fall von moralischer Schwäche) auch noch so sehr missfällt, durchaus einen guten, sprich: vernünftigen Grund hat.
Moralische Schwäche in Hares Theorie des universellen Präskriptivismus
Bei Hare wird moralische Schwäche explizit nur in seinem Buch Freiheit und Vernunft behandelt. Da man moralische Schwäche jedoch auch als einen moralischen Konflikt ansehen kann, der ja eines der Hauptthemen in Moralisches Denken ist, soll moralische Schwäche auch unter dem Aspekt der zwei Ebenen des Denkens behandelt werden.
Hare übernimmt in seinen Theorien, sei es die der universellen Präskriptivität, sei es in seiner Annahme zweier Ebenen des Denkens, Ansichten, die ihn bei der Verteidigung ebendieser Theorien in Schwierigkeiten bringen. In Freiheit und Vernunft entstehen alle Argumentationsprobleme hauptsächlich deswegen, weil Hare annimmt, dass Moralurteile erstens die Form einfacher Allaussagen haben, und dass zweitens im Fall von moralischer Schwäche ein Konflikt zwischen den Absichten der Vernunft und den der Begierde stattfindet.
Wieso kann sich Hare moralische Schwäche nicht anders als mit psychischer Unfähigkeit erklären? In Freiheit und Vernunft ist es ja das Nichttunkönnen dessen, was man tun sollte, was den Handelnden scheitern läßt, in Moralisches Denken das Nichtwissen dessen, was man richtigerweise tun sollte (also sozusagen eine kognitive Unfähigkeit).
Universeller Präskriptivismus
Der von Hare vertretene universelle Präskriptivismus vertritt die Ansicht, dass moralische Wörter erstens nicht nur einen deskriptiven, sondern auch einen präskriptiven Gehalt haben. Die Funktion eines moralischen Wortes ist also, handlungsanleitend zu wirken. Zweitens sind diese Wörter, weil sie auch einen deskriptiven Gehalt haben, universalisierbar. Wenn man eine Sache „gut“ nennt, so muss man alle anderen Sachen, die dieser ersten in relevanter Hinsicht ähneln, ebenfalls „gut“ nennen. Dies entspricht der Universalisierbarkeit rein deskriptiver Begriffe. Wenn ich eine Tomate als „rot“ bezeichne, muss ich ein Auto, das in relevanter Hinsicht, also der Farbe, der Tomate gleicht, ebenfalls als „rot“ bezeichnen.
Universeller Präskriptivismus besagt nun, dass wir, wenn wir moralische Urteile fällen, erstens etwas vorschreiben. Sinn und Zweck eines Moralurteils ist also die Handlungsanleitung (Präskriptivismus). Und wir dürfen sie nicht nur einer bestimmten Gruppe von Menschen vorschreiben, sondern müssen diese Urteile für alle Menschen, uns eingeschlossen, als präskriptiv ansehen (Universalismus).
Moralische Schwäche in Freiheit und Vernunft
Hare verfolgt nun das Ziel, mit Hilfe der Theorie des universellen Präskriptivismus moralisches Handeln analytisch zu machen. So schreibt Hare bereits in Die Sprache der Moral, was er in Freiheit und Vernunft wiederholt:
Es ist tautologisch, daß wir einem an uns gerichteten Befehl in der zweiten Person nicht aufrichtig zustimmen können, wenn wir ihn nicht zur gleichen Zeit ausführen, vorausgesetzt, daß jetzt die Gelegenheit zu seiner Ausführung gegeben ist und daß es (physisch wie psychisch) in unserer Macht steht, ihn auszuführen. In ähnlicher Weise ist es tautologisch daß wir einer Behauptung nicht aufrichtig zustimmen können, ohne sie gleichzeitig zu glauben. So [...] involviert die aufrichtige Zustimmung zu den letzteren [sc. Selbstbefehlen] [...], daß wir etwas tun.[20]
Zustimmung und Handeln sind (durch die Universalisierbarkeit und die Präskriptivität der Moralurteile) also sozusagen eins, wenn man Hares Auffassung folgt. Und es ist durchaus plausibel, dass wir nicht stehlen, wenn wir aufrichtig von dem Moralurteil „Du sollst nicht stehlen.“ überzeugt sind. Aber ist moralische Schwäche deswegen notwendig die Folge einer psychischen Unfähigkeit? Folgt man Hares Argumentation, dann ist sie der einzige Ausweg. Ein Nichtwollen ist durch die aufrichtige Zustimmung zu dem Moralurteil ausgeschlossen, so kann eigentlich nur ein Nichtkönnen in Frage kommen.
Nur: Denkt der Dieb in dem Moment, in dem er seine Hand nach dem verführerischen Diebesgut ausstreckt, an ein Moralurteil? Stiehlt der Dieb also, obwohl er denkt „Du sollst nicht stehlen.“? Oder stiehlt er, weil er diesen Gegenstand an sich nehmen will?
Hares Auffassung scheint vorauszusetzen, dass wir jeden Moment unseres Lebens ausschließlich eine Art „Ich sollte“-Katalog in unserem Kopf herumtragen, der uns jede Situation moralisch beurteilen läßt. Doch wer geht schon z.B. zum Einkaufen und sagt sich immer wieder vor: „Ich sollte nicht stehlen, ich sollte nicht stehlen, ich sollte nicht stehlen...“. Tatsächlich haben wir doch beim Einkaufen eher Gedanken im Kopf, die sich auf das richten, was wir einkaufen wollen.
Es gibt noch weitere Einwände gegen Hares Vorstellung von moralischer Schwäche:
Hare definiert in Freiheit und Vernunft moralische Schwäche als ein: „Ich sollte, aber ich kann nicht.“[21] Er begründet diese Definition der moralischen Schwäche mit dem Hinweis auf die wörtliche Übersetzung des griechischen Begriffs „akrasia“:
Und diese Unfähigkeit zur Verwirklichung unserer Ideale spiegelt sich recht gut in den sehr bezeichnenden Namen wider, die es dafür im Griechischen [...] gibt: Das Griechische nennt es àkrasía – wörtlich ‚nicht stark genug sein’ (zur Selbstkontrolle) [...].[22]
Spitzley widerlegt diese „Evidenz“[23] jedoch:
Das Wort „Atom“ kommt vom griechischen „άτομος“, dessen wörtliche Übersetzung „unteilbar“ ist. Aber es käme wohl kaum jemand auf die Idee, deswegen zu behaupten, Versuche zur Kernspaltung oder Untersuchungen zur Struktur von Atomen seien sinnlos, da die wörtliche Bedeutung von „άτομος“ schon zeige, daß Atome unteilbar seien.[24]
Dennoch hat Hare insofern recht, als es im Sprachgebrauch üblich ist, in einem Fall von Willensschwäche genau diese Formulierung zu verwenden, und das Nichterfüllen moralischer Prinzipien mit einem Nichtkönnen zu erklären. Und tatsächlich ist diese Begründung sogar plausibel. Daraus allerdings auf eine Unfähigkeit zu schließen, die einer Geisteskrankheit[25] gleichkommt, verfehlt den Kern der Sache.
Laut Hare kann „Ich sollte, aber ich kann nicht“ nur auf vier Arten interpretiert werden.
1. Der Sprecher heuchelt. Das heißt, er könnte sehr wohl tun, was er sollte. Weil er dem moralischen Urteil aber nicht aufrichtig zustimmt, es also entweder nicht universell gebraucht („ Man sollte, aber ich nicht.“) oder nicht präskriptiv („Ich sollte, aber das ist nur eine Redensart.“), ist sein „Ich sollte aber ich kann nicht.“ lediglich ein Lippenbekenntnis.[26]
2. Die zweite Interpretationsmöglichkeit ist die der physischen Unfähigkeit.[27] Der Handelnde könnte zum Beispiel sehen, dass ein Kind unachtsam auf eine stark befahrene Straße läuft. Weil der Handelnde aber mehrere hundert Meter entfernt (oder querschnittsgelähmt oder irgendwo festgebunden) ist, kann er sagen: „Ich sollte dieses Kind retten, aber ich kann nicht (weil ich zu weit weg / querschnittsgelähmt / festgebunden bin).“
3. Die dritte Interpretationsmöglichkeit ist die der „farblosen Verwendungsmöglichkeiten“[28] des Begriffs „sollen“. „Sollen“ ist ein sogenanntes „Janus-Wort“[29], das mehrere Bedeutungsaspekte gleichzeitig enthält. Einer dieser Aspekte kann auf Kosten der anderen hervorgehoben werden. So kann man „sollte“ präskriptiv als Ausdruck eines Moralurteils gebrauchen, genauso gut aber als Ausdruck einer soziologischen Tatsache („Menschen in meiner Situation sollten, so will es die Gesellschaft, X tun.“) oder als Ausdruck einer psychologischen Tatsache („Wenn ich X nicht tue, werde ich Schuldgefühle bekommen.“)[30]
4. Die vierte Möglichkeit, „Ich sollte, aber ich kann nicht.“ zu interpretieren, ist nun nach Hare die einzig angemessene, wenn es um moralische Schwäche geht. Der Sprecher stimmt dem Moralurteil (z.B. „Du sollst nicht stehlen.“) aufrichtig und aus tiefstem Herzen zu. Dennoch stiehlt er, weil er nämlich aufgrund einer psychischen Unfähigkeit nicht anders kann. Irgendeine Macht hält ihn also davon ab, die Finger von dem Gegenstand zu lassen.[31]
Gerade das Beispiel des Stehlens zeigt, wie unplausibel die Erklärung der psychischen Unfähigkeit ist. Es gibt nämlich durchaus eine solche diagnostizierbare psychische Unfähigkeit: Ein Kleptomane, der ja nachweislich eine psychische Unfähigkeit zum Nichtstehlen hat, wird nicht in gleicher Weise moralisch zur Rechenschaft gezogen wie ein Mensch, der „aus Lust und Laune“ etwas mitgehen läßt.[32]
Zudem: Wenn jemand „Ich sollte, aber ich kann nicht.“sagt, muss das noch nicht bedeuten, dass er tatsächlich unfähig ist. Selbst wenn er felsenfest von seiner Unfähigkeit überzeugt ist und somit nicht zu den Heuchlern gehört, kann es durchaus sein, dass er sich dies nur einbildet.[33]
Aber selbst wenn man z.B. eine psychische Unfähigkeit zum Nichtstehlen annimmt, die nicht pathologisch (also ein Fall von Kleptomanie) ist: Charakteristisch für die moralische Schwäche ist ja der innere Konflikt, der daraus resultiert, dass man eben doch das Bessere hätte machen können, dies zumindest glaubt . Dass dies intuitiv unserer Vorstellung von Willens- und moralischer Schwäche entspricht, sieht man auch an dem Beispiel, dass man einem Betrunkenen so gut wie alles nachsieht, nur eben nicht, dass er sich so betrunken hat. Die Entscheidung, sich zu betrinken, hatte er nach allgemeiner Auffassung (sofern man ihn nicht als Alkoholiker einstuft) durchaus in der Hand, das Fehlverhalten, das er alkoholisiert zeigte (grölen, betrunken Auto fahren, Prügeleien anfangen usw.) dagegen nicht mehr, eben weil er zu dem Zeitpunkt sozusagen psychisch unfähig zur Selbstkontrolle war.[34]
Was Hare also als „typische Fälle von Willensschwäche“[35] ansieht, sind gerade die Fälle, in denen man normalerweise die Menschen ihrer moralischen Verantwortung genauso enthebt wie in Fällen, in denen sie körperlich nicht in der Lage sind, entsprechend eines Moralurteils zu handeln. Umgekehrt machen wir jemanden, der sich moralisch schwach verhält, für sein Verhalten verantwortlich. Wir tadeln den wider besseres Wissen Handelnden, wir werfen ihm sein Verhalten vor und unterstellen, daß er auch hätte anders handeln können. Und dies gilt in der Regel nicht nur für den Beobachter, sondern auch für den wider besseres Wissen Handelnden selbst: Gewissensbisse, Reue, Selbstvorwürfe, Schuldgefühle usw. können zwar auch dann auftreten, wenn man eine bestimmte Handlung wirklich nicht ausführen konnte, aber sie scheinen nur dann sinnvoll zu sein, wenn dem wider besseres Wissen Handelnden eine Handlungsalternative offenstand.[36]
Hares Ziel, die Präskriptivität von Moralurteilen zu verteidigen, kann man auch erreichen, wenn man den Handelnden geistige Gesundheit unterstellt. Ein Moralurteil ist präskriptiv. Zweifellos kann man Hares Aussage zustimmen, dass niemand einem Moralurteil gleichzeitig zustimmen und nicht danach handeln kann. Nur: ein Fall von moralischer Schwäche muss seine Ursache ja nicht in dem Versagen einer moralischen Absicht haben.
Hare versucht, das Außer-Kraft-Setzen der universellen Präskriptivität, wie sie in Fällen von moralischer Schwäche auftritt, dadurch zu erklären, dass diese in bestimmten Einzelfällen abgeschwächt werden kann. In einem Fall von psychischer Schwäche wird die Präskriptivität eines Moralurteils nicht, wie im Fall von physischer Unfähigkeit, aufgehoben, sondern nur herabgestuft.[37] Das „sollte“ hat dann also in dieser speziellen Situation keine präskriptive Bedeutung mehr, behält sie aber im allgemeinen Sinne. Hare trifft diese Unterscheidung zwischen physischer und psychischer Unfähigkeit, weil
obgleich unfähig, dieser oder jener Versuchung Herr zu werden, halten sie [sc. die aus der Präskriptivität resultierenden Gewissensqualen und Missbilligung] doch die Willenskraft aufrecht, die einer schwächeren Versuchung vielleicht Herr werden könnte.[38]
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ein Moralurteil insgesamt nicht universell präskriptiv sein kann, wenn es ein einigen Fällen, aus welchen Gründen auch immer, diese universelle Präskriptivität verliert. Um diese zu verteidigen, hat Hare ja diese „Ausnahmen“ eingeführt. Damit widerlegt er jedoch seine eigene Theorie, ohne dass dies nötig wäre.
Wenn man aus der These der universellen Präskriptivität, also daraus, dass jemand, der einem Moralurteil zustimmt, auch notwendig entsprechend handeln muss, folgert, dass, wenn derjenige es nicht tut, nur psychische Unfähigkeit vorliegen kann, die ihrerseits die universelle Präskriptivität aufhebt, muss man die Theorie als gescheitert betrachten. Und nicht nur das: Hares Theorie erklärt so nicht das, was moralische Schwäche eigentlich ausmacht:
Der wider besseres Wissen Handelnde stimmt [in Hares Theorie] einem Moralurteil zu, das nicht universell präskriptiv ist, d.h. dessen Präskriptivität sich nicht auf den wider besseres Wissen Handelnden selbst erstreckt. Insofern besteht keine Spannung zwischen der Zustimmung des wider besseres Wissen Handelnden zu dem Moralurteil einerseits und seinem Verhalten andererseits. Das Vorhandensein genau dieser Spannung ist aber ein wesentlicher Bestandteil der gewöhnlichen Beschreibung von Handeln wider besseres Wissen: Der wider besseres Wissen Handelnde handelt anders, als er glaubt, daß er handeln soll, und nicht nur anders, als er glaubt, daß andere handeln sollen.[39]
Moralische Schwäche in Moralisches Denken
In Moralisches Denken versucht Hare, das Problem moralischer Konflikte mit der Annahme zweier Ebenen des Denkens zu lösen.[40]
Auf der intuitiven Ebene bedienen wir uns in unserem Tun und Denken moralischer prima-facie-Prinzipien, die wir dank unserer Erziehung oder sonstiger Außeneinflüsse in unser Denken aufgenommen haben.[41] Diese prima-facie-Prinzipien und die daraus resultierenden Handlungsanleitungen funktionieren normalerweise recht gut. Von Zeit zu Zeit geraten wir jedoch in einen moralischen Konflikt. Wenn wir z.B. unseren Kindern versprochen haben, heute mit ihnen einen Ausflug zu machen, gleichzeitig einem Freund, der nur an diesem Nachmittag in der Stadt ist, einen bestimmten Gefallen tun wollen, weil wir es auch ihm versprochen haben, befinden wir uns in einem Konflikt. Egal, wie wir uns entscheiden, wir brechen zumindest prima facie ein Versprechen. Dies verstößt aber gegen das moralische Prinzip „Versprechen soll man halten.“
Um diesen Konflikt zu lösen, begeben wir uns auf die kritische Ebene des Denkens.
Auf dieser Ebene kann es keinen moralischen Konflikt geben. Hare geht sogar soweit zu sagen: auf der kritischen Ebene ist jedoch eine Auflösung des Konfliktes erforderlich – sonst müssen wir eben zugeben, daß unser Denken noch unvollständig ist.[42]
Was wir also auf der kritischen Ebene entscheiden, entscheiden wir aufgrund einer Abwägung aller tatsächlich relevanten Aspekte[43]. Was alles in allem die beste Lösung ist (und davon kann es nur eine geben), ist dann das, was wir zu tun haben.
Auf moralische Schwäche übertragen heißt das also: Wir können auf der intuitiven Ebene moralisch schwach sein, weil wir, aufgrund unserer prima-facie-Prinzipien glauben, dass unser Moralurteil, an das wir uns gebunden fühlen, in einem unauflöslichen Konflikt steht mit einem anderen prima-facie-Urteil, das uns an der Ausführung hindert.
Auf der kritischen Ebene kann es dagegen keine moralische Schwäche geben: Dank unserer Allwissenheit stimmen wir entweder dem Moralurteil vollkommen zu, oder aber es ist einfach nicht richtig, dann stimmen wir ihm nicht zu, denn dann hat es für uns auch gar keine moralische Relevanz.
Aber auch hier gilt, was Spitzley zu Hares Vorstellung von moralischer Schwäche in Freiheit und Vernunft schreibt: moralische Schwäche, und dementsprechend ein moralischer Konflikt, zeichnet sich eben durch die Spannung zwischen der Präskriptivität des Urteils und des eigenen Nichthandelns aus. Wäre es also wirklich menschenmöglich, sich auf eine andere Ebene des Denkens zu begeben, auf der moralische Konflikte per se nicht vorkommen, dann bräuchten wir keine Gewissensnöte mehr auszustehen.
Auf den ersten Blick scheint die Vorstellung von einer kritischen Ebene des Denkens eine tolle Lösung zu sein: wir brauchen „nur“ alles zu wissen, und schon machen wir alles richtig.
Vielleicht hat Hare damit sogar recht. Nur – was nützt uns das? Wir können nun einmal nicht alles wissen, und daher ist sein Lösungsvorschlag zur Klärung moralischer Konflikte ungefähr so sinnvoll, als wenn man einem Blinden sagen würde, er bräuchte doch nur zu hinzugucken, wenn er nicht überall anstoßen möchte. Da es nun aber keine Frage des Wollens oder Nichtwollens ist, ob wir alles wissen, ist eine Metaethik wenig sinnvoll, aus der man keine irgendwie machbaren Schlüsse ziehen kann, die für die Lösung moralischer Probleme hilfreich wären.
Zusammengefasst sind Hares Vorschläge zum Verständnis moralischer Schwäche also folgende:
1. Wenn ich nicht so handele wie ich sollte, obwohl ich dem Moralurteil aufrichtig zustimme, bin ich psychisch unfähig. Es gibt bei Hare also nur ein Entweder-oder.
2. Weil ich psychisch unfähig bin, ist die universelle Präskriptivität der Moralurteile aufgehoben. – Im Grunde widerlegt Hare die universelle Präskriptivität von Moralurteilen also durch den Versuch, sie zu verteidigen.
3. Es gibt zwei Ebenen des Denkens. Moralische Schwäche findet nach Hare nur auf der intuitiven Ebene statt, da wir hier nicht auf der Basis von Allwissenheit handeln, sondern nur aufgrund von prima-facie-Beziehungen. Dies kann uns auf der kritischen Ebene nicht passieren, weil wir dort ja allwissend sind. Moralische Schwäche ist also ein Denkfehler. Diese kritische Ebene kann Hare nur annehmen, weil er davon ausgeht, dass wir moralische Urteile in Form einfacher Allaussagen sinnvoll bilden können. Das heißt, dass wir „Ich sollte X tun“ meinen als „Ich sollte X immer und überall in jeder Situation tun.“
Alle drei Thesen sind schon in Hares eigener Argumentation problematisch.
Diese Probleme lassen sich nun aber leicht vermeiden, wenn man andere Annahmen trifft:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten [44]
Handeln wider besseres Wissen bei Davidson
Das erste Missverständnis von Hare liegt, wie D. Davidsons Erklärung klarsichtigen Handelns wider besseres Wissen zeigt, darin, Moralurteile als praktische Syllogismen in Form einfacher Allaussagen anzusehen. D.h.: ein Moralurteil, auf das mein moralisches Handeln folgt, stellt sich - auch bei Hare - so dar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Davidson stellt nun fest, dass es immer dann zu Kontradiktionen kommen kann, wenn man annimmt, dass „Sätze, die positive Einstellungen ausdrücken, [...] die Form logischer Allaussagen“ haben.[45] Dies gilt sogar für Wünsche, wie das folgende Beispiel zeigt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wenn nun dieses Essen, das süß ist, gleichzeitig auch giftig ist, dann ergibt sich daraus ein zweiter praktischer Syllogismus:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Demnach ist also dieselbe Handlung gleichzeitig wünschenswert und nicht wünschenswert, d.h. wir haben eine Kontradiktion.[46]
Einfache Allaussagen können wir genau genommen schon deswegen nicht machen, weil wir nicht zu dem von Hare propagierten kritischen Denken in der Lage sind. Wenn wir also sagen: „Süßes zu essen ist wünschenswert.“, dann meinen wir damit nicht, dass es in absolut jeder Situation wünschenswert wäre, sondern vielmehr, dass wir prima facie davon ausgehen, dass Süßes zu essen wünschenswert ist. Man könnte die einfache Allaussage also umformulieren in: „Im Normalfall (oder eben: prima facie) ist Süßes zu essen wünschenswert.“
Dass wir normalerweise in Allaussagen sprechen, könnte daran liegen, dass wir unterstellen, dass jeder versteht, dass sie prima facie gemeint sind.
Davidson schlägt nun also vor, alle Sätze, die irgendeine positive Einstellung ausdrücken, „generell als verkappte prima facie Urteile aufzufassen.“[47]
Wenn man dies tut, ergeben sich auch keine Kontradiktionen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wenn man nun gleichzeitig annimmt, dass das Süße giftig ist:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
kann man nichts weiter schließen, als dass X zu essen prima facie wünschenswert ist, insofern es sich um etwas Süßes handelt, aber nicht wünschenswert, insofern es sich um etwas Giftiges handelt.[48]
Somit kann es nicht zu Kontradiktionen kommen, die nicht nur Hare, sondern auch Philosophen wie Sokrates, Platon, Aristoteles und Thomas von Aquin zu schaffen machten.
Intentionalität bei Searle
Das zweite Missverständnis, das bei Hares Argumentation problematisch ist, liegt in der Annahme, dass es sich bei moralischer Schwäche um einen Konflikt zwischen zwei verschiedenen Absichten, der der Vernunft und der der Begierde, handelt.
Searles Intentionalitätstheorie bietet eine andere Sichtweise an:
Eine unabsichtliche Handlung ist eine absichtliche Handlung (ob nun eine erfolgreiche oder nicht), die nicht mit ihr beabsichtigte Aspekte hat[49].
Auf moralische Schwäche übertragen kann man also sagen: Moralische Schwäche ist der unbeabsichtigte Teil einer beabsichtigten Handlung.
Dies bedeutet zweierlei. Erstens muss man, um moralische Schwäche erklären zu können, die Annahme aufgeben, dass für eine Situation immer nur eine Beschreibung möglich ist:
Angenommen, ein Hund rennt im Garten hinter einem Ball her; er vollzieht die absichtliche Handlung des Hinter-einem-Ball-Herjagens und die unabsichtliche Handlung des Außreißens der Lobelien.[50]
Zweitens ist Hares Annahme, einem Moralurteil zuzustimmen bedeute, ihm notwendig entsprechend handeln zu müssen, in gewisser Hinsicht richtig, in anderer Hinsicht falsch, vor allem aber ungenau.
Um das zu erläutern, muss man von der sprachanalytischen Ebene auf die intentionale Ebene wechseln, denn „daran, wie der intentionale Gehalt seine Erfüllungsbedingungen präsentiert, muss nichts irgendwie Sprachliches sein.“[51]
Eine absichtliche Handlung setzt sich nach Searle aus mehreren Komponenten zusammen: Im Idealfall basiert eine Handlung auf einer vorausgehenden Absicht. Diese verursacht die Handlungsabsicht, jene wiederum eine Bewegung (bzw. das Unterlassen einer Bewegung oder einen geistigen Akt). Die intentionale Komponente der Handlungsabsicht und deren Erfüllungsbedingung, die Bewegung, sind zusammengenommen das, was wir unter einer Handlung verstehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[52]
Es gibt durchaus Handlungen, die keine vorausgehende Absicht haben.[53] Aber eine Handlung muss immer die Komponenten der Handlungsabsicht und der Bewegung enthalten:
Eine Handlung ohne Handlungsabsicht ist keine Handlung. Zum Beispiel kann sich der Arm heben, weil jemand anderes ihn hochzieht oder jemand im Gehirn der Person die entsprechenden Areale stimuliert und so die Armhebebewegung verursacht. In beiden Fällen würde die Person nicht sagen: „Ich habe meinen Arm gehoben.“ sondern „Mein Arm hob sich.“[54]
Eine Handlung ohne Bewegung ist natürlich auch keine Handlung, sondern eine Halluzination.
Eine Handlung ohne vorausgehende Absicht dagegen ist durchaus möglich, so werden wir z.B. beim Autofahren (vorausgesetzt, wir sind erfahrene Autofahrer) nicht bei jedem Links- und Rechtsabbiegen die vorausgehende Absicht („Ich will nach links/rechts abbiegen“) bilden, sondern es – sozusagen „automatisch“ – einfach tun.[55]
Ein wichtiges Element von Absichten, seien es vorausgehende oder Handlungsabsichten, ist deren kausale Selbstbezüglichkeit:
aufgrund der kausalen Selbstbezüglichkeit von Absichten kann ich nur beabsichtigen, was meine Absicht verursachen kann.[56]
Das bedeutet, auf Moralurteile bezogen, dass nur die moralischen Selbstbefehle zu einer Absicht und damit zu einer Handlung führen können, die durch die Absicht auch erfüllt werden können. Dies unterscheidet Handlungen von Wünschen und Überzeugungen (und damit von moralischen Selbstbefehlen und Prinzipien). Genauer gesagt:
Überzeugung und Wunsch sind das, was übrigbleibt, wenn man von den intentionalen Gehalten kognitiver und volitiver repräsentationaler Zustände die kausale Selbstbezüglichkeit abzieht. Die Zustände, die sich ergeben, wenn diese Eigenschaft abgezogen wird, sind viel flexibler. Die Überzeugung [und damit z.B. auch ein moralisches Prinzip] kann von allem und jedem handeln und nicht bloß von Sachen, die sie hätten verursachen können; der Wunsch kann – anders als die Absicht – von allem und jedem handeln, und nicht bloß von Sachen, die er verursachen kann.[57]
Ein weiterer wichtiger Punkt, der bei Hare zu Argumentationsproblemen führt ist das, was Ryle die „intellektualistische Legende“ nennt:
Vorkämpfer dieser Legende [...] sind geneigt [zu glauben], daß intelligentes Handeln das Einhalten von Regeln oder die Anwendung von Kriterien verlange. [...] d.h. also, der Handelnde muß zuerst den innerlichen Vorgang durchmachen, sich selbst gewisse Sätze über das, was zu tun sei, als richtig einzugestehen (‚Maximen’, ‚Imperative’ oder ‚Regulativsätze’, wie diese Sätze manchmal genannt werden); nur dann kann er diesen Diktaten gemäß handeln. Er muß zuerst auf sich einreden, bevor er zur Tat schreiten kann.[58]
Genau diese Vorstellung scheint auch Hare zu haben, wenn er sagt, dass moralische Schwäche bedeute, dass man etwas tun sollte, aber es nicht kann.
Statt dessen ist es sinnvoller, Handeln nicht als „zweigliedrige Tätigkeit, Erwägung und darauffolgende Ausführung von Vorschriften“[59] zu verstehen, sondern „intelligentes Handeln in der Anwendung von Kriterien bei der Ausführung der Tätigkeit selbst“ zu verstehen.
Aber wo sind denn diese Kriterien, nach denen wir handeln, wenn sie keine mehr oder weniger bewussten, verinnerlichten Repräsentationen sind? Nach Ryle und Searle basiert unser Handeln nicht auf irgendwie gearteten Selbstbefehlen, wie Hare annehmen würde, sondern auf Dispositionen.
Wenn wir Glas als zerbrechlich bezeichnen oder Zucker als löslich, dann verwenden wir Dispositionsbegriffe [...]. Die Zerbrechlichkeit des Glases besteht nicht in der Tatsache, daß es zu einem gegebenen Zeitpunkt wirklich zerbrochen wird.[60]
Dennoch gibt es Repräsentationen, für das moralische Handeln haben wir ja tatsächlich Handlungsempfehlungen, nach denen wir uns richten. Den Zusammenhang zwischen diesen Repräsentationen und unserem Verhalten erklärt Searle an dem Beispiel eines Skifahrers so:
Der Anfänger erhält eine Reihe sprachlicher Anweisungen darüber, was er tun soll: „nach vorne beugen“, „in die Knie gehen“, „das Gewicht auf den Talski legen“, und so weiter. Das sind alles explizite Repräsentationen, und soweit es dem Anfänger mit dem Lernen ernst nimmt, werden sie als Teil des intentionalen Gehalts eine kausale Rolle beim Zustandekommen seines Verhaltens spielen.[61]
Dies bedeutet nach Searle nun jedoch nicht, dass der Anfänger nun immer schneller lernt, Repräsentationen abzurufen oder sie irgendwie unbewusst wirken zu lassen:
Wenn der Skifahrer besser wird, dann verinnerlicht er nicht die Regeln besser, sondern die Regeln werden immer unwichtiger. Die Regeln werden nicht als unbewusste intentionale Gehalte „fest verdrahtet“, sondern gehen eher „in Fleisch und Blut über“: die wiederholten Erfahrungen erzeugen körperliche Fähigkeiten, die [...] Regeln einfach überflüssig machen.[62]
So erwerben wir im Laufe der Zeit viele Fähigkeiten, die ein komplexes Netzwerk bilden.
Das Netzwerk geht in einen Hintergrund von Fähigkeiten über. Der Hintergrund [...] durchdringt das gesamte Netzwerk intentionaler Zustände. [...] Ohne Hintergrund könnte es keine Wahrnehmung, Handlung und Erinnerung geben; d.h. es könnte keine derartigen intentionalen Zustände geben.
Wenn man das menschliche Verhalten nun auf der Basis dieser Annahmen untersucht, wird moralische Schwäche klarer, vor allem, wieso es sinnvoll ist, dass man einerseits, wie Spitzley schreibt, jemanden für seine moralische Schwäche verantwortlich machen kann und trotzdem sinnvoll sagen kann, dass man „sollte, aber nicht kann.“
Moralische Handlungen basieren ebenso auf dem von Searle so genannten „Hintergrund“ wie auch andere „Geschicklichkeiten, Fertigkeiten, vorintentionale Annahmen und Voraussetzungen, Einstellungen und nicht-repräsentationale Haltungen“[63]. Ein moralischer Grundsatz ist eine Disposition, nach der wir, sofern wir sie haben, im Normalfall handeln.
Moralische Schwäche kann auf dieser Basis entweder eine gescheiterte Absicht sein: Ich versuche aktiv, diesen Gegenstand nicht zu stehlen, aber ich tue es doch. Dies könnte man dann aber eher unter dem Begriff „psychische Unfähigkeit“ fassen, die sich von der „echten“ moralischen Schwäche aber durch den Aspekt der Handlungsunfähigkeit unterscheidet. Oder aber: ich tue etwas, und zwar mit Absicht. Und ein, wenn auch unbeabsichtigter Aspekt dieser Handlung ist moralische Schwäche.
Es ist ein verbreiteter Irrtum anzunehmen, daß jemand, der weiß, daß eine bestimmte Sache eine Konsequenz der Handlung ist, mithin auch diese Sache beabsichtigen müsse. [...] Wenn ein Zahnarzt beispielsweise weiß, daß eine Folge seines Bohrens darin besteht, daß der Patient Schmerzen hat, so folgt doch nicht, daß er diese Folge beabsichtigt, wie sich ja auch daran zeigt, daß er – falls der Schmerz einmal ausbleibt – nicht sagen müßte „Es ist mir nicht gelungen“, sondern „Ich hatte Unrecht“.[64]
So kann ich Dinge unerlaubterweise an mich nehmen, obwohl ich weiß, dass es sich in diesem Fall um Stehlen handelt, ohne die Absicht zu haben, zu stehlen – denn es kommt mir ja nicht darauf an, diesen Gegenstand unerlaubt und gegen den Willen des Besitzers an mich zu nehmen, sondern darauf, ihn überhaupt zu haben. Und ich kann gleichzeitig sinnvoll aus tiefstem Herzen sagen „Ich sollte nicht stehlen, aber ich kann nicht anders“, da meine Absicht ja nicht darin besteht, entsprechend eines Moralurteils zu handeln oder etwa gegen es zu verstoßen. Natürlich könnte ich meine Absicht ändern. Deswegen macht man den Handelnden ja auch für sein Fehlverhalten verantwortlich. Aber die Spannung, die der Willensschwache während der moralisch schwachen Handlung verspürt, besteht nicht darin, dass Vernunft und Begierde gegeneinander kämpfen und die Begierde gewinnt, sondern darin, dass die Vernunft (metaphorisch gesprochen) sagt: „Nimm diesen Gegenstand.“ und gleichzeitig weiß, dass dies moralisch gesehen falsch ist.
Moralische Schwäche durch absichtliches Handeln und Hares universeller Präskriptivismus
Um nun also Hares Theorie der universellen Präskriptivität von Moralurteilen, die an sich ja plausibel ist, mit dem Phänomen von moralischer Schwäche zu versöhnen, ohne auf psychische oder kognitive Unfähigkeit plädieren zu müssen (was ja auch unserer Vorstellung von Willensschwäche widerspricht), kann man sagen: eine Handlung ist sowohl moralisch schwach als auch beabsichtigt. Das erklärt auch, warum wir in einem Fall von moralischer Schwäche nie sagen „Das wollte ich nicht.“ sondern nur „Ich konnte nicht“.
Ein unbeabsichtigter Aspekt der Handlung „X tun“ ist „Y nicht tun.“ Wenn ich ein Stück Kuchen esse, dann verstoße ich gleichzeitig gegen das Prinzip „Süßes essen ist zu vermeiden.“ Da ich aber nicht Kuchen essen kann, ohne gleichzeitig etwas Süßes zu essen, kann ich einerseits nicht sinnvoll sagen „Ich wollte nicht Kuchen essen“, wenn ich den Mund voller Kuchen habe, aber ich kann sagen: „Ich konnte nicht ‚ Süßes essen vermeiden’.“ Weil eben Kuchen essen gleichzeitig bedeutet, Süßes zu essen.
Warum wollen wir denn aber Dinge tun, die dazu führen, dass wir in einen moralischen Konflikt geraten?
Meiner Meinung nach tritt Willens- oder moralische Schwäche nur als unerwünschte Begleiterscheinung einer Handlung auf, die für sich genommen moralisch in Ordnung ist. In Fällen von absichtlichem Diebstahl oder anderen absichtlich ausgeführten moralisch unerwünschten Handlungen sprechen wir nicht von Willensschwäche. Ein Mensch der absichtlich stiehlt, befindet sich nicht in einem moralischen Konflikt, da er ja dem Urteil „Ich sollte nicht stehlen“ nicht zustimmt. So gesehen hat Hare recht, wenn er sagt: Jemand der einen Moralurteil aufrichtig zustimmt, kann nicht nicht entsprechend handeln.
Essen, Trinken und Sexualität dagegen, die klassischen Gründe von Willensschwäche, dienen normalerweise der Selbst- und Arterhaltung. Alle drei Verhaltensweisen können natürlich pathologische Züge annehmen. So gibt es ess-, trink- und sexsüchtige Menschen. Nur unterstellen wir ihnen keine Willensschwäche, sondern bezeichnen sie als neurotisch oder krank.
Auch moralische Schwäche kann krankhafte Züge annehmen und damit eine psychische Unfähigkeit verursachen. Eine Person kann neurotisch sein insofern, dass sie zu absolut jedem Termin zu spät kommt. Nur unterstellen wir auch hier nicht, dass die Person pünktlich sein könnte, wenn sie es nur wollte. Dies tun wir nur dann, wenn klar ist, dass die Person etwas anderes gemacht hat als „pünktlich sein“. Wir sind unpünktlich im Sinne von moralischer Schwäche, wenn wir z.B. schnell noch was erledigen, anstatt dafür zu sorgen, dass wir rechtzeitig da sind, wo wir sein sollten. Somit ist moralische Schwäche also ein Aspekt einer von uns beabsichtigten Handlung, und dass wir uns schlecht dabei fühlen, zeigt, dass es kein beabsichtigter Aspekt ist.
Vergleicht man nun Hares Erörterungen zur moralischen Schwäche auf der Basis seiner Theorie der universellen Präskriptivität von Moralurteilen mit der herkömmlichen Vorstellung davon, was Willens- bzw. moralische Schwäche ist, kommt man zu folgenden Ergebnissen.
Unter Willensschwäche versteht man folgendes:
Jemand der eine Handlung H2 ausführt, handelt genau dann wider besseres Wissen, wenn er
(i) H2 absichtlich ausführt,
(ii) glaubt, es stehe ihm frei, eine andere Handlung H1 auszuführen, und
(iii) urteilt, es wäre alles in allem besser, H1 statt H2 auszuführen.[65]
Hares Definition von moralischer Schwäche sieht so aus: Moralurteile sind universell präskriptiv, und daher ist es seiner Ansicht nach tautologisch,
daß wir einem an uns gerichteten Befehl in der zweiten Person nicht aufrichtig zustimmen können, wenn wir ihn nicht zur gleichen Zeit ausführen, vorausgesetzt, daß jetzt die Gelegenheit zu seiner Ausführung gegeben ist und daß es (physisch wie psychisch) in unserer Macht steht, ihn auszuführen.[66]
Moralische Schwäche kann für Hare also nur eine psychische oder kognitive Unfähigkeit sein, da ein Nichtwollen durch die aufrichtige Zustimmung ausgeschlossen ist. Die Präskriptivität für diese Situation wird abgeschwächt, d.h. in diesem Fall müssen wir nicht entsprechend des Moralurteils handeln, normalerweise aber schon.
Diese Lösung ist aber gar nicht notwendig. Ein Moralurteil kann seine volle universelle Präskriptivität behalten, wenn man berücksichtigt, dass wir im Fall von moralischer Schwäche nicht entgegen eines Moralurteils handeln, sondern dass das moralische Versagen ein unbeabsichtigter Aspekt einer absichtlichen Handlung ist. Würden wir aufgrund eines Moralurteils handeln, müssen wir auch ihm entsprechend handeln, und ich glaube auch, dass wir genauso gut z.B. pünktlich sein könnten, wenn wir die Absicht haben, pünktlich zu sein. Wenn wir aber aufgrund einer anderen Absicht handeln, ist es möglich, moralisch schwach zu sein, dennoch diesem Moralurteil aufrichtig zuzustimmen, und trotzdem bleibt die universelle Präskriptivität des Moralurteils erhalten.
Hare hat insofern recht, als dass es sprachlich gesehen analytisch ist, einem (Selbst-)Befehl zuzustimmen und ihn auszuführen. Allerdings nur wenn, wie Searle zeigt, dieses Moralurteil zu einer Absicht werden kann.
Ich kann der Überzeugung „Niemand sollte stehlen“ zustimmen, aber daraus kein sinnvolles Moralurteil in Form einer Absicht - „Ich sollte alle Menschen dazu bringen, nicht zu stehlen“ machen. Und ich kann den Wunsch haben „Alle Leben sollen gerettet werden“, aber auch hieraus keine moralische Absicht „Ich sollte alle Leben retten“ bilden. Voraussetzung für eine Absicht ist ja ihre kausale Selbstbezüglichkeit, d.h. ich muss zumindest glauben, dass ich entsprechend dieses Moralurteils handeln kann. Außerdem kann man, entgegen der Annahme, die Hare in Moralisches Denken vertritt, einem Moralurteil nur prima facie zustimmen.
Wenn man moralische Schwäche als Nichterfüllen eines Moralurteils versteht, dann liegt das daran, dass man „Ich sollte, aber ich kann nicht“ als einfache Allaussage interpretiert: „Ich sollte X überall und in jeder Situation tun.“
Dies ist mangels Allwissenheit des Menschen nicht sinnvoll. Genauso, wie wir deskriptive Allaussagen („Alle Schwäne sind weiß“) nicht verifizieren können, weil deren Wahrheitsgehalt für uns nicht überprüfbar ist, stimmen wir einem Moralurteil nicht in Form einer Allaussage zu, weil wir gar nicht wissen können, in welche Situationen wir geraten.
Einem Moral urteil kann man also nicht zustimmen, ohne, wie Hare richtig sagt, dementsprechend zu handeln, wenn die Handlungsvoraussetzungen gegeben sind. Moralische Schwäche ist aber kein Sprach-, sondern ein Handlungsproblem. Hare vermischt nun aber diese beiden Ebenen und versucht zu zeigen, dass moralisches Handeln analytisch ist, weil die moralischen Wörter gewisse Eigenschaften aufweisen. Dass dies nicht funktioniert, zeigen die Argumentationsprobleme, die Hare offensichtlich hatte.
Die Versöhnung zwischen der universellen Präskriptivität von Moralurteilen einerseits und dem Phänomen der Willens- oder moralischen Schwäche andererseits besteht nun darin festzustellen, dass moralische Schwäche keine Handlung ist, sondern allenfalls einer von mehreren Aspekten einer Handlung. Moralische Schwäche ist also nicht, wie man vermuten könnte, ein Versagen des Willens. Wenn man moralisch schwach handelt, will man ja auch was. Nur hat diese Handlung die unangenehme Begleiterscheinung, gegen eines unserer moralischen Prinzipien zu verstoßen. Trotzdem können Moralurteile weiterhin universell präskriptiv sein, d.h. wir schreiben sie anderen und uns vor und fühlen uns auch verpflichtet, ihnen entsprechend zu handeln. Das tun wir auch - wenn sie die Ursache unserer Absicht sind. Sind sie es nicht, fühlen wir uns aufgrund ihrer universellen Präskriptivität schlecht. Und aus der Notwendigkeit, ihnen entsprechend zu handeln einerseits und unserem gleichzeitigen Verstoß dagegen andererseits, entsteht der moralische Konflikt.
Kommentar
Die Gefahr darin, moralische Schwäche, und damit auch moralische und sonstige Verfehlungen mit psychischer Unfähigkeit oder aber mit einer nicht zu kompensierenden Unwissenheit zu erklären, zu rechtfertigen und damit auch zu einem gewissen Grad zu legitimieren, besteht darin, dass die für jeden notwendige Selbstverantwortung für das eigene Handeln allzu leicht an äußere oder nicht beherrschbare Mächte abgegeben werden kann.
Hare lag meines Erachtens gar nicht so falsch mit seiner Erklärung des schlechten Gewissens als einer Art Ersatz für echte Präskriptivität.[67] Es fällt manchmal leichter (und einigen erscheint es sogar als die einzige Möglichkeit, sich die Dinge zu erklären), sich in Selbstvorwürfe (Versagen im „kritischen Denken“) oder aber in eine gewisse Opfermentalität („psychische Unfähigkeit“) zu flüchten, statt die Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen und entsprechend zu handeln. Dass es viele vorziehen, Selbstverantwortung so weit wie möglich an äußere oder innere Sündenböcke (den Staat, die Polizei, die Nachbarn, die Ausländer, Süchte, das eigene Unvermögen) abzugeben, ist bekannt. Dieses Verhalten aber durch eine Theorie zu stützen, die Verantwortungslosigkeit sozusagen wissenschaftlich legitimiert, halte ich nicht für besonders geeignet, den Menschen zu einem moralisch verantwortungsvollen Dasein zu verhelfen.
Eine Theorie, die jedem menschlichen Handeln grundsätzlich eine Absicht unterstellt, ist schon deswegen sinnvoller, weil es sicher immer noch Menschen gibt, die es nicht nur glauben wollen, sondern tatsächlich überzeugt sind von ihrer eigenen Handlungsunfähigkeit – Hare ist das beste Beispiel. Eine zumindest theoretische Möglichkeit, sozusagen „seines eigenen Glückes Schmied“ zu sein, ohne vorher zu Erzengeln werden zu müssen, was ja per se unmöglich und dadurch sehr entmutigend ist, halte ich daher eindeutig für besser.
Literatur
Hare, Richard M.: Freiheit und Vernunft. Frankfurt a.M.1983.
Hare, Richard M.: Moralisches Denken. Frankfurt a.M. 1992.
Searle, John R.: Intentionalität. Eine Abhandlung zur Philosophie des Geistes. Frankfurt a.M. 1991.
Aristoteles, Nikomachische Ethik. Stuttgart, 1983.
Hare, R.M.: Die Sprache der Moral. Frankfurt a.M. 1983.
Platon: Der Staat. Stuttgart, 1982.
Ryle, Gilbert: Der Begriff des Geistes. Stuttgart, 1969.
Spitzley, Thomas: Handeln wider besseres Wissen. Eine Diskussion klassischer Positionen. Berlin, New York 1992.
[...]
[1] Hare, R.M.: Freiheit und Vernunft, Frankfurt a.M. 1983, S. 87. Im folgenden: FV.
[2] Protagoras, 358c6-d4. Vgl. Spitzley, 21f.
[3] Dass Hare mit „moral weakness“ tatsächlich „Willensschwäche“ meint, schreibt er selbst: „Und diese Unfähigkeit zur Verwirklichung unserer Ideale spiegelt sich recht gut in den sehr bezeichnenden Namen wider [...] das Deutsche nennt es ‚Willensschwäche“. FV, 95.
[4] Obwohl in der deutschen Übersetzung „moral weakness“ als „Willensschwäche“ übersetzt wurde, folge ich Th. Spitzley und verwende der Genauigkeit halber den Begriff „moralische Schwäche“.
[5] FV, 85. Hervorhebung vom Autor.
[6] vgl. Spitzley, 131
[7] Searle, 142
[8] ebd., 136
[9] Spitzley, 59
[10] Spitzley, 61. Hervorhebungen vom Autor.
[11] ebd-, 62
[12] [12] Spitzley, 92
[13] Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1149a34-36
[14] Spitzley, 109
[15] Aristoteles, De Generatione Animalium, 735a9-11, vgl. Spitzley, 79
[16] ebd., Nikomachische Ethik, 1144a34-36
[17] Spitzley, 123
[18] vgl. ebd., 116
[19] Spitzley, 123f.
[20] Hare, R.M.: Die Sprache der Moral. Frankfurt a.M., 1983. S. 40f. Im Folgenden: SM.
[21] FV, 85. Hervorhebung von mir.
[22] ebd., 95
[23] FV, 95
[24] Spitzley, 133
[25] Hare spricht selbst von „gespaltener Persönlichkeit“: FV, 98
[26] FV, 90. Vgl. auch FV, 97
[27] ebd., 99f. vgl. FV, 76
[28] ebd., 85
[29] ebd., 93
[30] FV, 100f. Vgl. Spitzley, 128
[31] ebd., 85, 95ff.
[32] Spitzley, 131
[33] ebd., 132
[34] ebd., 131ff.
[35] FV, 85
[36] Spitzley, 134
[37] FV, 97
[38] ebd., 97
[39] Spitzley, 148
[40] Hare, Richard M.: Moralisches Denken. Frankfurt a.M. 1992, S. 70ff. Im folgenden: MD.
[41] vgl. MD, 75
[42] MD, 70
[43] ebd., 70
[44] Spitzley, 173
[45] Spitzley, 172
[46] vgl. Spitzley, 171ff.
[47] ebd., 173
[48] vgl. Spitzley, 171ff.
[49] Searle, 142
[50] ebd., 134
[51] Searle, 134
[52] vgl. ebd., 125
[53] ebd., 127
[54] ebd., 120
[55] Searle, 127
[56] ebd., 138
[57] ebd., 138
[58] Ryle, 32
[59] ebd., 47
[60] Ryle, 51
[61] Searle, 190f.
[62] ebd., 191
[63] Searle, 192
[64] ebd.,136
[65] Spitzley, 166
[66] SM, 40
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text behandelt die Frage der Willensschwäche (moralische Schwäche) und insbesondere die Auseinandersetzung mit dieser Thematik in R.M. Hares Theorie des universellen Präskriptivismus. Es werden klassische Positionen zur Willensschwäche (Sokrates, Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin) dargestellt und kritisch analysiert. Der Text zielt darauf ab, Hares Erklärung der moralischen Schwäche zu widerlegen und eine alternative Sichtweise zu präsentieren, die moralische Schwäche nicht als gescheiterte Handlung, sondern als unbeabsichtigten Aspekt einer absichtlichen Handlung darstellt.
Wie definieren Sokrates und Platon Willensschwäche?
Sokrates (im Protagoras) leugnet die Existenz von Handeln wider besseres Wissen. Wer weiß, was gut ist, handelt auch entsprechend. Platon (in der Politeia) hingegen räumt ein, dass ein innerer Konflikt zwischen Vernunft und Begierde stattfinden kann. Die Seele besteht aus drei Teilen: Begehrendes, Eiferndes und Überlegendes. Willensschwäche entsteht, wenn das Begehrende sich gegen die anderen beiden Teile durchsetzt.
Wie erklären Aristoteles und Thomas von Aquin Willensschwäche?
Aristoteles sieht Akrasia (Willensschwäche) als das Ergebnis zweier Argumentationsstränge: Syllogismus der Vernunft und Syllogismus der Begierde. Im Moment der Akrasia ist das Wissen des Handelnden kein aktuelles, sondern dispositionales Wissen. Thomas von Aquin erweitert dies, indem er dem Syllogismus der Begierde eine handlungsanleitende Funktion zuweist. Der Willensschwache interpretiert die Situation anders, je nachdem, ob er aus Vernunft oder Begierde heraus handelt.
Was ist Hares Theorie des universellen Präskriptivismus?
Hares Theorie besagt, dass moralische Urteile universell und präskriptiv sind. Das bedeutet, dass sie handlungsanleitend wirken und für alle Menschen gelten müssen. Wer einem moralischen Urteil aufrichtig zustimmt, muss auch entsprechend handeln.
Wie erklärt Hare moralische Schwäche in "Freiheit und Vernunft"?
Hare erklärt moralische Schwäche als psychische Unfähigkeit. Jemand tut nicht, was er tun sollte, weil er psychisch nicht in der Lage dazu ist. Dies führt dazu, dass die Präskriptivität des Moralurteils abgeschwächt wird.
Welche Kritik wird an Hares Erklärung der moralischen Schwäche geübt?
Die Kritik richtet sich gegen die Annahme, dass moralische Schwäche notwendigerweise auf psychischer Unfähigkeit beruht. Es wird argumentiert, dass der innere Konflikt, der mit moralischer Schwäche einhergeht, in Hares Theorie nicht ausreichend berücksichtigt wird. Außerdem wird die Behauptung, dass moralische Urteile die Form einfacher Allaussagen haben, in Frage gestellt.
Wie erklärt Hare moralische Konflikte in "Moralisches Denken"?
In "Moralisches Denken" führt Hare zwei Ebenen des Denkens ein: die intuitive und die kritische Ebene. Auf der intuitiven Ebene verwenden wir prima-facie-Prinzipien, die jedoch zu Konflikten führen können. Auf der kritischen Ebene versuchen wir, diese Konflikte durch Abwägung aller relevanten Aspekte zu lösen. Moralische Schwäche existiert nur auf der intuitiven Ebene.
Welche alternative Sichtweise wird zur moralischen Schwäche vorgeschlagen?
Es wird vorgeschlagen, moralische Schwäche als unbeabsichtigten Aspekt einer absichtlichen Handlung zu betrachten. Dies bedeutet, dass eine Handlung sowohl moralisch schwach als auch beabsichtigt sein kann. Der Handelnde hat eine bestimmte Absicht, aber die Handlung hat unbeabsichtigte moralische Konsequenzen. Searle´s Intentionalitätstheorie bietet hier eine Grundlage.
Wie kann die Theorie des universellen Präskriptivismus mit der alternativen Sichtweise auf moralische Schwäche in Einklang gebracht werden?
Indem man berücksichtigt, dass moralisches Versagen ein unbeabsichtigter Aspekt einer absichtlichen Handlung ist. Wir handeln nicht entgegen eines Moralurteils, sondern die Handlung hat unbeabsichtigt moralische Konsequenzen. Moralurteile bleiben universell präskriptiv, und wir fühlen uns verpflichtet, ihnen entsprechend zu handeln. Der moralische Konflikt entsteht aus der Spannung zwischen der Notwendigkeit, dem Moralurteil zu entsprechen, und dem gleichzeitigen Verstoß dagegen.
Welche Rolle spielt die Intentionalitätstheorie von Searle in der Erklärung der moralischen Schwäche?
Searle´s Intentionalitätstheorie hilft zu verstehen, wie eine Handlung mehrere Aspekte haben kann, von denen einige beabsichtigt und andere unbeabsichtigt sind. Moralische Schwäche wird so zu einem unbeabsichtigten Aspekt einer Handlung, die an sich eine gewollte Handlung ist. Die kausale Selbstbezüglichkeit ist hier wichtig.
- Quote paper
- Güde Godbersen (Author), 2004, Moralische Schwäche. Psychische Unfähigkeit, Unwissenheit oder unbeabsichtigter Aspekt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/109535