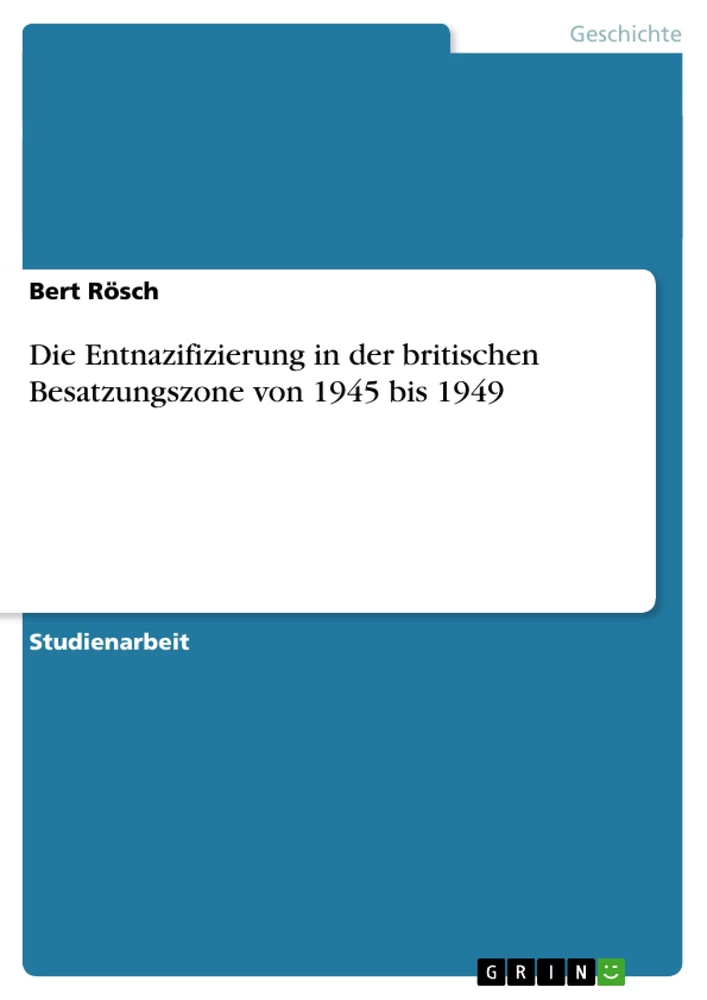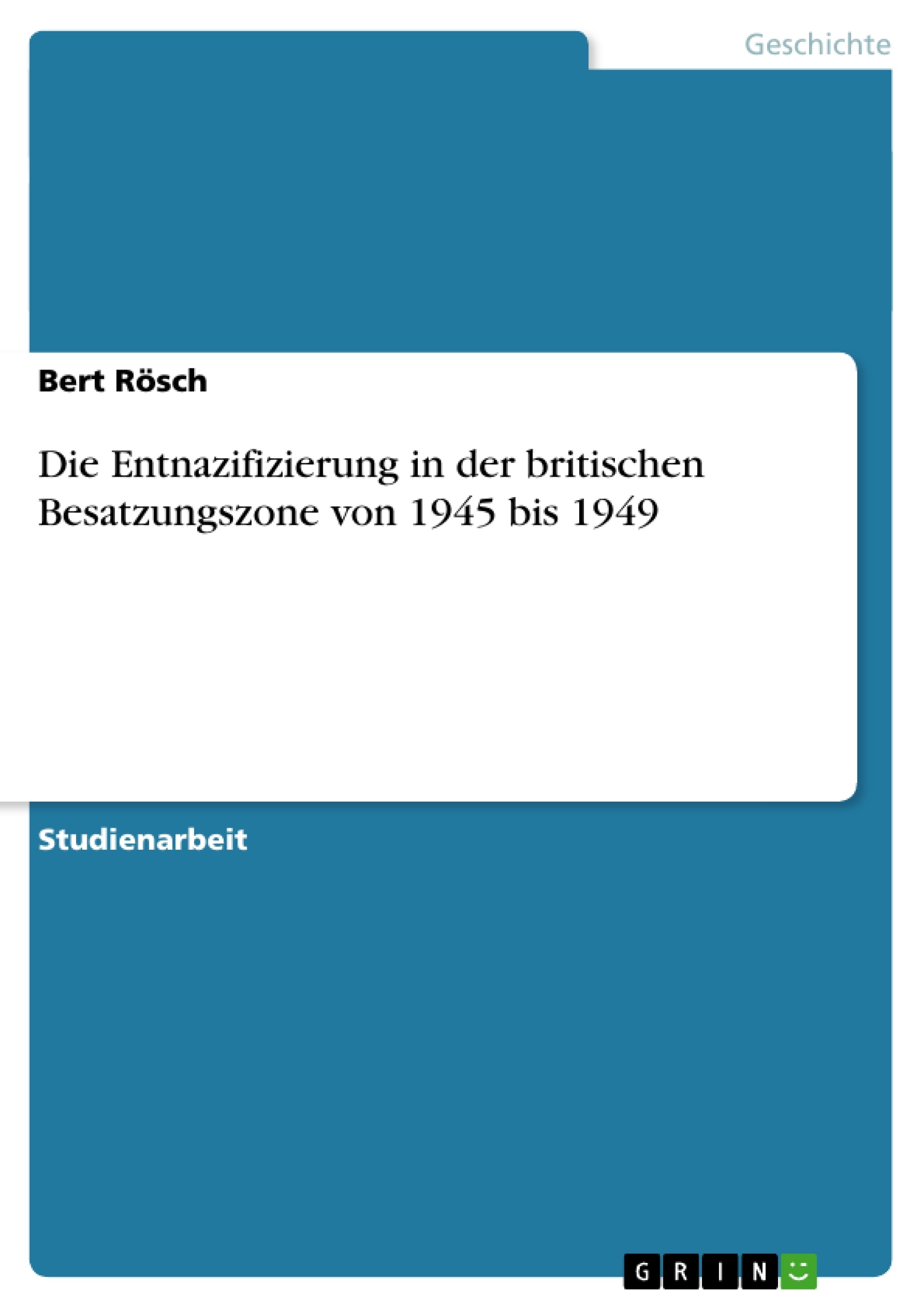Stellen Sie sich ein Deutschland im Trümmerhaufen vor, eine Nation, die mit der Last ihrer jüngsten Vergangenheit ringt. Inmitten von Chaos und Unsicherheit ergreifen die alliierten Siegermächte das Ruder, um ein dunkles Kapitel zu bereinigen: die Entnazifizierung. Diese fesselnde historische Analyse taucht tief in die britische Besatzungszone ein und enthüllt die komplexen Strategien, die zur Ausmerzung des Nationalsozialismus aus der deutschen Gesellschaft eingesetzt wurden. Von improvisierten Anfängen bis hin zur schrittweisen Übergabe an deutsche Hände verfolgt dieses Buch die vier entscheidenden Phasen der britischen Entnazifizierungspolitik. Es beleuchtet die anfänglichen Herausforderungen, die Beschleunigung durch deutsche Entnazifizierungsausschüsse, die Individualisierung durch Kategorisierung und schließlich die Übertragung der Verantwortung an die deutschen Länder. Doch wie effektiv war dieser Prozess wirklich? War es ein Triumph der Gerechtigkeit oder ein Kompromiss zwischen Idealen und pragmatischen Notwendigkeiten? Anhand zeitgenössischer und späterer Kritik seziert diese Arbeit die Stärken und Schwächen der britischen Bemühungen und bietet eine differenzierte Bewertung ihres Erbes. Untersucht werden die politischen Säuberungen, die Rolle der Militärregierung, die Fragebögen zur Überprüfung der Belastetheit, sowie die Entlassungen und Internierungen. Ein besonderes Augenmerk wird auf die unterschiedliche Handhabung im Vergleich zu den anderen Besatzungszonen gelegt, insbesondere den USA und der Sowjetunion. Erfahren Sie, wie wirtschaftliche Erwägungen, administrative Zwänge und das Bestreben nach Stabilität die britische Politik prägten. Entdecken Sie die oft widersprüchlichen Urteile, die gefällt wurden, und die daraus resultierende öffentliche Wahrnehmung von Willkür und Ungerechtigkeit. War die britische Entnazifizierungspolitik ein notwendiges Übel oder ein moralisches Versagen? Diese umfassende Studie lädt Sie ein, die Vergangenheit kritisch zu hinterfragen und die anhaltenden Auswirkungen der Entnazifizierung auf die deutsche Identität und das kollektive Gedächtnis zu verstehen. Es werden die Begriffsbestimmungen der Entnazifizierung, Internierung und Strafverfolgung in der britischen Zone dargelegt, um ein klares Verständnis der verschiedenen Maßnahmen zu gewährleisten. Tauchen Sie ein in die Archive, analysieren Sie die Entscheidungen der Besatzer und bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil über eines der umstrittensten Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist entscheidend für die Gestaltung der Zukunft.
Inhalt
1.1. Historische Einleitung
1.2. Forschungsstand
1.3. Begriffsbestimmungen
2. Hauptteil: Die Entnazifizierung in der britischen Besatzungszone von 1945 bis
2.1. Erste Phase: Improvisationen (Frühjahr 1945 bis Januar 1946)
2.2. Zweite Phase: Beschleunigung durch deutsche Entnazifizierungsausschüsse (12. Januar 1946 bis April 1947)
2.3. Dritte Phase: Individualisierung durch Kategorisierung (April bis September 1947)
2.4. Vierte Phase: „Turn it over to the Germans!“ - Übertragung der Entnazifizierung auf deutsche Länder (1.Oktober 1947 bis Ende 1949)
3. Beurteilung der britischen Entnazifizierungspolitik
3.1. Zeitgenössische Kritik
3.2. Spätere Kritik
4. Schlußteil
4.1. Zusammenfassung
4.2. Resümee
5. Literaturverzeichnis.
1.1. Historische Einleitung
„Es ist unser unbeugsamer Wille, den deutschen Militarismus und Nazismus zu vernichten und die Garantie dafür zu schaffen, daß Deutschland nie wieder in der Lage sein wird, den Weltfrieden zu brechen; (...) alle Kriegsverbrecher einer gerechten und schnellen Bestrafung zuzuführen; (...) die Nazi-Partei, die nazistischen Gesetze, Organi- sationen und Einrichtungen vom Erdboden zu tilgen; alle nazistischen und militärischen Einflüsse aus öffentlichen Einrichtungen, dem Kultur- und Wirtschaftsleben des deutschen Volkes zu entfernen.“ 1
So formulierten die Alliierten in einem Kommuniqué der Konferenz von Jalta im Februar 1945 ihre Ziele für die Nachkriegszeit. Der Ausrottung des Nationalsozialismus kam dabei eine wichtige Rolle zu. Die nationalsozialistischen Gesetze und NS-Organi- sationen zu beseitigen, stellte kein großes Problem dar. Viel schwieriger gestaltete sich dagegen die Lösung der Frage, wie man mit dem Personal des Dritten Reiches verfahren sollte. Dabei trennten die Alliierten zwischen der strafrechtlichen Verfolgung, die durch Militär- und Zivilgerichte vorgenommen wurde, und der politischen Säube- rung, deren Aufgabe es war, zumindest die Repräsentanten des alten Regimes auszuschalten und die Schlüsselstellungen mit in den Augen der Besatzer politisch zuverlässigen Personen zu besetzen, wobei der Schwerpunkt auf den Schaltstellen der politischen und staatlichen Exekutive, insbesondere Justiz, Polizei und Armee, sowie dem Erziehungswesen und den öffentlichen Medien lag.
Im Nachkriegsdeutschland fielen alle Maßnahmen, die grob zusammengefaßt als Entna- zifizierung bezeichnet werden können2, in den Aufgabenbereich der Siegermächte, die diese nach eigenem Gutdünken und ohne deutsche Mitwirkung qua Besatzungsrecht de- finierten und durchführten. Zwar verabschiedete der Alliierte Kontrollrat im Januar 1946 mit der Direktive 243 eine einheitliche Entnazifizierungsrichtlinie, doch wurde diese in den einzelnen Besatzungszonen sehr unterschiedlich gehandhabt: In der sowjetischen Zone wurde die Direktive als Instrument zur grundlegenden strukturellen Umwälzung der Gesellschaft begriffen, so daß die Säuberung sehr viel entschlossener und konsequenter als in den Westzonen umgesetzt wurde. Die Entfernung ehemaliger Nazis aus wichtigen Positionen diente nicht nur der Abrechnung mit dem Nationalsozialismus, sondern setzte zugleich den kommunistischen Führungsanspruch im Zuge der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung durch.
In den Westzonen beschränkte sich die Entnazifizierung im wesentlichen auf eine umfassende politische Personalsäuberung, bei der die Wirtschaftsstruktur im Gegensatz zur sowjetischen Zone im großen und ganzen unangetastet blieb. Die Amerikaner gaben hierbei die Richtung vor, der die Briten und Franzosen zeitverzögert mehr oder weniger folgten. Während bei den Amerikanern die Entnazifizierung den Grundpfeiler der Besatzungspolitik darstellte, kam ihr in der britischen und französischen Zone eine weitaus geringere Bedeutung zu.4
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entnazifizierung in der britischen Besatzungszone und stellt dar, wie die Säuberung vom Nationalsozialismus dort von statten ging. Die britische Entnazifizierung ist insofern interessant, als sie innerhalb der Westzonen eine Art Mittelweg zwischen der laxen Handhabung in der französischen und der allzu übereifrigen Verfahrensweise in der amerikanischen Zone darstellt.5
Im ersten Teil der Untersuchung werden die vier Phasen der britischen Entnazifizierung beschrieben und die Zäsuren und Kontinuitäten dieses Verfahrens aufgezeigt. Im zweiten Teil wird anhand der zeitgenössischen und späteren Kritik an der Entnazifizierung der Versuch unternommen, ein abschließendes Urteil über die Ent- nazifizierung in der britischen Zone zu finden. War sie - wie es Kielmannsegg formulierte6 - ein totaler Fehlschlag oder - wie Krüger es darstellte7 - die im Rahmen des Machbaren bestmögliche Lösung, die Schlimmeres verhinderte und den Weg für den Neuaufbau Deutschlands ebnete?
1.2. Forschungsstand
Während für die amerikanische und die französische Zone umfassende Betrachtungen der dortigen Entnazifizierungspolitik vorliegen8, fehlt für die britische Zone eine ausführliche Darstellung über das gesamte Besatzungsgebiet. Eingehende Untersuchungen beschränken sich auf einzelne Regionen: Wolfgang Krüger und Irmgard Lange befaßten sich mit der Entnazifizierung in Nordrhein-Westfalen, Karin Werum nahm die Säuberung der hamburgischen Verwaltung in Augenschein, und Anselm Faust verfaßte ein Buch über die Entnazifizierung in Wuppertal.9 Gute aber recht kurze Überblicke über die britische Entnazifizierungspolitik geben Justus Fürstenau, Clemens Vollnhals und Joachim Gödde.10 Trotzdem kann die Forschungslage über die Entnazifizierung in der britischen Besatzungszone insgesamt als gut bezeichnet werden. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Darstellungen von Fürstenau, Vollnhals, Gödde und Krüger. Auch die Quellenlage ist als gut zu bezeichnen, wobei erneut die Bücher von Vollnhals und Lange hervorzuheben sind, die einen großen Fundus an aufschlußreichen Quellen bieten: In Langes Buch wurden auf übersichtliche Weise die wichtigsten Direktiven und Verordnungen abgedruckt, bei Vollenhals findet man zudem interessante Kommentare von Zeitgenossen sowie Protokolle von wichtigen Sitzungen.
1.3. Begriffsbestimmung
Laut Heiner Wember umfaßt der Begriff Entnazifizierung zwei unterschiedliche Defini- tionen. Die erste beinhaltet alle Maßnahmen zur politischen Säuberung und Umgestal- tung im besetzten Deutschland, also alles, was die Alliierten in Bezug auf Personen und Strukturen aus der NS-Zeit unternahmen. Darunter fallen die personelle Säuberung, die Verhaftung von Personen aus Gründen wie persönliche Straftaten und Zugehörigkeit zu verbrecherischen Organisationen11 sowie strukturelle Umwälzungen in Form von Bodenreformen, Enteignungen, Entflechtungen und Demokratisierung. Der Nachteil dieser Definition besteht darin, daß hier Maßnahmen unterschiedlichster Art und Intention unter einem - dadurch verschwommenen - Begriff zusammengefaßt werden. Die weitgehend sozialen Reformen in der sowjetischen Zone entsprangen beispielsweise einer ganz anderen politischen Intention als die personelle Säuberung in der britischen Zone.12
Die zweite Definition faßt die Entnazifizierung wesentlich enger: Sie begrenzt die Entnazifizierung auf die personelle Säuberung von wichtigen Positionen im öffentlichen Dienst und in der Wirtschaft. Diese Begriffsbestimmung hat sich auch bei den meisten Zeitzeugen eingeprägt. Sie verstanden unter der Entnazifizierung die personelle Säuberung, nicht aber die Internierung.13 Die Entnazifizierung wird in dieser Definition deutlich von der Internierung und der Strafverfolgung unterschieden, wodurch die sehr verschiedenen Bereiche eigene Konturen erhalten. Diese engere Auslegung des Entnazifizierungsbegriffes entspricht auch der Kontrollrats-Direktive Nr. 24: „Die Entfernung aller Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei, die ihr aktiv und nicht nur nominell angehört haben und aller derjenigen Personen, die den Bestrebungen der Alliierten feindlich gegenüberstehen, aus öffentlichen und halböffentlichen Ämtern und aus verantwortlichen Stellen in bedeutenden privaten Unternehmen. Diese sind durch solche Personen zu ersetzen, die nach ihrer politischen und moralischen Einstellung für fähig erachtet werden, die Entwicklung wahrer demokratischer Einrichtungen inDeutschland zu fördern.“14 Das heißt, daß die belasteten Deutschen entlassen werden sollten, um Platz für in den Augen der Briten politisch zuverlässige Personen zu schaffen. Die Entlassung war nach Meinung der Alliierten Strafe genug. Hier ist ein qualitativer Unterschied zwischen Entnazifizierung und Internierung in der britischen Zone zu erkennen. Denn interniert wurden nur diejenigen Deutschen, die als so gefährlich angesehen wurden, daß sie auch als Privatpersonen eine Gefährdung der Besatzungstruppen darstellten. Insofern kann man die Internierung in der britischen Zone folgendermaßen definieren: Neutralisierung der Aktivitäten von potentiell gefährlichen Personen.15
Internierung bedingte immer eine anschließende Entnazifizierung. Folglich ist die Inter- nierung keine Maßnahme innerhalb der Entnazifizierung sondern eine eigenständige. Dies gilt übrigens nur für die britische Zone. Bei den Amerikanern verlief die Grenze zwischen Internierung und Entnazifizierung fließend.16
Für die britische Zone lassen sich demnach folgende Definitionen aufstellen:
1. Die Entnazifizierung umfaßt den Bereich der personellen Säuberungen mit der Hauptsanktion Entlassung aus dem Amt. Ziel war die Neubesetzung von wichtigen Funktionen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft mit zuverlässigen Personen.
2. Die Internierung umfaßte die Neutralisierung von Personen aus der Gesellschaft, die den Briten als Sicherheitsrisiko für die eigenen Truppen erschienen. Ziel: Sicherheit der Besatzungstruppen.
3. Die Strafverfolgung umfaßte zwei verschiedene Gebiete. Erstens die eigentlichen Kriegsverbrecherprozesse, bei denen Personen wegen persönlicher Straftaten angeklagt wurden. Zweitens Spruchgerichtverfahren gegen ehemalige Angehörige der vom Nürnberger Militärtribunal als verbrecherisch erklärten Organisationen.
Ziel: strafrechtliche Verfolgung von persönlichen Straftaten und Organisationsverbrechen während der NZ-Zeit.17
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich fast ausschließlich mit der britischen Entnazifi- zierung im obig eingegrenzten Sinne. Sowohl die Internierung als auch die Strafverfolgung, die - wie eben beschrieben - Themen für sich sind, werden nur am Rande behandelt.
2. Die Entnazifizierung in der britischen Besatzungszone
2.1. Erste Phase: Improvisationen (Frühjahr 1945 bis Januar 1946)
In den ersten Monaten der Besatzung folgten die Briten weitestgehend den amerikanischen Richtlinien.18 Die Personalsäuberung nahm dabei nur langsam an Umfang und Tiefe zu. Da bis Anfang 1946 keine ausgearbeiteten Durchfüh- rungsverordnungen vorhanden waren, erlangte die Anweisung Nr. 3 der Fi- nanzabteilung19 der britischen Militärregierung eine besondere Bedeutung. Diese war eigentlich nur für die Entnazifizierung der Finanzverwaltung und des öffentlichen und privaten Finanzwesens gedacht. Sie blieb aber in der Zwischenzeit mangels Alternative die maßgebliche Grundlage des gesamten Verfahrens.20 Die Anweisung sah vor, daß jeder Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, der vor dem 1. Januar 1938 eine höhere Stelle als die eines Büroangestellten eingenommen hatte, einen Fragebogen ausfüllen mußte. Der jeweilige Behördenchef überprüfte diesen auf Glaubwürdigkeit und versah ihn mit einer vorläufigen Einstufung. Die mit der Entnazifizierung beauf- tragte Public Safety Branch der Militärregierung bestimmte daraufhin ohne Anhörung und Widerspruchsrecht, ob der Betroffene zu entlassen oder zu suspendieren war. Straffällig gewordene Personen, die ein Sicherheitsrisiko für die Besatzer darstellten, wurden interniert und kamen vor Spruchgerichte oder Kriegsverbrecher-Tribunale.
Automatisch entlassungspflichtig waren alle, die vor dem 1. April 1933 Mitglied der NSDAP, SA oder SS waren bzw. einen SS-Rang vom Scharführer aufwärts bekleideten.
Außerdem alle Deutschen, die in der Hitlerjugend oder im Reichsarbeitsdienst einen Offiziersrang inne gehabt hatten, sowie alle Mitglieder des Generalstabs, Angestellte der Gestapo oder des Sicherheitsdienstes der SS (SD). Mit der Entlassung verbunden war eine Sperrung des Privatvermögens und die Einstellung der Gehaltszahlungen.21 Das Hauptproblem bei dieser Verfahrensweise bestand darin, daß viele Betroffene bis zu zwei Jahre auf ihr endgültiges Urteil warten mußten. Bis dahin konnten sie nur niederen Beschäftigungen, sogenannter gewöhnlicher Arbeit, nachgehen. Für die meisten Beschuldigten lag in diesem Punkt die eigentliche Schärfe der Entnazifizierung, nicht im Urteil der Militärregierung.22 Die Briten waren sich dieser Problematik wohl bewußt, weshalb sie die Fälle der führenden Nazis aufschoben und die vielen Mitläufer vorrangig behandelten, damit diese wieder schnell in Brot und Arbeit kommen konnte.23
Bis zum 31. Dezember 1945 wertete die Public Safetey Branch 538.806 Fragebögen aus. 43.288 Personen wurden als entlassungspflichtig eingestuft. Bei 28.585 Beschäftig- ten wurde die Entlassung anheim gestellt, 419.492 Bewerbern die Neuanstellung untersagt.24
Im Gegensatz zu dem Amerikanern orientierten sich die Briten bei der Entnazifizierung nicht an abstrakten moralischen Kategorien und Forderungen einer übermächtigen öffentlichen Meinung, sondern vorrangig an den Erfordernissen der praktischen Politik.25 Im Vordergrund dieses überaus pragmatischen Ansatzes stand die Verhinderung eines „Holocaust of sudden dismissal“26 und die Versorgung der Bevölkerung.27 Insofern konzentrierte man sich hauptsächlich darauf, den „Battle of the Winter“28 zu gewinnen, anstatt dem Beispiel der Amerikaner zu folgen und die Entnazifizierung ohne Rücksicht auf das möglicherweise durch Massenentlassungen entstehende Chaos durchzuziehen. Laut Henke waren die Briten der Meinung, daß eine konsequente Entnazifizierung „dysfunktional zum Wiederaufbau“ wirkt.29 Neben der Vermeidung eines möglichen Chaos’ setzten die Briten alles daran, die Kosten für die Entnazifizierung möglichst gering zu halten. Der Zweite Weltkrieg hatte das Königreich nämlich an den Rand eins Staatsbankrotts gebracht, so daß eine konsequente Entnazifizierung, wie sie die Amerikaner praktizierten, in der britischen Zone gar nicht finanzierbar gewesen wäre. Außerdem ergab sich aus der besatzungspolitischen Maxime der sogenannten indirect rule, die die Beibehaltung und Instrumentalisierung der vorhandenen Verwaltungsstrukturen vorsah, die Notwendigkeit, die Administrationen durch die Entnazifizierung nicht zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen, sondern vielmehr in den Dienst der Besatzer zu stellen.30
Dieser „Geist eines konstruktiven Pragmatismus“31 kam vor allem der Wirtschaft zugu- te. Während das Bildungswesen, die Polizei und die öffentliche Verwaltung von der Entnazifizierungswelle immerhin erfaßt worden waren, hatte die Säuberung der Industrie bis zum Jahreswechsel 1945/46 noch kaum begonnen. Einige Berufsgruppen wurden von der Entnazifizierung weitestgehend ausgenommen. So galten Milderungs- und Sonderregelungen für Landwirtschaft, Bergbau und Gesundheitsdienst.32 Theodor Steltzer von der CDU schilderte die damalige Lage folgendermaßen: „Die Mitläufer wurden strenger behandelt als frühere führende Nazis. Diesen gegenüber wurden bald die Augen zugedrückt, wenn man sie ungeachtet ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit für tüchtige Experten hielt.“33 Viele Deutsche empfanden diesen Pragmatismus als Willkür gegenüber den Besiegten, quasi als Rachefeldzug der Allierten.34 Es herrschte folglich bald vielerorts der Eindruck vor, daß man die Kleinen hängt und die Großen laufen läßt. Zweifelsohne ein harter Schlag für das moralische Ansehen der Entnazifizierung.35
Ein weiteres Motiv der britischen Entnazifizierungspolitik bestand darin, die Deutschen nicht mit demokratischen Ermahnungen zu traktieren, sondern den „materiellen und geistig-kulturellen Rahmen zu schaffen, der es ihnen erlauben würde, sich gewissermaßen selbst aus dem Sumpf der Vergangenheit zu ziehen“
[...]
1 Zitiert in Fischer, Alexander (Hrsg.): Teheran, Jalta, Potsdam. Die sowjetischen Protokolle von den Kriegskonferenzen der „Großen Drei“. Köln 1968, S. 184 f.
2 Eine genauere Begriffsbestimmung der Entnazifizierung, nämlich die, die für die britische Zone gültig ist, wird im nächsten Kapitel vorgenommen.
3 Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, S. 98 ff.
4 Man muß bei der der Entnazifizierungspolitik der einzelnen Zonen stark zwischen den Westzonen und der sowjetisch besetzten Zone trennen, da die Säuberung im Osten unter einem ganz anderen Vorzeichen als im Westen stand. Dort war sie mit einem Systemwechsel verbunden, für den eine Auswechslung der Führungsspitzen sowieso unerläßlich war. Insofern kann man die westlichen Zonen nicht an diesem Beispiel messen. Zur US-Zone siehe: Niethammer, Lutz: Entnazifizierung in Bayern, Säuberung und Rehabilitierung unter amerikanischer Besatzung. Frankfurt/Main 1972. Zur französische Zone: Henke, Klaus-Dietmar: Politische Säuberung unter französischer Besatzung. Stuttgart 1981.
5 Ebenda.
6 Kielmannsegg, Peter Graf: Lange Schatten. Berlin 1989, S. 31.
7 Krüger, Wolfgang: Entnazifiziert: Zur Praxis der politischen Säuberung in Nordrhein-Westfalen. Wuppertal 1982, S. 158 f.
8 Für die US-Zone: Niethammer, Lutz: Entnazifizierung in Bayern, Säuberung und Rehabilitierung unter amerikanischer Besatzung. Frankfurt/Main 1972. Für die französische Zone: Henke, Klaus-Dietmar: Politische Säuberung unter französischer Besatzung. Stuttgart 1981.
9 Krüger, Wolfgang: Entnazifiziert: Zur Praxis der politischen Säuberung in Nordrhein-Westfalen. Wuppertal 1982; Lange, Irmgard: Entnazifzierung in Nordrhein-Westfalen. Richtlinien, Anweisungen und Organisation. Siegburg 1976; Werum, Karin: Die Entnazifizierung der Verwaltungsbeamten in Hamburg (1945-1950). Hamburg 1987; Faust, Anselm: Entnazifizierung in Wuppertal. Wuppertal 1992.
10 Fürstenau; Justus: Entnazifizierung. Berlin 1969, Vollnhals, Clemens: Entnazifizierung - Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945-49. München 1991; Gödde, Joachim:
11 Als verbrecherische Organisationen galten das Korps der Politischen Leiter der NSDAP, SS, Gestapo und der Sicherheitsdienst (SD). In der Sowjetzone wurde man zudem dann entlassen, wenn man in den Augen der Besatzer ein Klassenfeind oder Militarist war. Eine kurze Übersicht über die Entnazifizierung in der sowjetischen Zone mit weiteren Literaturverweisen findet sich in Vollnhals, S. 43-55.
12 Wember, Heiner: Umerziehung im Lager. Internierung und Bestrafung von Nationalsozialisten in der britischen Besatzungszone Deutschlands. Essen 1992, S. 22.
13 Ebenda, S. 23. Vgl. Hüttenberger, Peter: Entnazifizierung im öffentlichen Dienst Nordrhein- Westfalens. In: Schwegmann, F.G. (Hrsg.): Die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums nach 1945, S. 47.
14 Kontrollrats-Direktive Nr. 24 vom 12.1.46 „Entfernung von Nationalsozialisten und Personen, die den Bestebungen der Allierten feindlich gegenüberstehen, aus Ämtern und verantwortlichen Stellungen“. In: Amtsblatt des Kontrollrates, S. 98.
15 Wember: Umerziehung im Lager, S. 23.
16 Ebenda.
17 Ebenda, S. 25.
18 Vgl. FitzGibbon: Denazification. London 1969, S. 119: „The British tried to keep step, more or less, with the Americans“.
19 Anweisung der Militärregierung, Finanzabteilung, an finanzielle Unternehmen und
Regierungsfinanzbehörden Nr. 3, undatiert. In: Lange, Irmgard: Entnazifzierung in Nordrhein-Westfalen. Richtlinien, Anweisungen und Organisation. Siegburg 1976, S. 79.
20 Schneider, Ulrich: Nach dem Sieg: Besatzungspolitik und Militärregierung 1945. In: Foschepoth, Josef/Sterninger, Rolf (Hrsg.): Britische Deutschlandpolitik 1945-49. Paderborn 1985, S. 60.
21 Vollnhals: Entnazifizierung - Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945-49. München 1991, S. 25ff.
22 Henke, Klaus-Dieter: Die Trennung vom Nationalsozialismus. In: Henke, Klaus-Dieter/Wöller, Hans (Hrsg.): Politische Säuberung in Europa. München 1991, S. 39 .
23 Gödde, Joachim: Entnazifizierung unter britischer Besatzung. In: Geschichte im Westen 6/1991, S. 68.
24 Vollnhals: Entnazifizierung, S. 26 f.
25 Gödde: Entnazifizierung unter britischer Besatzung, S. 68. Vgl. Turner, Ian D.: Reconstruction in Post- War Germany. British Occupation Policy and the Western Zones, 1945-55. Oxford 1989, S. 161.
26 Turner: Reconstruction in Post-War Germany, S. 256.
27 Jones, Jill: Eradicating Nazism from the British Zone of Germany: Early Police and Practice. In: German History Vol. 8, No 2/1990, S. 147.
28 Ebenda.
29 Hüttenberger: Entnazifizierung im öffentlichen Dienst Nordrhein-Westfalens, S. 51.
30 Vgl. Gödde, Joachim: Entnazifizierung, S. 67. Vgl. Schneider: Nach dem Sieg, S. 59.
31 Ulrich Schneider zitiert in: Rauh-Kühne, Cornelia: Die Entnazifizierung und die deutsche Gesellschaft. In: Archiv für Sozialgeschichte. Bd. 35 (1995), S. 44.
32 Gödde, S. 68.
33 Krüger; Wolfgang: Entnazifiziert: Zur Praxis der politischen Säuberung in Nordrhein-Westfalen. Wuppertal 1982, S. 34.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der "Entnazifizierung in der britischen Besatzungszone"?
Es handelt sich um eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele, Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Der Fokus liegt auf der Entnazifizierungspolitik in der britischen Besatzungszone Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis listet folgende Themen auf: Historische Einleitung, Forschungsstand, Begriffsbestimmungen, die Phasen der Entnazifizierung in der britischen Besatzungszone (von Improvisationen bis zur Übergabe an deutsche Länder), Beurteilung der britischen Entnazifizierungspolitik (zeitgenössische und spätere Kritik), Schlussteil mit Zusammenfassung und Resümee sowie ein Literaturverzeichnis.
Was waren die Ziele der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg laut der Konferenz von Jalta?
Die Alliierten formulierten den unbedingten Willen zur Vernichtung des deutschen Militarismus und Nazismus, die Bestrafung von Kriegsverbrechern, die Beseitigung der Nazi-Partei und zugehöriger Organisationen sowie die Entfernung nazistischer und militärischer Einflüsse aus allen Bereichen des deutschen Lebens.
Wie unterschied sich die Entnazifizierung in den verschiedenen Besatzungszonen?
In der sowjetischen Zone diente die Entnazifizierung als Instrument zur grundlegenden strukturellen Umwälzung der Gesellschaft und wurde entschlossener umgesetzt. In den Westzonen, insbesondere in der britischen Zone, beschränkte sie sich im Wesentlichen auf eine politische Personalsäuberung, wobei die Wirtschaftsstruktur weitgehend unangetastet blieb. Die Amerikaner gaben die Richtung vor, der Briten und Franzosen mehr oder weniger folgten.
Welche Phasen der Entnazifizierung gab es in der britischen Zone?
Die Entnazifizierung in der britischen Zone wurde in vier Phasen unterteilt:
- Erste Phase: Improvisationen (Frühjahr 1945 bis Januar 1946)
- Zweite Phase: Beschleunigung durch deutsche Entnazifizierungsausschüsse (12. Januar 1946 bis April 1947)
- Dritte Phase: Individualisierung durch Kategorisierung (April bis September 1947)
- Vierte Phase: Übertragung der Entnazifizierung auf deutsche Länder (1. Oktober 1947 bis Ende 1949)
Welche Kritik gab es an der britischen Entnazifizierungspolitik?
Es gab zeitgenössische und spätere Kritik. Die Arbeit untersucht, ob die Entnazifizierung ein totaler Fehlschlag war oder die bestmögliche Lösung, die Schlimmeres verhinderte und den Weg für den Neuaufbau Deutschlands ebnete.
Was umfaßte der Begriff "Entnazifizierung" in der britischen Zone?
Der Begriff umfasste die personelle Säuberung wichtiger Positionen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft mit dem Ziel, diese mit politisch zuverlässigen Personen neu zu besetzen. Die Hauptsanktion war die Entlassung aus dem Amt.
Was bedeutete "Internierung" in der britischen Zone?
Die Internierung umfaßte die Neutralisierung von Personen, die den Briten als Sicherheitsrisiko für die eigenen Truppen erschienen. Es war eine eigenständige Maßnahme und keine Maßnahme innerhalb der Entnazifizierung.
Was war die "Strafverfolgung"?
Die Strafverfolgung umfasste Kriegsverbrecherprozesse wegen persönlicher Straftaten sowie Spruchgerichtverfahren gegen ehemalige Angehörige der vom Nürnberger Militärtribunal als verbrecherisch erklärten Organisationen.
Was war das Hauptproblem in der ersten Phase der Entnazifizierung (Frühjahr 1945 bis Januar 1946)?
Das Hauptproblem war die lange Wartezeit auf das endgültige Urteil. Viele Betroffene mussten bis zu zwei Jahre warten und konnten bis dahin nur minderwertige Arbeiten ausführen.
Warum orientierten sich die Briten bei der Entnazifizierung nicht an abstrakten moralischen Kategorien?
Die Briten orientierten sich vorrangig an den Erfordernissen der praktischen Politik, insbesondere an der Verhinderung eines "Holocaust of sudden dismissal" und der Versorgung der Bevölkerung. Sie waren der Meinung, dass eine konsequente Entnazifizierung den Wiederaufbau behindern würde.
Warum wurde die Wirtschaft von der Entnazifizierung weniger stark betroffen als andere Bereiche?
Die Briten verfolgten einen pragmatischen Ansatz und wollten die Wirtschaft nicht zu sehr in Mitleidenschaft ziehen, um den Wiederaufbau zu gewährleisten. Es galten Milderungs- und Sonderregelungen für Landwirtschaft, Bergbau und Gesundheitsdienst.
- Quote paper
- Bert Rösch (Author), 1998, Die Entnazifizierung in der britischen Besatzungszone von 1945 bis 1949, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/109516