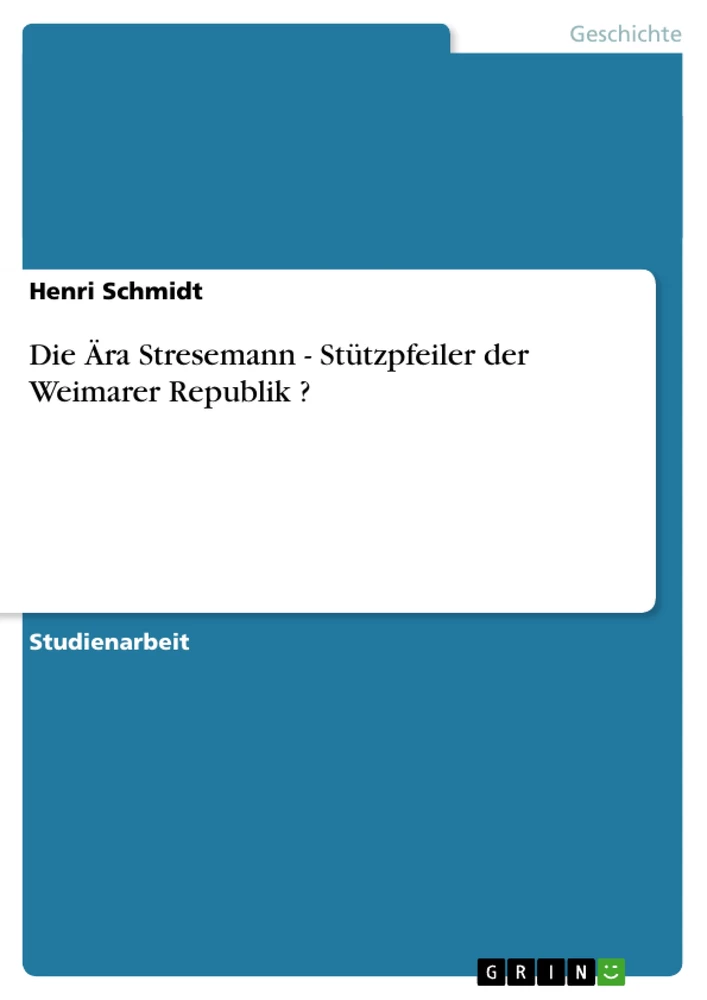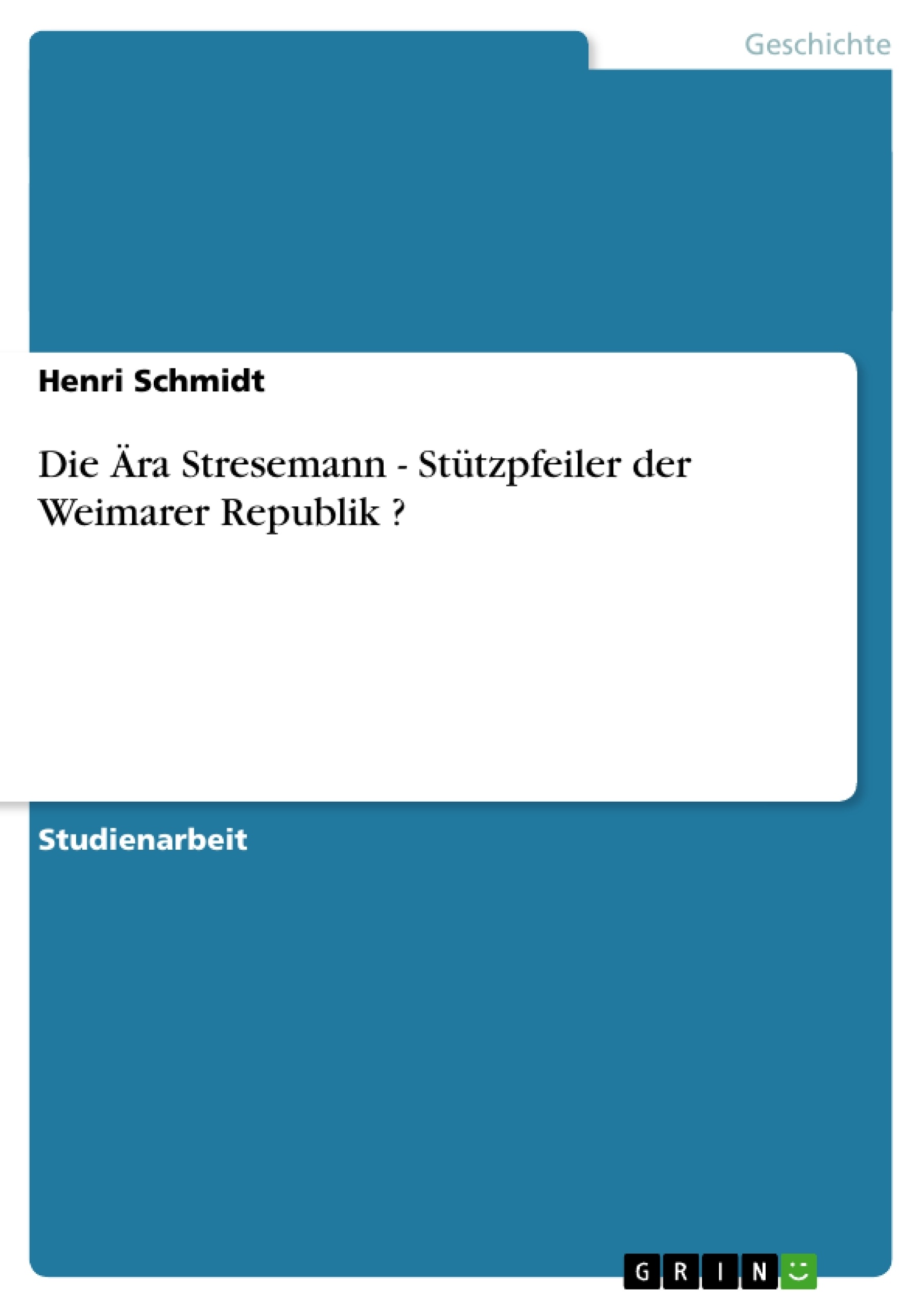„Gustav Stresemann - Stützpfeiler der Weimarer Republik?“ ist das Thema meiner folgenden Arbeit, welches ich wählte, da Stresemann immer wieder als einer der bedeutendsten Politiker der deutschen Geschichte dargestellt wird. Er wird in einem Zug mit großen Namen wie Otto von Bismarck oder Konrad Adenauer genannt. Auffällig jedoch ist, dass nur wenige seine Leistungen beschreiben können. Dies war für mich Grund genug, mich näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ganz besonders interessant ist dabei das Krisenjahr 1923, in welchem er Reichskanzler einer großen Koalition wurde. Deshalb wird die Darstellung dieses nur kurzen Lebensabschnittes auch den Schwerpunkt in meiner Arbeit bilden. Daneben werde ich allerdings noch auf die sehr wichtige Schaffensphase bis zu seinem Tod eingehen, in der er stets als Außenminister in der Regierung vertreten war. Stresemann stand durch seine Politik oft im Mittelpunkt und konnte so entscheidend zur Entwicklung der Weimarer Republik beitragen, seine Politik kennzeichnete diesen Staat, was das Thema so interessant macht. Bei dieser Arbeit unterstützt mich eine Vielzahl von Büchern. Besonders wichtig war dabei die Biographie „Stresemann. Ein Lebensbild“ von Felix Hirsch. Des Weiteren sind als Standardwerke auf jeden Fall „Die Außenpolitik der Republik von Weimar“ von Peter Krüger, „Weimar 1918 bis 1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie“ von Heinrich August Winkler sowie „Weimar, Deutschland von 1917-1933“ von Hagen Schulze zu nennen, wobei sich diese nicht speziell mit dem Thema Stresemann auseinandersetzten, jedoch ebenfalls wichtige Aspekte über seine Politik lieferten. Biographische Lücken in Stresemanns Leben gibt es nur noch von seiner Kindheit bis zu seinen politischen Anfängen. Der Forschungsstand für die von mir in der Arbeit beschriebene Zeit ist dagegen sehr gut. Das ist vor allem damit zu begründen, dass viele Primärquellen dieser Zeit, seien es Schriften oder Reden, noch vorhanden sind. Aber auch dadurch, dass sich viele über Stresemann als Politiker aus dem unmittelbaren Umfeld äußerten, hier ist vor allem der englische Botschafter in Berlin, Lord D’Abernon zu nennen, dessen Tagebücher voller Informationen über Stresemann steckten. Aus diesem Grund waren sie auch Grundlage zahlreicher Biographien.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Das Krisenjahr 1923 und die 100 Tage Stresemanns
1. Der Sturz Cunos - Stresemann wird Kanzler
2. Die Aufgabe des passiven Widerstandes
3. Die Währungsstabilisierung und das „Wunder der Rentenmark“
4. Bestrebungen gegen die Regierung - der Sturz Stresemanns
III. Stresemann als Außenminister und „heimlicher Kanzler“
1. Der Dawesplan und die vorübergehende Lösung der Reparationsfrage
2. Der Locarno-Pakt und die Aufnahme in den Völkerbund
IV. Schluss
V. Anmerkungsverzeichnis
VI. Literaturverzeichnis
Erklärung
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Hausarbeit selbständig angefertigt habe*); die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche von mir kenntlich gemacht.
Die Arbeit wurde bisher bei keiner anderen Gelegenheit vorgelegt.
*) Dies gilt nicht für Schreibarbeiten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
I. Einleitung
„Gustav Stresemann - Stützpfeiler der Weimarer Republik?“ ist das Thema meiner folgenden Arbeit, welches ich wählte, da Stresemann immer wieder als einer der bedeutendsten Politiker der deutschen Geschichte dargestellt wird. Er wird in einem Zug mit großen Namen wie Otto von Bismarck oder Konrad Adenauer genannt. Auffällig jedoch ist, dass nur wenige seine Leistungen beschreiben können. Dies war für mich Grund genug, mich näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ganz besonders interessant ist dabei das Krisenjahr 1923, in welchem er Reichskanzler einer großen Koalition wurde. Deshalb wird die Darstellung dieses nur kurzen Lebensabschnittes auch den Schwerpunkt in meiner Arbeit bilden. Daneben werde ich allerdings noch auf die sehr wichtige Schaffensphase bis zu seinem Tod eingehen, in der er stets als Außenminister in der Regierung vertreten war. Stresemann stand durch seine Politik oft im Mittelpunkt und konnte so entscheidend zur Entwicklung der Weimarer Republik beitragen, seine Politik kennzeichnete diesen Staat, was das Thema so interessant macht. Bei dieser Arbeit unterstützt mich eine Vielzahl von Büchern. Besonders wichtig war dabei die Biographie „Stresemann. Ein Lebensbild“ von Felix Hirsch. Des Weiteren sind als Standardwerke auf jeden Fall „Die Außenpolitik der Republik von Weimar“ von Peter Krüger, „Weimar 1918 bis 1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie“ von Heinrich August Winkler sowie „Weimar, Deutschland von 1917-1933“ von Hagen Schulze zu nennen, wobei sich diese nicht speziell mit dem Thema Stresemann auseinandersetzten, jedoch ebenfalls wichtige Aspekte über seine Politik lieferten. Biographische Lücken in Stresemanns Leben gibt es nur noch von seiner Kindheit bis zu seinen politischen Anfängen. Der Forschungsstand für die von mir in der Arbeit beschriebene Zeit ist dagegen sehr gut. Das ist vor allem damit zu begründen, dass viele Primärquellen dieser Zeit, seien es Schriften oder Reden, noch vorhanden sind. Aber auch dadurch, dass sich viele über Stresemann als Politiker aus dem unmittelbaren Umfeld äußerten, hier ist vor allem der englische Botschafter in Berlin, Lord D’Abernon zu nennen, dessen Tagebücher voller Informationen über Stresemann steckten. Aus diesem Grund waren sie auch Grundlage zahlreicher Biographien. So ist die Literaturlage insgesamt als durchaus gut zu bewerten, auch wenn auffällig ist, dass es besonders zwischen 1960 und 1980 sehr viele Veröffentlichungen über die Weimarer Republik und über Gustav Stresemann gab. Danach konnten nur noch wenige neue Erkenntnisse hinzugewonnen werden, was erklärt, warum jetzt nur noch vereinzelte Veröffentlichungen auftraten. Die besondere Brisanz dieses Themas ergibt sich schon aus dem historischen Kontext, mit welchem spätestens 1918 anzusetzen ist. Deutschland verlor den Ersten Weltkrieg und hatte deswegen in den Folgejahren mit den Nachwirkungen zu kämpfen, die sich vor allem aus den Regelungen des Versailler Vertrages ergaben. So musste Deutschland die alleinige Kriegsschuld nach Artikel 231 des Vertrages hinnehmen und wurde deswegen besonders hart bestraft.1 Vor allem die hohen Reparationszahlungen stellten für die junge Republik immer wieder eine große Last dar. Eine Radikalisierung nach links und rechts bildete sich heraus. Und dies war auch 1923 noch der indirekte Grund für den Rücktritt Cunos und die darauf folgende Übernahme des Kanzleramtes durch Stresemann. Im Folgenden werde ich versuchen die wichtigsten Stationen in der Politik Stresemanns zu beschreiben. Ich werde dabei vor allem das Umfeld darstellen, um dann auch Rückschlüsse auf Stresemanns eigene Leistung ziehen zu können.Die Gliederung meiner Abhandlung liefert dabei schon Aussagen über die wichtigsten Stationen. Ich gehe zunächst auf Stresemann als Kanzler ein, lege dabei besonderen Wert auf die Aufgabe des passiven Widerstandes und das „Wunder der Rentenmark“. Danach untersuche ich die Zeit im Amt des Außenministers, in der für mich der Dawesplan und die Locarnokonferenz die entscheidenden Ansatzpunkte bieten.„Stresemann wird mehrheitlich als eine Persönlichkeit bewertet, die in der neuen internationalen Politik geschickt mitspielte, die berechtigte deutsche Interessen (...) sachadäquat durchsetzen wollte und insofern als ein Garant des bestehenden internationalem Systems zu gelten hat.“2 „Es gibt wenige Figuren in der jüngeren deutschen Geschichte, an denen die Deutschen mit ungebrochener Zuneigung hängen (...).“3 Für mich gilt es im Folgenden anhand meiner Darstellung zu klären, ob Gustav Stresemann tatsächlich diesen aussagekräftigen Zitaten entspricht und ob er und seine Politik etwas wie den „Stützpfeiler der Weimarer Republik“ bildeten.
II. Das Krisenjahr 1923 und die 100 Tage Stresemanns
1. Der Sturz Cunos - Stresemann wird Kanzler
Das Jahr 1923 stellte eines der schwersten Jahre dar, die die Weimarer Republik in ihrer kurzen Geschichte erleben musste. In diesem Jahr trat Gustav Stresemann sein Kanzleramt an. Noch am 1. August 1923, wo bereits ein Großteil der Parteien, welche im Reichstag vertreten waren, die Übernahme des Kanzleramtes durch Stresemann forderten, erklärte er in einer politischen Umschau: „Gegenwärtig liegen die Verhältnisse in Deutschland so, dass es wirklich kaum jemanden in irgendeiner Partei geben wird, der ein Interesse daran hätte, das Amt eines Kanzlers oder eines Ministers zu erstreben.“4 Ihm war also die schwere Lage, in der sich die junge Republik befand, bewusst. Doch schon am 12. August trat der bisherige Kanzler Cuno aus seinem Amt als Reichskanzler zurück, da er die starke Kritik aus der sozialdemokratischen Fraktion nicht verkraften konnte, deren Missmut sich hauptsächlich aus der hohen Arbeitslosigkeit, den hungernden Menschen sowie zahlreichen Plünderungen und der Forderung einer stabilen Währung entwickelte.5 Reichspräsident Ebert beschloss dann Stresemann mit der Bildung eines neuen Kabinetts zu beauftragen, „da er eine Regierung suchte, deren Basis so breit wie möglich und deren Kanzler so weit rechts wie möglich stehen sollte“.6 Stresemann übernahm das Amt noch am selben Tag und gab bereits zwei Tage später seine Regierungserklärung ab. Vom Reichstag wurde das Kabinett auch mit überwältigender Mehrheit angenommen, auch wenn erwähnt werden sollte, dass viele Sozialdemokraten, aber auch Mitglieder der eigenen Partei von der Abstimmung fernblieben oder sich ihrer Stimme enthielten. Dies begründet sich vor allem durch die Bildung der ersten großen Koalition der Weimarer Republik, welche oftmals auf Ablehnung stieß bzw. durch die Uneinstimmigkeit, die zwischen den Parteien bestand. Stresemanns Kabinett war prominent besetzt, so übernahm beispielsweise Rudolf Hilferding das Amt des Reichsfinanzministers, Stresemann selbst das des Außenministers.7 Er sah die Außenpolitik als wichtigstes Mittel an um sowohl die innenpolitische als auch die außenpolitische Ordnung wiederherzustellen. Sein vorrangiges Ziel stellte dabei die Stabilisierung der Währung dar, welche ohne die Aufgabe des passiven Widerstandes unmöglich war.
2. Die Aufgabe des passiven Widerstandes
Zunächst fand das neue Kabinett starken Rückhalt in der Bevölkerung, welche sich nach einer starken und vor allem handelnden Regierung sehnte, auch wenn dies von rechtsradikaler und extrem linker Seite her anders klang. So warf ihm zum Beispiel der kommunistische Abgeordnete Frölich eine Regierung des Großkapitals vor.8 Stresemann zeigte jedoch seine Leidenschaft für die Politik und gab seine Aufsichtsratmandate auf, was für ihn starke finanzielle Einbußen bedeutete. Als dann die ersten Ungereimtheiten beseitigt waren, begann Stresemann mit der Suche einer Kompromisslösung des Ruhr- Konflikts, denn ihm war klar, dass jeder Tag des passiven Widerstandes Geld kosten würde, da aus dem besetzten Gebiet keine Steuern flossen und außerdem die durch den Widerstand arbeitslose Bevölkerung versorgt werden musste, was die Inflation noch weiter vorantrieb.9 Eine solche Lösung zu finden, stellte sich jedoch als äußerst schwer dar, da dahinter Gefahren lauerten. Innenpolitisch drohte mit der Aufgabe des passiven Widerstandes die Revolution von links oder rechts. Außenpolitisch drohte die völlige Preisgabe des Ruhrgebietes, welches den wirtschaftlichen Mittelpunkt der Republik darstellte. So war es Stresemann klar, dass ohne das Ruhrgebiet keine Stabilisierung der Währung, damit keine Regelung der Reparationszahlungen und auch keine Befriedigung Frankreichs zu erreichen wäre.10 Zunächst klammerte er all seine Hoffnungen an die englische Regierung, welche nach der Übernahme des Kanzleramtes durch Stresemann die Besetzung des Ruhrgebietes für rechtswidrig erklärte. Doch eine aktive Beteiligung Englands bzw. deren Intervention schien immer unwahrscheinlicher, weshalb sich Stresemann neue Wege einfallen lassen musste. In Frage kam zum Beispiel eine Allianz mit Sowjetrussland unter der Erweiterung des Rapallovertrages, auch unter Akzeptanz des drohenden Bolschewismus. Weiterhin kamen der bewaffnete Widerstand gegen französische Truppen, die Kündigung des Versailler Vertrages oder aber die Verständigung mit Frankreich in Frage. Er sah jedoch hinter allen Lösungsansätzen die Diktatur lauern, die ihr bestes Beispiel in Italien fand.11 Da sich die Krisensituation mehr und mehr verschärfte, sahen viele Politiker das Unglück in der parlamentarischen Demokratie. Otto Wolf, führender Eisengroßhändler, brachte zum Ausdruck, dass Stresemann die Regierung veranlassen musste ,die Gründung eines „Rheinstaates, der auch einen Teil der Ruhr umfassen sollte“ in die Hand zu nehmen und diesen unter internationale Verwaltung zu stellen, da dort bereits „anarchistische Zustände“ herrschen.12 Stresemann entschloss sich jedoch zunächst direkte Verhandlungen mit dem französischen Ministerpräsidenten Poincaré aufzunehmen. Dieser war aber einer der stärksten Gegner, welchen die Weimarer Republik kannte. Deshalb scheiterten die Verhandlungen auch, da dieser nur bei einer Aufgabe aller Forderungen der Weimarer Regierung bereit war, in Verhandlungen zu treten. So blieb Stresemann trotz vieler innenpolitischer Gegner nur die Möglichkeit, den passiven Widerstand offiziell für beendet zu erklären. Dieses wurde dann auch tatsächlich am 26. September öffentlich proklamiert.13 Dieser Beschluss erregte natürlich die Gemüter nationaler Gesinnung, welche in der Aufgabe des Widerstandes die Kapitulation und damit die Anerkennung der Bestimmungen des Versailler Vertrages sahen. Bayern, welches sowohl aus nationalistischen, völkischen aber auch monarchistischen Gruppen bestand, verkündete daraufhin sofort den Ausnahmezustand, da die Regierung auf ihre Vorschläge zur Lösung des Konfliktes nicht eingegangen war. Der frühere, weit rechtsstehende Ministerpräsident Gustav Ritter von Kahr wurde zum Generalstaatskommissar bestellt. Bayern setzte sich damit gegen die Zentralgewalt zur Wehr. Die verschiedenen Gruppen in Bayern verband dabei nur eins, der Hass gegenüber der Berliner Zentralregierung. Stresemann wurde nun endgültig klar, dass eine Zusammenarbeit mit der bayrischen Regierung unmöglich war. Ebert erkannte dies auch und verhängte noch in der selben Nacht den Reichsausnahmezustand, die exekutive Gewalt ging auf Reichswehrminister Gessler über.14 Auch auf die Reichswehr in Bayern war nun kein Verlass mehr, da der dort kommandierende General von Lossow der Anweisung zum Verbot des „Völkischen Beobachters“ von General Seeckt, dem Chef der Reichswehr, nicht nachkam und die Regierung sich im Folgenden voll hinter ihn stellte.15 Die dort ansässige Reichswehr wurde von nun an auf Bayern vereidigt. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Dollarkurs schon etwa 100 Millionen Papiermark.16 Stresemann hatte also neue Probleme zu verkraften, doch zumindest schaffte er es, den passiven Widerstand zu beenden, um so eine Grundlage für neue Zielsetzungen zu legen und engere außenpolitische Beziehungen zu ermöglichen. Ein weiterer Schritt zu einer stabileren Republik deutete sich nun in einem Ermächtigungsgesetz an, das der Regierung besondere finanzielle, wirtschaftliche und soziale Vollmachten erteilen sollte, was nun aber auch noch zu einer Kabinettskrise führte.17
3. Die Währungsstabilisierung und das „Wunder der Rentenmark“
Das geplante Ermächtigungsgesetz zielte vor allem in zwei Richtungen, zum einen sollten radikale Finanzmaßnahmen eingeleitet werden, welche die immer rasanter ansteigende Inflation beenden sollten, der Dollarkurs stand inzwischen bei 600 Millionen Papiermark. Zum anderen hatte die Regierung die Absicht, ihre Autorisierung zur Änderung der Arbeitszeitbestimmungen in das Gesetz hineinzuarbeiten. Dies hätte die Möglichkeit zur Verlängerung des Achtstundentages, besonders natürlich in den für den Staat lebenswichtigen Betrieben, das heißt der wirtschaftlich besonders starken Eisen- und Kohleindustrie, gegeben.18 Zahlreiche Industrielle hatten diese Forderungen unterstützt, wohingegen Arbeiterführer, wie zum Beispiel Robert Schmidt, die Abschaffung dieses sozialistischen Ideals ablehnten. So stimmten die Sozialdemokraten mit knapper Mehrheit gegen eine solche Regelung. Für Stresemann und seine Partei, die Deutsche Volkspartei, war hingegen die Regelung sozialpolitischer, wirtschaftlicher und finanzieller Fragen untrennbar, was einem gemeinsamen Weg die Basis nahm.19 Dies stellte die bisher größte Schwierigkeit für Stresemann und sein Kabinett dar. Er beschloss deshalb am 3. Oktober 1923 zurückzutreten. Reichspräsident Ebert veranlasste Stresemann jedoch sofort mit der Neubildung der Regierung. In seinem Tagebuch sprach er von „tiefster Depression“20, es gelang aber trotzdem, schnell einen Kompromiss für die Arbeitszeitfrage zu finden. So konnte er schon am 6. Oktober ein neues Kabinett aufstellen, in dem sich nur wenig gegenüber dem alten änderte. Eine wichtige Rolle dabei spielte das Finanzressort. Stresemann wollte seinen Freund, den Direktor der Darmstädter und Nationalbank Hjalmar Schacht einsetzen, was jedoch plötzlich zu starkem Widerspruch im Finanzministerium führte. Dies brachte Stresemann in Verlegenheit, er war bereit sein Kabinett ohne Finanzminister vorzustellen. Gessler riet ihm jedoch davon ab und schlug ihm Luther, welcher schon lange an dem Projekt der Rentenmark arbeitete, für dieses Amt vor. Dieser nahm das wohl schwerste Ressort, auch ohne langes Nachdenken, sofort an. Ebert stimmte dem zu und so konnte von einem Finanzminister gesprochen werden, der genügend Tatkraft mitbrachte und etwas von seinem Amt verstand.21 In seiner Reichstagsrede brachte Stresemann nun sofort wieder die Dringlichkeit des Ermächtigungsgesetzes zum Ausdruck. „Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir die Ernährung des Volkes und den Bestand des Reiches sicherstellen wollen.“22 Stresemann konnte so die notwendige Zweidrittelmehrheit im Reichstag für dieses Gesetz gewinnen, auch wenn selbst bei der dritten Lesung der Erfolg noch nicht garantiert war. Somit wurde der Weg für den entscheidenden Schritt geebnet. Am 15. Oktober konnte die Verordnung über die Errichtung der Rentenbank erlassen werden, welche dann einen Monat später mit ihrer Wirksamkeit begann. Eine Billion Papiermark sollten dann einer Rentenmark entsprechen. Großindustrielle wie Hugo Stinnes begannen allerdings schon zuvor ihre eigenen Wege zu gehen, sie hintergingen die Autorität der Reichsregierung und führten Unterredungen mit dem alliierten Oberbefehlshaber General Degoutte.23 Die weitere Währungsstabilisierung hatte außerdem nur Aussicht auf Erfolg wenn die Regierung die Notenpresse unter festgesetzten Höchstbeträgen für die Ausgabe von Rentenmarkscheinen sowie die Ausgabe von Krediten kontrollieren könnte. Deshalb war es das Ziel eine schnelle Lösung für die immer noch zu zahlenden Zuwendungen an das Ruhrgebiet zu finden, ohne dabei die sich entwickelnden separatistischen Bewegungen zu unterstützen. Stresemanns Interesse war es, die neue Währung vor einem Wiederaufleben der Inflation zu schützen um später, mit Unterstützung dieser, außenpolitisch zur Lösung des Reparationsproblems wirksam werden zu können. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass es in diesem Zeitraum immer wieder rechts- und linksradikale Bestrebungen im Landesinnern gab.
4. Bestrebungen gegen die Regierung - der Sturz Stresemanns
Schon Anfang Oktober, nachdem die Verhängung des Ausnahmezustandes in Bayern dessen Isolation verdeutlichte, zeigten sich linke Kräfte vor allem in Sachsen und Thüringen, wo Sozialdemokraten und Kommunisten koalierten, um unübersehbar die Volksmassen gegen die Reichsregierung zu mobilisieren. Die Situation verschärfte sich noch einmal deutlich als im besetzten Rheinland neue separatistische Bestrebungen einsetzten. So war dies besonders am 21. Oktober der Fall. Die Separatisten sahen sich vom Reich vernachlässigt, sie schoben die schlechten Bedingungen auf die Regierung, der scheinbar eine neue Währung wichtiger war als das Rheinland. Hinter dieser Ansicht standen auch Politiker wie der Kölner Oberbürgermeister Adenauer oder der Duisburger Oberbürgermeister Jarres, welche sich jetzt mit der Idee einer eigenen Rheinwährung beschäftigten, auch wenn die eigentlichen Bestrebungen oft in ganz unterschiedliche Richtungen gingen.24 Stresemann beschloss deshalb, sich mit führenden Vertretern des Rheingebietes in Hagen (Westfalen) zu treffen um ihnen die schlechte Situation des Reiches zu erörtern und zu beteuern, dass eine Aufgabe des Rheingebietes nicht in Frage käme. An diesem Tag war Stresemann am Ende seiner Kräfte, was sich dann auch in einem Ohnmachtsanfall äußerte. Auch in Thüringen und Sachsen spitzte sich die Situation weiter zu. Die nun teilweise kommunistisch besetzten Regierungen trieben eine stark gegen die Reichsregierung gerichtete Politik. Gessler war als Inhaber der Exekutive im Reich eindeutig für ein Eingreifen gegen die sich auflehnenden Länder, die dort ansässige Reichswehr hatte sein Vertrauen. Stresemann forderte den sächsischen Ministerpräsidenten Zeigner zu einer sofortigen Neuformierung der Landesregierung auf, in Thüringen geschah ähnliches. Währenddessen gab es schon scharfe Proteste gegen dieses Vorgehen von sozialdemokratischer Seite aus, sie sahen das Vorgehen Stresemanns und der Reichswehr als provokativ an.25 Besonders Sollmann, einer der sozialdemokratischen Minister, stellte den Rücktritt seiner Fraktion aus der Regierung unter diesen Umständen in Aussicht. Auch Ebert befürchtete, dass dieses harte Vorgehen gegen die Kommunisten fehl am Platz sei und diese sogar in ihren Ansichten bekräftigen würde. Außerdem bemängelte die sozialdemokratische Fraktion, dass immer noch keine Maßnahmen gegen die bayrische Nebenregierung erkennbar waren. So wurden energische Schritte gegen München gefordert ohne jedoch zu bedenken, dass kaum genügend Machtmittel gegen die bayerische Regierung zur Verfügung standen. Deshalb traten die Sozialdemokraten aus der Regierung zurück und hinterließen nur noch ein Rumpfkabinett, dessen Handlungsfähigkeit dadurch deutlich dezimiert wurde. Stresemann war nun gezwungen die politische Balance in der Regierung nach rechts zu verschieben. Bevor dies geschah konnte sich Stresemann allerdings noch einen langgehegten Wunsch erfüllen, er setzte einen Kabinettsbeschluss durch, welcher dem Kronprinzen Wilhelm die Rückkehr ins Deutsche Reich ermöglichte, der sich im Folgenden, wie gefordert, aus der Politik heraushielt.26 Politisch gesehen blieb klar, „wer mit Bayern nicht in Ordnung kommt, kann Deutschland nicht regieren“.27 In Bayern wurde die Situation währenddessen immer bedrohlicher. Zwar begann die Regierung Kahr leicht einzulenken, da sie über das Ausscheiden der Sozialdemokraten aus der Regierung erfreut war. Dies gab jedoch am 9. November Anlass zum Hitlerputsch. Zunächst war Kahr davon völlig überrascht, glaubte tatsächlich an den neuen Diktator. Als er jedoch wieder klare Gedanken fasste, konnte der Putsch vor allem von der Landespolizei niedergeschlagen werden. So konnte Stresemann sechs Tage vor der endgültigen Einführung der Rentenmark noch einmal aufatmen. Doch es herrschte immer noch Uneinigkeit über die weitere Verfahrensweise mit den besetzten Gebieten. Die Regierung ging davon aus, dass die Zahlungen nur noch zehn Tage nach Einführung der neuen Währung weitergeführt werden könnten. Dies führte dann wieder zu heftigen Zusammenstößen mit den Vertretern der besetzen Länder. So musste die Entscheidung über weitere Zahlungen zunächst ausgesetzt werden. Dann jedoch gab es nochmals neue Hoffnung für Stresemann, er konnte den südafrikanischen Staatsmann Jan Smuts, welcher sehr gute Beziehungen zu Großbritannien hatte, für sich gewinnen. Dieser schaffte es im Folgenden, eine Neuaufrollung des Reparationsproblems durch eine Rede in London auszulösen. Stresemann genoss seinen Sieg, genoss Ovationen bei seiner Rede am 18. November im Zentralvorstand der DVP, er glaubte an die erhebliche Verbesserung der Chancen seines Kabinetts in diesem Zeitraum, doch diesmal hatte er sich getäuscht. Die Sozialdemokraten konnten ihm seine unterschiedliche Vorgehensweise in Sachsen, Thüringen und Bayern nicht verzeihen und reichten ein Misstrauensvotum ein.28 Daraufhin leitete Stresemann vollen Mutes die Stellung der Vertrauensfrage ein, er brachte zum Ausdruck, dass „der Reiz des Ministeramtes (...) sehr gering ist“29. Dieses Vertrauensvotum endete mit 231 zu 156 Stimmen gegen ihn. Ebert belehrte daraufhin seine Parteifreunde: „Was Euch veranlasst, den Kanzler zu stürzen, ist in sechs Wochen vergessen, aber die Folgen Euerer (Sic!) Dummheit werdet ihr noch 10 Jahre lang spüren.“30 Stresemann war daraufhin zutiefst enttäuscht und ist nie wieder in das Kanzleramt zurückgekehrt. Allerdings konnte er seitdem die Außenpolitik bis zu seinem Tode noch entscheidender beeinflussen. Denn fortan war er in jeder Regierung als Außenminister vertreten.
III. Stresemann als Außenminister und „heimlicher Kanzler“
1. Der Dawesplan und die vorübergehende Lösung der Reparationsfrage
Die Reparationsfrage fand weiterhin größte Beachtung, sowohl national als auch international. Die Klärung dieser war unerlässlich um wieder an Stabilität zu gewinnen. Der Reichsregierung kam es zu Gute, dass es „keiner der anderen Großmächte gleichgültig bleiben konnte, was mit dem Reich, das zeitweilig zur Konkursmasse zu werden drohte, geschah“.31 Die Reparationskommission stellte damit den einzig möglichen Ansatzpunkt für die Regierung dar. Eine besondere Rolle kam hier Stresemann als Außenminister zu, da es vor allem wichtig war, die Großmächte auf einen einheitlichen Weg zu bringen. Stresemann hoffte dabei vor allem auf englische Unterstützung. Das größte Problem stellte Frankreich dar, da es einen völlig anderen Kurs anstrebte. Poincaré hielt die Ruhrbesetzung für die einzige Möglichkeit einer Garantie der Reparationszahlungen. Außerdem dachte er an einen endgültigen Untergang der Weimarer Republik, woraus er sich den Erhalt neuer Machtgebiete erhoffte.32 Eine Lösung der Reparationsfrage war auch in Stresemanns Augen nur durch eine gemeinsame Regelung aller Alliierten zu erreichen. Ihm war klar, dass es in nächster Zeit besonders wichtig sein würde, sich möglichst kooperativ zu verhalten und sich den Vorschlägen der Alliierten zu öffnen. Nachdem die Engländer durchaus zum Überdenken der Reparationsfrage bereit waren, sträubten sich die Amerikaner noch dagegen. Sie waren nur bereit, sich Verhandlungen zur Neuregelung anzuschließen, wenn Einigkeit in Europa erkennbar wäre und nicht eine Isolierung Frankreichs die Folge wäre. Die englische Regierung ergriff mehr und mehr die Initiative, sie machte der französischen klar, dass ein Zusammenbruch Deutschlands auch das Ende des Versailler Vertrages bedeuten würde. Auf dem Weg dorthin spielte der 15.11.1923 eine wichtige Rolle, als Baldwin in England plötzlich neue Wahlen ansetzte, die zum ersten Mal der Labour Party unter Ramsay MacDonald mit einem Minderheitenkabinett an die Regierung brachte. Unerwartete Impulse in der englischen Außenpolitik waren die Folge, sie zielten auf eine Entspannungspolitik in Europa und eine erweiterte Zusammenarbeit in Europa.33 Inzwischen hatte die Weimarer Regierung auch ihre Ziele verdeutlicht. Eine „Überprüfung der deutschen Leistungsfähigkeit gemäß Artikel 234 des Versailler Vertrages“ stand im Mittelpunkt.34 Langsam fanden dann die Alliierten auch einen gemeinsamen Nenner, es war jedoch fragwürdig inwiefern eine Untersuchung der Leistungsfähigkeit stattfinden sollte. Frankreich versuchte währenddessen weiterhin das „Ruhrpfand“ auszuquetschen, jedoch nahmen innenpolitische Probleme in Frankreich zu. Die französische Finanzmisere wurde besorgniserregend sodass auch innenpolitisch über neue Wege nachgedacht werden musste. Plötzlich ging es Schlag auf Schlag, die französische Regierung ließ ein Sachverständigengremium bilden. Am 30.11.1923 kam es dann nach weiteren Rangeleien zur Schaffung von zwei Sachverständigenkomitees, von denen das erste unter Vorsitz von Charles G. Dawes besonders entscheidend war.35 Am 14.01.1924 trat das Komitee erstmals zusammen, die Reparationen sollten „entpolitisiert und die europäischen Verhältnisse unter Mitwirkung und deswegen gleichberechtigter Behandlung des Reiches konsolidiert werden.“36 Die Weimarer Republik galt also erstmals wieder als gleichberechtigter Partner in einer Verhandlung. Stresemann erkannte, dass es wichtig war ein Gleichgewicht zwischen europäischen und atlantischen Beziehungen herzustellen. Angestrebt wurde deshalb auch eine Ausgleichspolitik zwischen den Großmächten, eine Reparationsregelung mit der sich alle, auch Deutschland und Frankreich, anfreunden konnten. Der Wille zu Reparationszahlungen war in der Regierung durchaus vorhanden, doch diese mussten erträglich sein und sie durften nicht sofort einsetzen um den Schutz der neuen Währung gewährleisten zu können. Wichtig war Stresemann vor allem, dass eine ganzheitliche Lösung gefunden wurde, die keine Sonderregelungen mit bestimmten Ländern beinhaltete. Stresemann versuchte außerdem Druck auf die Alliierten auszuüben um schnell Ergebnisse erzielen zu können. Es bestand nun noch die Frage, wer die Garantie für reibungslose Reparationszahlungen übernehmen sollte, Frankreich forderte weiterhin das Ruhrgebiet als Pfand. In Verhandlungen mit Frankreich und Belgien versuchte Stresemann zumindest einen „provisorischen modus vivendi“ zu finden.37 Wichtig war für ihn jetzt auch eine innenpolitische Loyalität nach außen darzustellen und außerdem die Rhein- und Ruhrfrage noch einmal zu erörtern, denn die Gläubiger brauchten „Sicherheit vor gefährlichen Experimenten der Franzosen an Rhein und Ruhr.“38 Am 09.04.1924 wurden dann endlich die längst erwarteten Berichte vorgestellt. Das Auswärtige Amt kannte einige Passagen bereits vorher und versuchte schnell den Dawes-Plan zur Grundlage weiteren Handelns zu machen, noch bevor ein komplexes Werk entstehen würde, welches für viele Diskussionen hätte sorgen können. Stresemann forderte also zunächst allgemeine Zustimmung. Die Reparationskommission stimmte zu, doch weiterführende Verhandlungen sollten laut Poincaré ohne Deutschland stattfinden. Der Reichstag zeigte sich jedoch schnell kooperativ und erklärte die Mitarbeit trotz vieler radikaler Gegner, welche mehr und mehr an Stimmen gewannen. Neuwahlen in Frankreich machten den linksgerichteten Herriot zum Ministerpräsidenten, welcher ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu England hatte und einer Annährung zu Deutschland auch nicht im Wege stand.39 Die Entscheidung der Alliierten sollte bei der Londoner Konferenz getroffen werden, die jetzt als Kompromisslösung stattfand, das heißt, teilweise mit und teilweise ohne Deutschland. Stresemann erreichte durch sein Verhandlungsgeschick viele Zugeständnisse. Dazu gehörte auch die angestrebte ganzheitliche Lösung, für die er jedoch in Fragen der Militärkontrolle Entgegenkommen zeigen musste. Diese Lösung war aber in seinen Augen die beste Chance für die besetzten Gebiete. Während der Londoner Konferenz schwand der Unterschied zwischen Sieger und Besiegtem, das europäische Gleichgewicht stärkte sich und die Vereinigten Staaten gewannen an Einfluss.40 Ein Großteil der Verbesserungen entstand nur aus wirtschaftlichen Interessen anderer, doch die Folgen waren ein wichtiger Meilenstein. Die Reparationszahlungen wurden überschaubarer, ein Transferschutz wurde eingeführt und es gab eine amerikanische Startanleihe (Dawesanleihe) über 800 Millionen Mark. Des Weiteren galten neben den Haushaltsmitteln die Reichsbahn und die Industrie als Hauptquellen für die Zahlungen, für die nun ein Reparationsagent zur Überwachung eingesetzt wurde. Bestimmte Zölle und Verbrauchssteuern galten als Pfänder. Stresemann fand also viele seiner Forderungen in den Regelungen wieder, der Wendepunkt in Europa war erreicht und der langsamen Verständigung mit Frankreich, an der Stresemann so viel lag, stand nun nichts mehr im Wege. Erst jetzt erfolgte die Räumung des Ruhrgebietes.
2. Der Locarno-Pakt und die Aufnahme in den Völkerbund
So versuchte das Auswärtige Amt um Stresemann auch weiter in diese Richtung zu steuern. Ziel war es, sich Frankreich mit Hilfe der anderen Großmächte, wie z.B. England, zu nähern. Auch die Kerngedanken möglicher Zielvorstellungen standen schnell fest. „Der Frieden zwischen Frankreich und Deutschland sollte wirksam gesichert, die dauerhafte Verständigung und die Einigung über alle Probleme ohne französische Zwangs- und Kontrollmaßnahmen in die Wege geleitet werden, und zwar (...) auf vertraglicher Grundlage.“41 Für diesen möglichen Vertrag sollten England und Italien als Garantiemächte agieren, dazu gehörten vor allem die Unversehrtheit der deutsch- französischen Grenze und die friedliche Verständigung durch Schiedsverträge.42 Allerdings lehnte die deutsche Seite strikt die Bestätigung der deutsch-polnischen Grenze ab. Stresemann konnte in den folgenden Verhandlungen sein Geschick und seine Erfahrenheit aus den Verhandlungen über den Dawesplan wieder und wieder nutzen. So versuchte er deutsche Forderungen zu erörtern ohne dabei den Platz für französische Angelegenheiten einzuengen. Es galt dann vor allem ein lukratives Angebot zu unterbreiten, welches beiden Seiten zusagte. Grundsätzlich war „die Sicherheitsfrage als die wichtigste Grundfrage der ganzen Streitigkeiten in einer Weise zu lösen, welche die Franzosen befriedigt und für uns annehmbar ist.“43 Wichtig waren außerdem die eigene Initiative und die Geheimhaltung im Inland um den radikalen Elementen der Republik neue Ansatzpunkte für Aufstände zu nehmen, welche die deutsche Loyalität hätten gefährden können. Frankreich forderte inzwischen sogar als Ergänzung den Völkerbundbeitritt Deutschlands. Die bisherigen Gedanken fanden auch breite Anerkennung in Europa und in den USA, als Gegner könnten nur Polen und die Sowjetunion bezeichnet werden, die sich ihrerseits neuen Gefährdungen gegenüber sahen.44 Damit war die Phase der Vorüberlegungen beendet und der Weg zur eigentlichen Konferenz musste nun geebnet werden auch wenn jetzt die ersten Stimmen der Gegner, wie die der DNVP, laut wurden. Beunruhigend dabei wirkte auch, dass sich die Argumente der Gegner mehr und mehr in den Köpfen festsetzen. Zu diesen Argumenten gehörte zum Beispiel, dass der Versailler Vertrag jetzt nicht nur akzeptiert, sondern auch mit besonderen Garantien verstärkt wurde und das als Vorleistung, auf die keine Gegenleistung zu erwarten wäre.45 Besonders einschneidend in der Entwicklung war auch der Tod Eberts, wodurch Hindenburg am 26.04.1925 das Amt des Reichspräsidenten übernahm. Das reichte nämlich als Anlass für eine stärkere Unterstützung durch die Alliierten, welche in Hindenburg eine Gefahr für die Demokratie und die europäische Sicherheit sahen. Stresemann setzte sich inzwischen mehr und mehr dafür ein, dass auch industrielle Vereinbarungen an Bedeutung gewannen. Außerdem kam es zur ersten ernstzunehmenden Stellungnahme Frankreichs, die eine Akzeptanz nur in Verbindung mit dem Völkerbundbeitritt in Aussicht stellte. Trotzdem kam man einer Konferenz immer näher indem man beispielsweise ein verbessertes Schiedssystem zu Polen entwickelte.46 Tatsächlich fand die Locarnokonferenz nun seit dem 05.10.1925 statt. Mitgewirkt haben Deutschland, Frankreich, England, Belgien, Polen und die Tschechoslowakei. Als offene Fragen waren immer noch der Umgang mit Polen und die deutsche Entwaffnung zu behandeln. Doch sofort nach dem Beginn waren positive Auswirkungen erkennbar, dazu gehörte auch der Anfang der Räumung des Rheinlandes. Dies bedeutete also deutliche Entspannungen im Inland auch trotz der Gegner dieses bevorstehenden Sicherheitsabkommens. „Stresemann hielt auch sonst mit den Forderungen für die Zukunft nicht hinterm Berge: die Verminderung der Besatzungsgruppen, die vorzeitige Räumung auch der restlichen Gebiete, die Lösung der Saarfrage,(...)“.47 Die Konferenz verlief dabei sehr ruhig und durch die Sachlichkeit auch ohne größere Probleme. Erfreulich war außerdem, dass eine Zusammenarbeit und Kompromissbereitschaft zwischen den Großmächten erkennbar war, auch wenn dies für Deutschland nur durch die Anerkennung der Gegebenheiten des Versailler Vertrages möglich war.48 Stresemann schien sich mehr und mehr der westeuropäischen Politik anzunähern und strebte gemeinschaftliche Lösungen an. Hierbei war ihm klar, dass die Vorteile der Konferenz nur umsetzbar waren wenn die Gedanken auch tatsächlich mitgetragen werden würden.49 Das Schlussprotokoll vom 16.10.1925 bestand dann aus dem Rheinpakt, den Schiedsverträgen mit Polen, Tschechien, Frankreich und Belgien sowie einem Schreiben der Mächte zwecks der Entmilitarisierung des Rheinlandes. Gleichzeitig entschloss sich die Regierung zum Völkerbundsbeitritt, was Gegnern ihre Entscheidung erschwerte, da sie jetzt nicht nur gegen Locarno, sondern gegen den Völkerbund entscheiden würden. So kam es am 27.11.1925 zur Ratifizierung durch den Reichstag und am 01.12.1925 zur Unterzeichnung des Locarnoabkommens in London.50 In Bezug auf die Streitfragen ist zu sagen, dass durchaus günstige Lösungen gefunden wurden. So wollte zwar Frankreich nicht als Schiedsrichter zwischen Polen und Deutschland wirken, beschloss aber bestimmte Garantieverträge abzuschließen.51 Außerdem kam es zu einem Kompromiss bezüglich der Entmilitarisierung des Rheinlandes, welche im Artikel 16 des Versailler Vertrages festgelegt war. Und zwar durch die „Anlage F“, die bereits erwähnten Schreiben der einzelnen Länder an die Reichsregierung. Die Verfasser konnten dabei nicht im Namen des Völkerbundes sprechen, gaben aber eine Interpretation, nach der „jedes Bundesmitglied loyal mitarbeiten und der Satzung Achtung verschaffen müsse in einem Maße, dass mit seiner militärischen Lage verträglich ist und das seiner geographischen Lage Rechnung trägt.“52 Stresemann konnte viele seiner Ziele endgültig verwirklichen, vor allem die Annäherung zu Frankreich, welche sich vor allem auf die Verhandlungen zwischen Stresemann und seinem Kollegen, dem französischen Außenminister Aristide Briand, stützten. Für diese Verständigung, welche, wie schon beschreiben, im Völkerbundbeitritt Deutschlands endete, erheilten beide Politiker den Friedensnobelpreis. „Mit diesen Verträgen schien ein neues Europa, das Ende von Versailles in Sicht.“53 Weiterhin ist bemerkenswert, dass Stresemann bis zu seinem Tod am 03.10.1929 diesen Kurs weiter beibehielt, er dadurch eine Stärkung des Verhältnisses zur Sowjetunion durch den „Berliner Vertag“ und kurz vor seinem Tod noch eine erneute Verbesserung der Reparationszahlungen durch den „Young-Plan“ einleitete sowie entscheidend zur Entwicklung des „Briand-Kellogg-Paktes“, eines Vertrages, der den Krieg als Mittel der Politik ächtete, beitrug. Seine primären und größten Ziele hatte er jedoch schon mit der Unterzeichnung des Locarno-Paktes erreicht.
IV. Schluss
Abschließend möchte ich zum Ausdruck bringen, dass das hier dargestellte Thema sehr komplex ist und eine Entscheidungsfindung zur Bedeutung Stresemanns sehr schwer macht. Trotzdem werde ich jetzt versuchen meinen Schwerpunkt in der, in der Einleitung gestellten Frage, zu setzen. Während der Themenbearbeitung ist mir dahingehend einiges klar geworden. Gustav Stresemann ist durchaus als ein „Stützpfeiler der Weimarer Republik“ zu sehen. Sein diplomatisches Geschick konnte die Republik lange Zeit vor einem politischen Untergang schützen. Die Überwindung der Inflation ist dabei, so denke ich, schon Beleg genug. Nicht zu vergessen ist allerdings, dass er diese Erfolge nur durch die Unterstützung zahlreicher anderer Helfer erreichen konnte. Zu nennen ist zum Beispiel Luther, der sehr viel zur Einführung der Rentenmark beitrug. Außerdem muss ich an dieser Stelle sagen, dass kein deutscher Politiker seit Ende des Ersten Weltkrieges mehr auf so große Unterstützung Alliierter, insbesondere der Engländer, bauen konnte, was ihm die Arbeit sehr erleichterte. Zu erwähnen ist außerdem seine politische Zielsetzung. Stresemann machte einen einschneidenden Wandel vom Monarchisten zum Vernunftrepublikaner durch. Scheinbar tat er dies um dem allgemeinen Volkswillen gerecht zu werden und um möglichst schnell zum Erfolg zu gelangen. Hinter dieser Fassade steht allerdings der Großmachtgedanke Stresemanns, den er bereits während des Ersten Weltkrieges zeigte, in welchem er die Kriegshandlungen mit aller Kraft unterstützte. Er versuchte Deutschlands Großmachtstellung, so schnell wie möglich, wiederherzustellen. Zurück zur Großmacht mit friedlichen Mitteln war also sein Plan. Ich möchte diese Politik jedoch nicht in den Schatten rücken, denn bis zu seinem Tod blieb seine Weste rein und seine Verdienste sind unverkennbar auch wenn sie durch zahlreiche Unterstützung erst ermöglicht werden konnten. Als Stresemann starb, verlor Deutschland einen großen Politiker und dies sollte sich im weiteren Verlauf auch bald zeigen, denn die Stabilität der Weimarer Republik brach nach und nach zusammen. Dieser Zusammenbruch begünstigte schließlich die Machtübernahme Adolf Hitlers. „Es ist ein wunderbares geschichtliches Schauspiel, dass dieser einsame Mann, der weder die bewaffnete Macht, noch eine zuverlässige Waffenorganisation hinter sich hatte, dennoch der Entwicklung Deutschlands seinen Stempel aufdrücken konnte und im wesentlichen unerschüttert bis zu seinem Tode die Macht behauptete.“54
V. Anmerkungsverzeichnis
VI. Literaturverzeichnis
Eschenburg, Theodor; Frank-Planitz, Ulrich: Gustav Stresemann. Eine Bildbiographie, Stuttgart 1978
Franz, Günter: Staatsverfassungen, 2. erweiterte und ergänzte Auflage, München 1964
Hirsch, Felix: Stresemann. Ein Lebensbild, Göttingen, Frankfurt, Zürich 1978
Körber, Andreas: Gustav Stresemann als Europäer, Patriot, Wegbereiter und potentieller Verhinderer Hitlers, Hamburg 1999
Krüger, Peter: Die Außenpolitik der Republik von Weimar, 2. Auflage, Darmstadt 1993
Mann, Golo: Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1958
Möller, Horst: Deutsche Geschichte der neuesten Zeit. Weimar. Die unvollendete Demokratie, 6. Auflage, Berlin, Nördlingen 1997
Müller, Hans Jürgen: Auswärtige Pressepolitik und Propaganda zwischen Ruhrkampf und Locarno (1923 - 1925), Eine Untersuchung über die Rolle der Öffentlichkeit in der Außenpolitik Stresemanns, Tübingen 1990
Pohl, Karl Heinrich: Politiker und Bürger. Gustav Stresemann und seine Zeit, Göttingen 2002
Schulze, Hagen: Weimar. Deutschland 1917 - 1933, Berlin 1982 (Die deutschen und ihre Nation Bd. 4)
Turner JR, Henry Ashby: Stresemann - Republikaner aus Vernunft, Berlin, Frankfurt am Main 1968
Ullrich, Günter: Ein Zeichen der Versöhnung im Geiste von Locarno. Gustav Stresemann 1926, Lünen 2001
Winkler, Heinrich August: Weimar 1918 - 1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, München 1993
[...]
1 Mann, Golo: Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1958, S. 579-589
2 Pohl, Karl Heinrich: Politiker und Bürger. Gustav Stresemann und seine Zeit, Göttingen 2002 S. 11.
3 Schulze, Hagen: Weimar. Deutschland 1917 - 1933, Berlin 1982 (Die deutschen und ihre Nation Bd. 4), S. 256.
4 Zitiert nach Hirsch, Felix: Stresemann. Ein Lebensbild, Göttingen, Frankfurt, Zürich 1978, S. 143.
5 Schulze, Weimar, S.254-255.
6 Zitiert nach: Eschenburg, Theodor; Frank-Planitz, Ulrich: Gustav Stresemann: Eine Bildbiographie, Stuttgart 1978, S. 61.
7 Winkler, Heinrich August: Weimar 1918 - 1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, München 1993, S. 204-205.
8 Hirsch, Stresemann, S. 145.
9 Schulze, Weimar, S.259-260.
10 Hirsch, Stresemann, S.151-152.
11 Schulze, Weimar, S.268.
12 Eschenburg, Gustav Stresemann, S.65.
13 Schulze, Weimar, S.259-260.
14 Zitiert nach Hirsch, Stresemann, S.152-153.
15 Winkler, Weimar 1918 - 1933, S.211.
16 Zitiert nach Hirsch, Stresemann, S.152-153.
17 Eschenburg, Gustav Stresemann, S.67-68.
18 Winkler, Weimar 1918 - 1933, S.218-221.
19 Eschenburg, Gustav Stresemann, S.68.
20 Zitiert nach Hirsch, Stresemann, S.154.
21 Hirsch, Stresemann, S.154-155.
22 Zitiert nach Hirsch, Stresemann, S.155.
23 Hirsch, Stresemann, S.156.
24 Hirsch, Stresemann, S.156 -157.
25 Winkler, Weimar 1918 - 1933, 227-228.
26 Hirsch, Stresemann, S.158.
27 Zitiert nach Hirsch, Stresemann, S.159.
28 Winkler, Weimar 1918 - 1933, S.239.
29 Zitiert nach: Hirsch, Stresemann, S.164.
30 Zitiert nach Hirsch, Stresemann, S.164.
31 Krüger, Peter: Die Außenpolitik der Republik von Weimar, 2. Auflage, Darmstadt 1993, S. 219.
32 Krüger, Die Außenpolitik, S.219-220.
33 Winkler, Weimar 1918 - 1933, S.260.
34 Krüger, Die Außenpolitik, S.224.
35 Schulze, Weimar, S. 273-274.
36 Krüger, Die Außenpolitik, S.230.
37 Krüger, Die Außenpolitik, S.231.
38 Krüger, Die Außenpolitik, S.238.
39 Winkler, Weimar 1918 - 1933, S.260.
40 Schulze, Weimar, S.276-279.
41 Krüger, Die Außenpolitik, S.273.
42 Schulze, Weimar, S.275-278.
43 Krüger, Die Außenpolitik, S.274.
44 Krüger, Die Außenpolitik, S.277-284.
45 Winkler, Weimar 1918 - 1933, 308-309.
46 Krüger, Die Außenpolitik, S.284-295.
47 Krüger, Die Außenpolitik, S.296.
48 Krüger, Die Außenpolitik, S.296.
49 Winkler, Weimar 1918 - 1933, S.307.
50 Winkler, Weimar 1918 - 1933, S.310.
51 Krüger, Die Außenpolitik, S.300.
52 Krüger, Die Außenpolitik, S.300.
53 Schulze, Weimar, S.279.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit „Gustav Stresemann - Stützpfeiler der Weimarer Republik?“?
Die Arbeit untersucht Gustav Stresemanns Rolle als Politiker in der Weimarer Republik, insbesondere seine Zeit als Reichskanzler im Krisenjahr 1923 und später als Außenminister. Sie analysiert seine Beiträge zur Stabilisierung der Währung, zur Lösung der Reparationsfrage und zur Außenpolitik Deutschlands.
Was waren die Schwerpunkte von Stresemanns Politik als Reichskanzler im Jahr 1923?
Die Schwerpunkte lagen auf der Beendigung des passiven Widerstandes im Ruhrgebiet, der Stabilisierung der Währung durch die Einführung der Rentenmark und der Bewältigung innenpolitischer Krisen, wie z.B. separatistischer Bewegungen und Konflikte mit Bayern.
Was war das „Wunder der Rentenmark“?
Das „Wunder der Rentenmark“ bezieht sich auf die erfolgreiche Währungsstabilisierung durch die Einführung der Rentenmark im November 1923, die die Hyperinflation beendete und eine Grundlage für wirtschaftliche Erholung schuf.
Welche Rolle spielte Stresemann als Außenminister?
Als Außenminister spielte Stresemann eine entscheidende Rolle bei der Lösung der Reparationsfrage durch den Dawesplan, der Verbesserung der Beziehungen zu Frankreich durch den Locarno-Pakt und der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund.
Was war der Dawesplan?
Der Dawesplan war ein Plan zur Neuregelung der deutschen Reparationszahlungen, der 1924 verabschiedet wurde. Er sah eine Reduzierung der jährlichen Zahlungen und die Gewährung von Krediten vor, um die deutsche Wirtschaft zu stabilisieren.
Was war der Locarno-Pakt und welche Bedeutung hatte er?
Der Locarno-Pakt war eine Reihe von Verträgen, die 1925 in Locarno geschlossen wurden. Er garantierte die deutsch-französische Grenze und sah Schiedsgerichtsverfahren zur Beilegung von Konflikten vor. Der Pakt trug zur Entspannung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich bei und ebnete den Weg für die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund.
Welche Rolle spielte die Locarnokonferenz?
Die Locarnokonferenz war eine Konferenz im Oktober 1925, auf der die Locarno-Verträge ausgehandelt wurden. Sie markierte einen Wendepunkt in der europäischen Politik und trug zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Deutschland und den alliierten Mächten bei.
Was war Stresemanns Verhältnis zu Frankreich?
Stresemann strebte eine Aussöhnung mit Frankreich an, um die Reparationsfrage zu lösen und die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verbessern. Er arbeitete eng mit dem französischen Außenminister Aristide Briand zusammen, was zur Unterzeichnung des Locarno-Paktes und der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund führte.
Wie wird Stresemann in der deutschen Geschichte bewertet?
Stresemann wird im Allgemeinen als einer der bedeutendsten Politiker der Weimarer Republik angesehen. Er trug maßgeblich zur Stabilisierung der Republik bei und verbesserte die Beziehungen zu den alliierten Mächten. Allerdings wird seine Politik auch kritisch gesehen, da sie auf einerRevision des Versailler Vertrages abzielte und somit nationalistische Tendenzen beinhaltete.
Was waren Stresemanns Ziele?
Zu seinen Zielen gehörten die Stabilisierung der deutschen Wirtschaft, die Beendigung der Reparationszahlungen, dieRevision des Versailler Vertrages und die Wiederherstellung der deutschen Großmachtstellung auf friedlichem Wege.
Welche Bücher wurden für die Analyse verwendet?
Es wurden eine Vielzahl von Büchern benutzt, die wichtigsten waren: „Stresemann. Ein Lebensbild“ von Felix Hirsch, „Die Außenpolitik der Republik von Weimar“ von Peter Krüger, „Weimar 1918 bis 1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie“ von Heinrich August Winkler sowie „Weimar, Deutschland von 1917-1933“ von Hagen Schulze.
- Quote paper
- Henri Schmidt (Author), 2003, Die Ära Stresemann - Stützpfeiler der Weimarer Republik ?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108701