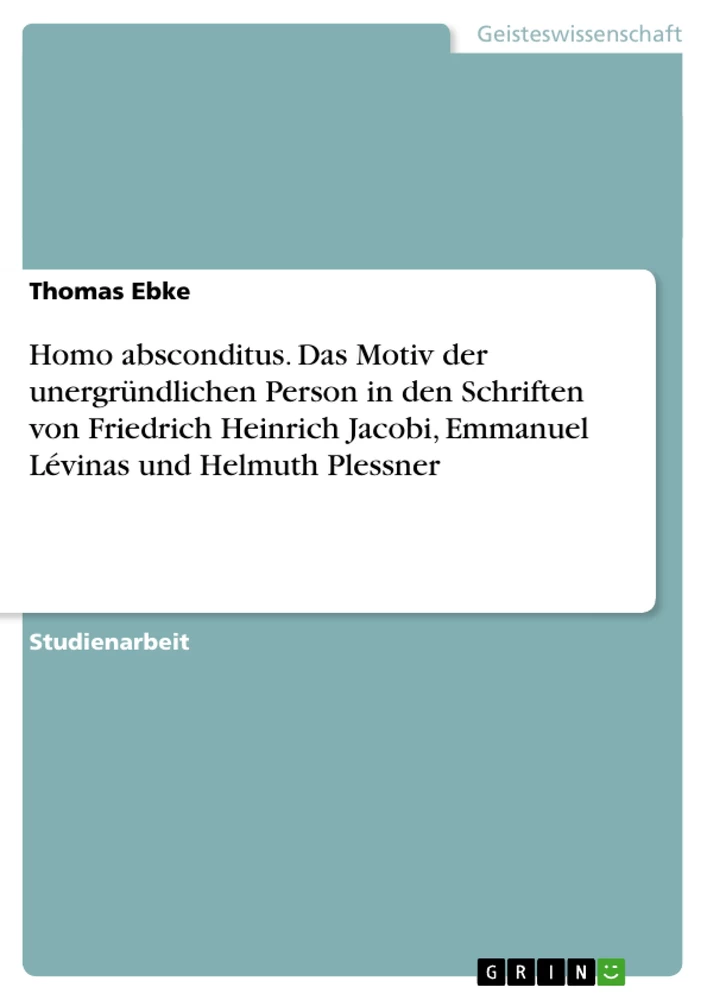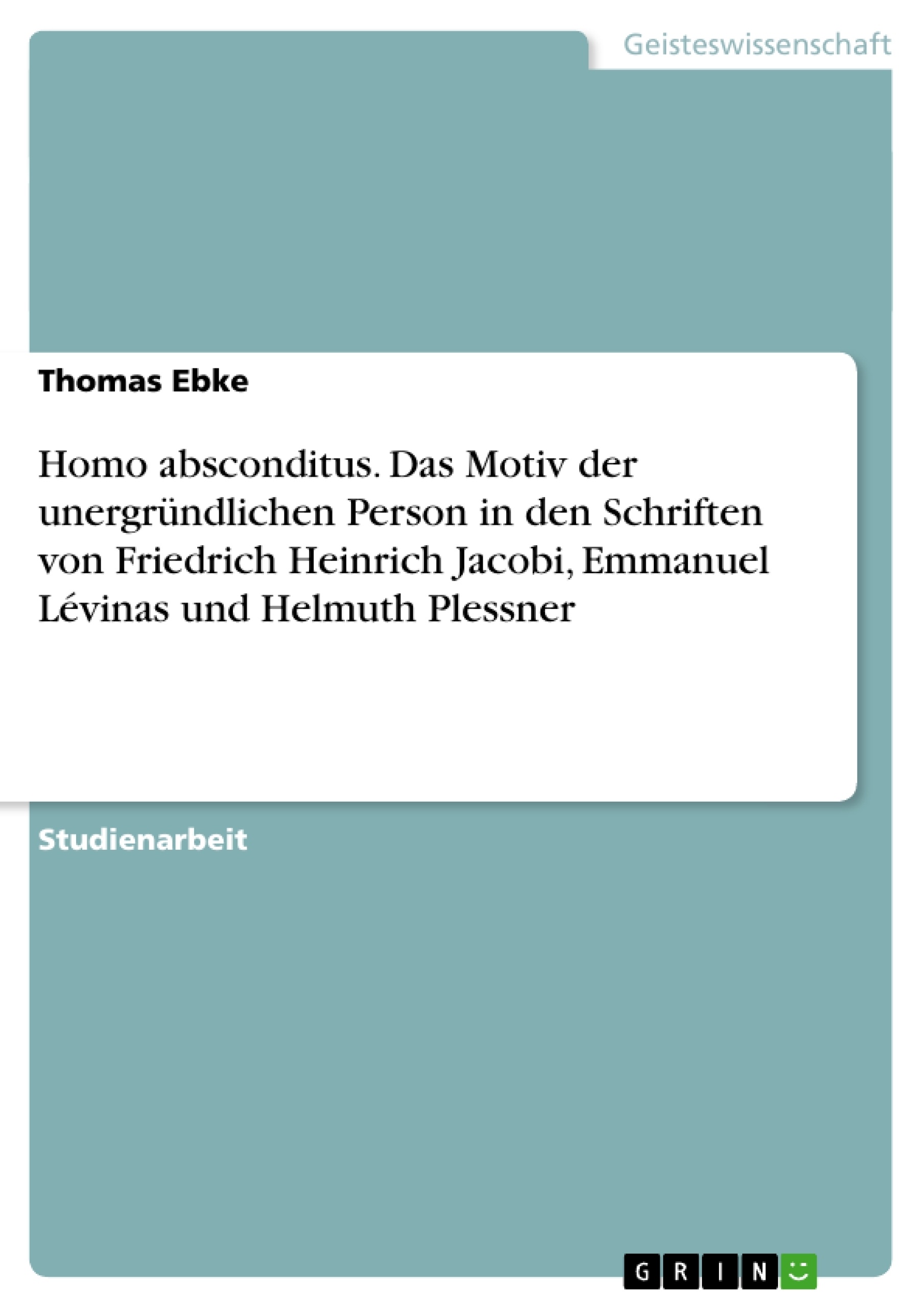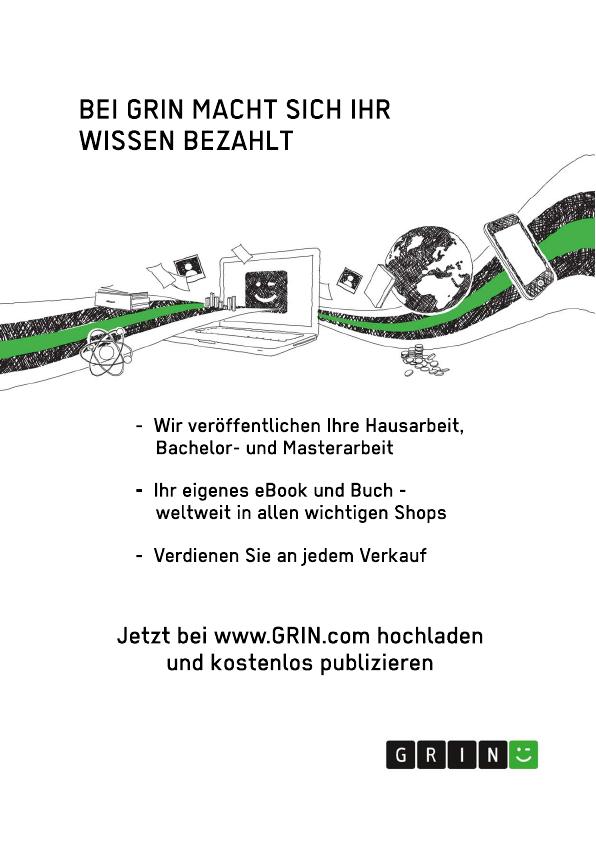Mit Fug und Recht kann man sagen, dass kein Philosoph des 20. Jahrhunderts so eindringlich die Schwierigkeit der Andersheit der Anderen und dem Problem, dieser absoluten Andersheit Rechnung zu tragen,aufzeigt hat wie Emmanuel Lévinas (1906-1995). Das Zusammendenken von Personbegriff und Alterität ist eine gleichsam aporetische Aufgabe der Philosophie, die bei Lévinas durch die Konzeption der Ethik als prima philosophia angegangen wird. Die Untersuchung zieht eine ungewohnte Genealogie für Lévinas Ansatz aus: Von Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) bis zu Helmuth Plessner (1892-1985) erstreckt sich eine gedankliche Linie, die daran gearbeitet haben, die Alterität des Anderen im Sinne einer Unergründlichkeitsrelation zu denken. Die Zusammenführung dieser drei Autoren zu einem Dialog um ein gemeinsames Problem versucht, bislang unverbundene Positionen aufeinander zu beziehen.
Inhaltsverzeichnis
O. Nullpunkt. Das philosophische Problemfeld der »Person«.
I. das »Unauflösliche«, »Unmittelbare«, »Einfache«. Friedrich Heinrich Jacobis »Salto mortale« im Kern einer Philosophie des Dialogs.
ii. Die absolute Alterität des Anderen bei Emmanuel Lévinas.
ii.1 Der Übergang von Ontologie zu Ethik bei Emmanuel Lévinas im Licht der Rosenzweig-Rezeption.
ii.2 »Antlitz« und »Spur«. Konstruktionen des absolut Anderen in den ethischen und theologischen Schriften von Lévinas.
iii. »Von sich fort und über sich hinaus«. Helmuth Plessners Modell der Exzentrierung der Person.
iii.1 Plessner in der Tradition der Phänomenologie Husserls.
iii.2 Das »Antlitz« und die Mitwelt. Über Plessners Herleitung der Alterität in den Stufen des Organischen .
iv. Abschluss. Die Grenzen der Person und das Denken des Undenkbaren bei Jacobi, Lévinas und Plessner.
Literaturverzeichnis
0.Nullpunkt. Das philosophische Problemfeld der »Person«.
Wie kaum ein zweiter Begriff hat der Begriff der »Person« philosophische Bemühungen um Grenzbestimmungen und trennscharfe Definitionen auf sich gezogen. Nicht nur im 20. Jahrhundert haben immer neue Publikationsschübe Zeugnis für das periodische analytische Interesse an einer Problemgeschichte gegeben, in der so heterogene Begriffe wie »Person«, »Persönlichkeit«, »Individuum«, »Selbstbewusstsein, »Leiblichkeit«, »Mensch«, »Humanität« und »Identität« einander kreuzen. Einerseits scheinen all diese »Probleme« in einer komplexen gemeinsamen Semantik aufeinander zu verweisen, andererseits markieren sie spezifische Differenzen.
Es scheint unstatthaft zu sein, schlicht jeden Menschen essenzialistisch als »Person« zu qualifizieren, denn demgegenüber scheint in diesen Begriff noch im besonderen Maße die Annahme eines Intelligiblen herüberzuwirken, das Kant in der Inanspruchnahme der Freiheit als Selbstzweck spezifizierte[1].
Gleichermaßen hat sich vor allem gegen die klassische Philosophie in Deutschland die These abgezeichnet, die Bestimmung der Person sei nicht ablösbar von der Körperleiblichkeit eines natürlichen Wesens. Nur in der irreduziblen Sphäre eines natürlichen, vorreflexiven Seins könne sich die »einmalige Besonderheit oder Herausgehobenheit«[2], also die Individualität des Menschen als Person, erschließen.
Traditionell steht der Begriff der »Person« daher im Kreuzungspunkt einer doppelten Diskussion. Auf der einen Seite wird in ihm jene Spannung zwischen den Erfahrungswissenschaften gegenüber einer angewandten philosophischen Ethik handgreiflich, deren volle Brisanz in medizinethischen, reproduktionstechnologischen oder verfassungshistorischen Debatten längst zum Tragen gekommen ist. Auf der anderen Seite konkretisiert sich im Begriff der Person ein immanentes Methodenproblem der Philosophie. Gelten nämlich Vernunft oder Einheit des Selbstbewusstseins im Sinne der idealistischen Philosophie gleichsam als Wasserzeichen für personale Identität, so bleibt ungewiss, ob nicht die fremde Person im Modus einer absoluten Alterität und Unersetzlichkeit verharrt, an den subjektives Selbstbewusstsein und Vernunft gerade nicht heranreichen.
Es ist bemerkenswert, dass sich in der Spannung zu einer Bewusstseinsmetaphysik, die die Genese des Ich aus der Instanz des Selbstbewusstseins rekonstruiert und dieser logisch nachordnet, ein Feld eröffnet hat, das sich durch »Metaphysikresistenz«[3] auszeichnet.
Immer wieder haben Philosophen gegen die holistischen Begründungssysteme etwa des Deutschen Idealismus auf ein gleichsam privates, der Intersubjektivität vorauslaufendes Verhältnis zum anderen Menschen gezielt. Ist damit aber eine Struktur beschrieben, die nicht in der Selbstobjektivierung eines Absoluten aufzulösen ist, so kristallisiert sich die Relation zum Anderen als Person um ein Element des Unbestimmten und Unergründlichen, um einen Riss philosophischer Kausalmodelle und um eine Transzendenz, die zugleich Philosophie und Theologie miteinander vermittelt.
Im Folgenden sollen drei metaphysikkritische Ansätze synoptisch verfolgt werden, die auf disparate Weise jenes Nicht-Wissen aufgerufen haben, das im dialogischen Verhältnis von Ich und Du hervortritt und einen numinosen Ursprung, etwa als »unvordenkliche Schöpfungsspur«[4] indiziert. So sehr diese drei Ansätze nun durchgehend von einem Desiderat innerhalb systematischer Begründungen getragen sind, so sehr leisten sie allesamt einen je spezifischen Primatwechsel, den es ebenfalls nachzuzeichnen gilt. Entlang der Positionen von Friedrich Heinrich Jacobi, Emmanuel Lévinas und Helmuth Plessner sollen zugleich mögliche Linien einer vor- oder nichtmetaphysischen Philosophie der Person kenntlich gemacht werden.
I. Das »Unauflösliche«, »Unmittelbare«, »Einfache«. Friedrich Heinrich Jacobis »salto mortale« im Kern einer Philosophie des Dialogs.
1807 formuliert Hegel in der Phänomenologie des Geistes den kardinalen Gedanken seiner Praktischen Philosophie:
»Jedes ist dem andern die Mitte, durch welche jedes sich mit sich selbst vermittelt und zusammenschließt, und jedes sich und dem andern unmittelbares für sich seiendes Wesen, welches zugleich nur durch diese Vermittlung so für sich ist. Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend.«[5]
Obwohl (oder gerade weil) Hegel eine Dialektik vor Augen hatte, die sich in allen sinnlich-realen Verhältnissen der Individuen ausdifferenzieren sollte, dachte er diese berühmt gewordene Relation der Anerkennung notwendig als ein Strukturverhältnis. Zuletzt bleibt »der Andere« im Zuge der Selbstvergewisserung eines abstrakten Selbstbewusstseins formales Subjekt des positiven Rechts, Glied und Grenze einer Reflexion, in der sich ein abstraktes und transpersonales Selbstbewusstsein sein eigenes Werden transparent macht. Tatsächlich leistet die »Person« in der Terminologie Hegels auch schon den Übertritt aus der individuellen Bestimmtheit, die im Subjektbegriff noch aufbewahrt ist, in die abstrakte Dimension des Rechts[6].
Doch schon Hegels Zeitgenossen erkannten die Hybris der Argumentation: Muss nicht ein Geist, der alle Vollzüge und jeden Erfahrungsbereich des Lebens als Verwirklichungsweise seiner selbst begreift, vor der »irreduzibel konkreten Individualität«[7] von Individuen kapitulieren? Es war Friedrich Heinrich Jacobi, der (wie Birgit Sandkaulen gezeigt hat) auf der Unhintergehbarkeit individuellen Seins beharrte und es gegen Hegels Universalisierungsanspruch verteidigte.
In seinen Briefen Über die Lehre des Spinoza umreißt Jacobi eine philosophische Propädeutik, die immer wieder mit seiner Kritik am Szientismus Kant zusammenfließt:
»Nach meinem Urtheil ist das größeste Verdienst des Forschers, Daseyn zu enthüllen und zu offenbaren. Erklärung ist ihm Mittel, Weg zum Ziel, nächster – niemals letzter Zweck. Sein letzter Zweck ist, was sich nicht erklären läßt: das Unauflösliche, Unmittelbare, Einfache... Ungemessene Erklärungssucht lässt uns so hitzig das Gemeinschaftliche suchen, dass wir darüber des Verschiedenen nicht achten; wir wollen immer nur verknüpfen, da wir doch oft mit ungleich größerem Vortheile trennten...«[8]
Es kann übrigens nicht überraschen, wenn Interpreten dieses Zitats immer wieder die Brücke zu Heideggers Existenzialontologie schlagen[9], die das »Unauflösliche, Unmittelbare, Einfache« als privilegierten Objektbereich einer philosophischen Hermeneutik herausarbeitet[10]. Gegenüber der »ungemessenen Erklärungssucht«, die so ubiquitär die diversen Systementwürfe im Umkreis von Hegel, Fichte und Schelling durchzieht, erkennt Jacobi hier jedenfalls den Ankerpunkt der Philosophie in einer eminenten Figur des Nicht-Wissens. Wenn man so will rührt Jacobi an ein Element der Unverfügbarkeit, an eine Diskontinuität verstandesgemäßer positivistischer Kausalitäten, oder ganz allgemein an eine immer schon gesetzte Grenze, an der die Verstandes – und die Vernunftsphäre sich voneinander lösen. »Fortschreitend in identischen Sätzen« durchmisst der Verstand einen infiniten Zirkel von Erweis und Erwiesenem, er perpetuiert eine Logik, in der sich zwar natürliche Phänomene, nicht aber der Existenzgrund der Natur schlechthin decken lassen. Den an Kant geschulten Strukturzusammenhang von Verstand und Vernunft hat Jacobi deutlicher noch in einem Brief an Schlosser festgehalten:
»Vergißt sie (die Vernunft, Anm. d. Verf.). nicht ihre nothwendige Abhängigkeit, so lässt sie dem Menschenverstande seine Ehre, und macht an keine von ihm unabhängigen Fortschritte Anspruch.«[11]
Die Selbsteinschränkung der Vernunft begreift Jacobi nicht wie Kant als therapeutisches Programm, das den Vernunftgebrauch von der Erkenntnis letzter Dinge auf Erscheinungserkenntnis umlegt. Sein Argument reicht tiefer: Vernunft wird erst dort in ihr volles Recht eingesetzt, wo ein Wissen ohne Beweise oder, aus der Optik des Verstands, ein aporetisches Nichtwissen den Verstandessynthesen vorausläuft. Nur der Sprung in den Glauben hält der Anerkenntnis einer der Vernunft gegenwärtigen Offenbarung stand – und dieser Sprung ist von Jacobi selbst als so kühn wahrgenommen worden, dass er ihn als einen salto mortale qualifizierte.
Jacobi hat sich jene merkwürdigen Aporie seines Wissensbegriffs, der auf das Unbeweisbare abgestellt ist, durchaus klar gemacht[12]. Mehr noch: Auch er hat, wie Rosenzweig, Buber, und später Lévinas, an den Anfang allen Denkens die Dialogizität eines Ich-Du-Verhältnisses gesetzt. In der Zwiesprache mit dem Ich artikuliert sich ein deus absconditus, der ebenso unergründlich wie anthropomorph verfasst ist und als höchste Intelligenz »auch den höchsten Grad der Persönlichkeit«[13] realisiert.
Tatsächlich steht im Zentrum der Religionsphilosophie Jacobis eine Konstruktion, die Vernunft, Person und Freiheit verklammert und auf die Erkenntnis eines gleichermaßen »absolut Unbestimmten« wie ansprechbaren Gottes zurückdatiert:
»Nothwendig anthropomorphisiert darum der Mensch. […] Am Anfang war das Wort. Wo dies inwendige – das sich selbst Gleiche aussprechende – Wort ertönt, da ist Vernunft, da ist Person, da ist Freiheit. Vernunft ohne Persönlichkeit ist Unding, […]«[14]
Der Anthropomorphismus, der »nothwendig« die Konstituierung der Person aus der Isomorphie mit einem personalen Gott als speist, läuft für Jacobi zugleich im »Logos« ab, also in jüdisch-christlicher Tradition im Ur-Wort und der Ur-Szene des Schöpfungsgeschehens.
Kurt Christ hat herausgestrichen, dass Jacobi die Homologie des Ich-Gott-Verhältnisses zum Ich-Du-Verhältnis, durch die Gott sich individualisiert und personalisiert, sogar als Kernthema des Streits mit Mendelssohn empfand[15].
Zumindest vorläufig ergibt sich aus diesen Textstellen die Gedankenbewegung, mit der Jacobi im Personenbegriff Mensch und Gott, Natur und Offenbarung schließlich synchronisiert. Person sein soll derjenige Mensch, der eingedenk des dialogischen Sprechens zu Gott die eigene Isomorphie mit dem Göttlichen erkennt.
Durchscheinend wird im menschlichen Dialogverhältnis zu Gott Jacobis »Neue Metaphysik« und eine Fundamentalontologie avant la lettre, welche »die durch kein Denken zu ersetzende Rezeptivität«[16] im Dasein mit dem Begriff des »Glaubens« identifiziert. Eben dieses Zurücktreten aus der Metaphysik in den Glauben mutet in der zeitgenössischen Szene Jacobis so singulär an, dass er seinen Vorschlag als salto mortale qualifizierte. So sehr Jacobi damit aber gegen die Metaphysik vorstieß, so sehr steht sein auf die Freiheit der Person im Glauben abzielender salto mortale unter der Wirkung Spinozas, der die Freiheit des Menschen im Übergang von der passio zur actio des Geistes ansprach, die einzig die Immanenz Gottes stiften kann[17].
In einem zweiten Schritt soll nun gezeigt werden, wie sich das dialogische Modell Jacobis fortgesetzt hat in eine Tradition des 20. Jahrhunderts, und zwar bis in die Schriften Emmanuel Lévinas´ hinein. Herstammend aus der phänomenologischen Schule Husserls, entfaltet Lévinas ein Ich-Du-Verhältnis, das nicht länger nur die Zwiesprache zu Gott umspannt, sondern gründend ist für ein ethisches Verantworten gegenüber dem anderen Menschen als Person.
II. Die absolute Alterität des Anderen bei Emmanuel Lévinas.
II.1 Der Übergang von Ontologie zu Ethik bei Emmanuel Lévinas im Licht der Rosenzweig-Rezeption.
Will man die tragenden Gedankenfiguren verstehen, denen Lévinas in seinen Schriften stets Ausdruck verliehen hat, so empfiehlt sich zunächst eine Rekapitulation aus Husserls Cartesianischen Meditationen.
In seinen späten phänomenologischen Analysen stößt Husserl zu einem Verständnis von Intersubjektivität vor, das es gestattet, die Welt als auch aus dem Bewusstsein des Anderen generiert zu erkennen.
Darin folgt Husserl – Hegel nicht unähnlich – einem Zuschreibungsverhältnis. Es gibt Husserl zufolge zunächst ein Bewusstsein vom eigenen Leib als kinästhetischer Einheit, und es ist dieses Leibbewusstsein, das wir dem Fremdbewusstsein »appräsentieren«, also diesem zuschreiben, ohne es im intentionalen Vollzug zugleich wahrzunehmen zu können.
Auf der Stufe der Intersubjektivität denkt Husserl an eine mittelbare Relationierung oder »paarende Assoziation«[18] »konstitutiv aufeinander bezogener Monaden«[19]. Mit dieser axiomatischen Analogie rückte der phänomenologischen Tradition nun jene durch Jacobi gegen Hegel reklamierte, von den Transzendentalphilosophen (Hegel, Fichte) eher formalistisch eingelöste Figur des alter ego in den Blick. In der Nachfolge Husserls stellte sich das Problem eines Anerkennungszusammenhangs, einer Dimension elementarer Lebendigkeit und Humanität, die in den Analysen der Intentionalität nicht abzugelten war.
In der französischen Husserl-Rezeption ragt nun Emmanuel Lévinas als prominente Figur heraus. Schon als 24jähriger Student in Freiburg expliziert er eine Théorie de l´intuition dans la phénoménologie de Husserl, und sieben Jahre später entsteht aus der Zusammenarbeit mit Gabrielle Pfeiffer die französische Übersetzung der Cartesianischen Meditationen in Paris. Noch 1981 rief sich Lévinas jene »essentielle Wahrheit«[20] aus Husserls Schriften in Erinnerung, die »sich in... (seinem)... Geist abgezeichnet«[21] hat.
So sehr nun Lévinas dem phänomenologischen »radikalen Einspruch gegen die Priorität des Theoretischen«[22] verpflichtet blieb, so sehr wandte er sich gegen das Ringen der phänomenologischen Analysen um eine Positivität, nach einer Identität des Bewusstseins mit sich selbst.
Uwe Bernhardt hält fest, dass Lévinas den »Wunsch nach einem absoluten Fundament«[23], den Husserl mit der Immanenz des Bewusstseins zu beantworten hoffte, aufsprengt. Entscheidend ist jedenfalls, dass Lévinas in seinem Hauptwerk Totalité et Infini. Essai sur l´extériorité. (1961), stärker aber noch in seinen späten Texten Positivité et transcendance (1988) dazu übergeht, Husserls transzendentale Konstitution des Anderen zu unterlaufen. Nach Lévinas setzt Husserl mit der Referenz auf den Anderen formal die »Grundlage der Objektivität in einem rein subjektiven Prozess« ein. Im Versuch, die Andersheit des Anderen letztlich doch analog zur Gegenständlichkeit des Gegenstands zu konstituieren, verdecke Husserl die asymmetrische, im intentionalen Vollzug nicht aufhebbare Qualität der Beziehung zum Anderen.
Im Zuge einer ersten Bestimmung der unendlichen Alterität des Anderen, die Lévinas Husserls Ableitungsvorschlag aus der Bewusstseinsimmanenz entgegenhält, kann man also Folgendes festhalten: Die Erfahrung des Anderen als Anderen überschreitet von Anbeginn die subjektiv verfügbare Ordnung des Seins, wenn als »immer schon geschehne Öffnung«[24] in die Subjektivität des Ego hereinbricht. Nicht nur wendet Lévinas gegen Husserl ein, der Andere dürfe dem intentionalen Subjektbewusstsein nicht anheim gestellt werden – er möchte vielmehr umgekehrt die Vorbedingtheit aller Subjektivität durch das Datum des anderen Menschen hervorheben:
»Das Subjekt unterscheidet sich vom Sein also nicht durch eine Freiheit, die es zum Herrn der Dinge machen würde, sondern durch eine vorursprüngliche Empfänglichkeit, die älter ist als der Ursprung,...[…] Durch diese Empfänglichkeit ist das Subjekt verantwortlich für seine Verantwortung, es kann sich ihr nicht entziehen, ohne die Spur seiner Fahnenflucht zu bewahren.«[25]
Schon an dieser Stelle lohnt ein erneuter Exkurs zu Jacobis Metaphysikkritik. Jacobi wollte dem Wissen durch das Nichtwissen die Grenze ziehen und die metaphysische Spekulation Hegels gleichsam aufreißen für die Lebendigkeit und Unaustauschbarkeit des Individuums in seinem Selbstsein. Diesem schwer erkämpften, bis ins 20. Jahrhundert hinein kaum schulfähigen Primatwechsel von der Metaphysik zur Ontologie, von der »Washeit«[26] zur »Verfasstheit« des Seins sind Heidegger und Husserl nachgefolgt. Lévinas würdigt diese erste Depotenzierung des Subjekts, doc h er trägt in das nachmetaphysische Subjekt starke Züge eines jüdisch-eschatologischen Denkens ein, wenn er von der »Passivität« und »Verwundbarkeit« des Subjekt-Ichs spricht:
»Subjektivität des Subjekts, radikale Passivität des Menschen, der sich ja sonst immer als Sein hinstellt und erklärt und seine Sinnlichkeit als Attribut betrachtet. Passivität, die passiver ist als jede Passivität, zusammengedrängt in das Fürwort sich, das keinen Nominativ hat. Das Ich ist, vom Scheitel bis zur Sohle, bis in das Mark seiner Knochen, Verwundbarkeit.«[27]
Lévinas vollzieht explizit den zweiten Primatwechsel von der Ontologie zur Ethik. Es soll aber zugleich eine Ethik entfaltet werden, die sich nicht einmal mehr aus der Seinsgeschichte des Einzelnen, geschweige denn aus selbstbewusster Subjektivität herschreibt.. Vielmehr kennzeichnet sich die Gegebenheit des Anderen durch eine radikale Beziehungslosigkeit zwischen Selbst und Anderem, und vor allem durch ein spezifisches Zeitigungsgeschehen, das Lévinas über Heidegger hinaus entwickelt. Der Übergang von der Ontologie zur Ethik als prima philosophia zeigt sich nun an in Lévinas´ Verständnis vom Akt der Zeitigung als Schöpfung. Wie Krewani ausgeführt hat, stimmt Lévinas Heideggers Analyse grundlegend zu, die an der Selbtstzeitigung des Seins ansetzt.[28] Jedoch folgert Lévinas nun gerade nicht mit Heidegger, das Dasein zeichne sich angesichts seiner Zeitlichkeit durch die Möglichkeit eines Sich-selbst-wählen-Könnens aus. Lévinas erkennt in der Zeitlichkeit vielmehr eine uneinziehbare, auf »Diskontinuität und Pluralität«[29] drängende, aus der Synchronie des Daseins herausfallende Differenz zum Anderen schlechthin.
Wie ist es möglich, dass ein unendlich Abwesendes unableitbare Möglichkeit unseres ethischen Handelns ist? Dieses Problem hat Lévinas entschieden mit der Figur der Offenbarung jüdisch-christlicher Provenienz erwidert, eine Figur, die ihm aus der Rezeption Franz Rosenzweigs geläufig war und im zweiten Teil dieser Arbeit fixiert werden soll.
II.2 »Antlitz» und »Spur«. Konstruktionen des absolut Anderen in den ethischen und theologischen Schriften von Lévinas.
Lévinas hatte die Ethik in Form eines unauslöschlichen Verantwortungsverhältnisses zum Anderen der Ontologie vorgeordnet, und war dabei noch radikaler vom Zugriff der Metaphysik abgerückt. Nun aber eröffnete sich das Problem, den Sinn dieses Schritts zu verdeutlichen, um nicht in einen infiniten Zirkel der Art »Es kann nicht sein, was nicht sein darf« zurückzufallen, also eine Ethik um der Ethik willen zu postulieren. Selbst wenn oder gerade weil das »Antlitz« des Anderen in absoluter raumzeitlicher Differenz, oder mit einem Wort von Lévinas, in der Diachronie zum subjektiven Selbst verharrt, soll es der Standort des ethischen Handelns und der ethischen Begründung sein. In einem flüchtigen Rückgriff auf einige Aussagen Franz Rosenzweigs soll die Folie für die ethische Option bei Lévinas angedeutet werden.
In seinen erläuternden Zusätzen zum Stern der Erlösung umreißt Rosenzweig ein Denken, aus dem die prima causa, ein über Raum und Zeit hinaus gültiges Inhärenzprinzip der Welt, abgezogen ist:
»Der Gottesbegriff hat nicht etwa eine Sonderstellung. Als Gottes begriff ist er nicht unerschwinglicher als der Mensch – und Weltbegriff. Umgekehrt: das Wesen des Menschen und das Wesen der Welt – das Wesen! – ist nicht erreichbarer als das Wesen – das Wesen! – Gottes. Wir wissen von allen gleich viel, gleich wenig. Nämlich alles und nichts.«[30]
Zunächst ist entscheidend, dass in diesem Zitat aus Rosenzweigs Neuen Denken eine Idealismuskritik gerinnt, die ganz im Sinne Jacobis an die Möglichkeit radikalen Nicht-Wissens appelliert. Nicht zufällig spielt Rosenzweig an anderer Stelle auf den »geheiligten Brauche«[31] systematischer Philosophie an, demzufolge Logik, Ethik, Ästhetik und Religionsphilosophie in der Positivität des Absoluten zur Deckung gebracht werden sollen. Ähnlich häretisch nahm sich Jacobis Plädoyer für eine philosophische Selbstbescheidung aus, als er die Humanität aus der Logik der Begründung separierte[32].
Es ist wohl angeraten, wie Dober nahe legt, Rosenzweigs Philosophie als eine Transformation der idealistischen Systeme unter dem Eindruck von »Singularität, Vieldimensionalität und Offenheit«[33] zu interpretieren. An den Platz der dialektischen Synthesen rückt Rosenzweig die drei Elementarereignisse Gott, Mensch und Welt, die disjunktiv voneinander geschieden und gerade dadurch gleichursprünglich beigeordnet sind. Was Rosenzweig aufweisen will, ist nicht die Verschlungenheit dieser drei substanziellen Realitäten, sondern ihre Offenheit füreinander, ein Verhältnis also, das Gott Mensch und Welt nicht in einer Ur-Substanz snychronisiert, sondern in einen eminent »grundlosen«[34] und asymmetrischen Akt zurückübersetzt. Hier ist die nun die doppelte Figur greifbar, die Emmanuel Lévinas aus seinen Rosenzweiglektüren geläufig war und die seine theologische Metaphorik von »Spur« und »Antlitz« mitbestimmt.
Um den offenen »Pluralismus der Elemente der Erfahrung«[35] unverfügbar zu machen gegenüber den systematischen Intentionen der idealistischen Philosophie, hatte Rosenzweig ihn in einem vorgängigen Offenbarungsgeschehen abgestützt. Rosenzweig rang darum, die identitätsphilosophische Konsequenz Hegels zu unterlaufen oder zu durchkreuzen, aber dies sollte gerade nicht um den Preis des Absoluten eingefordert werden. Zu denken ist vielmehr an die paradoxe Konstruktion eines absolut Unendlichen, das nur in seiner Nichtgegebenheit Verwirklichungsbedingung für die Entsprechungsverhältnisse der Erfahrung sein kann.
Diese Konstruktion wandert ein in die Schriften Lévinas, wenn die »radikale Abwesenheit« einer göttlich gefassten Unendlichkeit erst jene Situation stiften soll, in der wir als Antwortende Ver–Antwortung für den Anderen wahrnehmen können. Entscheidend ist die Unergründlichkeit des Anfangs jener Ich/Du-Beziehung, aus der sich Lévinas Plädoyer für das Primat der Ethik motiviert. In der Metapher der »Spur«, die zugleich die Entferntheit des Ursprungs markiert und als sein zeichenhafter Verweis vorliegt, hat Lévinas die spezifische Wendung seines Gedankens vollzogen:
»In der Spur ist das Verhältnis zwischen Bedeutetem (signifié) und Bedeuten keine Korrelation, sondern die Ungeradheit selbst. […] Das Bedeuten der Spur versetzt uns in eine ›seitliche‹ Beziehung, die nicht in Geradheit zu verwandeln ist (was in der Ordnung des Enthüllens und des Seins unvorstellbar ist) und die einer nicht rückgängig zu machenden Vergangenheit antwortet.«[36]
Natürlich muss dort, wo eine Spur verläuft, ein Urheber oder eine Ursache der Spur angenommen werden. Folglich erweitert Lévinas seine Metapher um die Figur der »Illeität«, d.h. der Jenseitigkeit eines Dritten, dem grammatisch der Singular Maskulin »Er« zuzuschreiben ist. Von dieser aus dem ontologisch determinierten Lebenskreis des Menschen nun vollends herausgesetzten Punkt absoluter Transzendenz soll die Ermöglichung ethischer Verantwortung zum Antlitz des Anderen in Anspruch genommen werden. Jener »Er« aber, der eine für uns entzifferbare Spur hinterlässt, »lässt […] Gott auf eine Weise denken, die nicht mehr ›vom Sein befleckt‹ ist, die in keiner Weise zwingend ist oder zwingen will, weder Gott unter das Denken der Menschen noch den Menschen unter die Übermacht Gottes, in der Gott aber dadurch vom Nichts unterschieden ist, dass er ›den Nächsten meiner Verantwortung anvertraut‹«.[37]
Es ist daher nur konsequent, wenn die spezifische Bewegung des Arguments bei Emmanuel Lévinas um ein Unergründliches gravitiert. Die unendliche Alterität des Anderen wird gemäß Lévinas verunmöglicht, wo sie in die synthesenbildende Instanz des Subjekts zurücksinkt und aus der Diachronie gewaltsam rationalisiert wird. Mit Recht konstatiert Byung-Chul Han darum »die Verabsolutierung oder Apotheose des Anderen«[38], die diesen gleichsam für »kommunikative Nähe«[39] unverfügbar macht.
Ausgesetzt in den Zwischenbezirk von Totalität und Unendlichkeit, hat das Verhältnis zum anderen Menschen in der Vorstellung von Lévinas wesensgemäß seinen letzten Motivationsgrund in der Negativität – in der Abwesenheit eines Unendlichen[40]. Die Pointe der »Illeität« bei Lévinas liegt gerade in der Vorfindlichkeit einer »Spur«, deren Urheber, jener numinose »Ille«, sich doch stets entzieht[41] und die nichts als ihre ostentative, uns zur Verantwortung rufende Zeichenhaftigkeit anmahnt.
Es ist nötig, diese von Rosenzweig aus verständliche Konstruktion des Anderen als »Antlitz« und ihr Angewiesensein auf ein Desiderat, das sie zugleich fundiert, wiederzugeben, denn eben in dieser Konstruktion situiert Lévinas die »Person«. In Totalität und Unendlichkeit definiert Lévinas noch das Antlitz als ein Ereignis, »in dem sich gerade ein Seiendes in seiner Person darstellt«[42]. Was Lévinas mit dem Gedanken an die Selbstdarstellung im Auge hat ist wohl nicht eindeutig. Wenn hier nämlich von Lévinas die Etymologie von »persona« als Theatermaske bzw. deren Trägersubjekt aufgerufen ist, so ließe sich dies kaum in der Vorstellung von der »Passivität« des Seienden unterbringen, denn im Spiel wäre das Seiende wohl in ausgezeichneter Weise aktives Subjekt, »sich selbst Ziel und Ursprung«[43]. Tatsächlich sucht Lévinas aber die Selbstursprünglichkeit des selbstbewussten Subjekts abzustreifen im Übergang zu jenem Verhältnis, in das Subjekte von ihrem Nicht–Sein und Nicht–Wissen, von der Dimension des Anderen aus, gestellt sind.
Im Rahmen seiner Bemerkungen über den Sinn hat Lévinas die Differenz zur persona als Theaterakteur auf eine Formel gebracht:
»Das genau ist die Einmaligkeit des Ich. Erstgeburtsrecht und Erwählung, Identität und Priorität eines Identischwerdens und einer Vorzüglichkeit, die irreduzierbar sind auf jene, welche die Seienden in der Anordnung der Welt und die Personen in der jeweiligen Rolle kennzeichnen oder konstituieren, die sie als Persönlichkeiten auf der sozialen Bühne der Geschichte spielen, das heißt im Spiegel der Reflexion oder im Selbstbewusstsein.«[44]
Nur im Geschehen einer »Erwählung«, deren Ursprung unergründlich bleibt, konturiert sich der Begriff der Person als eines »Einmaligen« und »Vorzüglichen«, das sich auf der Ebene des sozialen Spiels nicht auflöst. Diese Ebene existiert gleichwohl, aber sie organisiert sich tatsächlich in den Gesetzen von Darstellung, Rollenverhalten, Reflexion und Selbstbewusstsein und korrespondiert insofern tatsächlich mit der von Lévinas kritisierten Subjektphilosophie. Lévinas setzt also an der Unterscheidung zwischen »Person« und »Persönlichkeit« an, erstere als Antlitz sich offenbarend, letztere als reflexive Form, die sich performativ zu sich selbst verhält.
Besonders die Überlegung, die Lévinas zur Persönlichkeit anstellt, lässt es sinnvoll erscheinen, zur Diskussion eines auf die Logik des Performativen abzielenden Ansatzes zu kommen, nämlich zu den Thesen Helmuth Plessners. Dies soll im folgenden Teil geschehen.
III. »Von sich fort und über sich hinaus«. Helmuth Plessners Modell der Exzentrierung der Person.
III.1 Plessner in der Tradition der Phänomenologie Husserls.
Immer wieder hat Emmanuel Lévinas aus der eigenen Biografie methodische Anschlüsse an die von Husserl formalisierte Phänomenologie begründet. Seine Interviews mit Philippe Nemo machen Lévinas´ Ambivalenzen gegenüber dem Lehrmeister aus Freiburg unüberhörbar. Es ist symptomatisch, wenn Lévinas in ihnen eine von Husserl selbst nirgends fortgeschriebene »husserlianische Möglichkeit«[45] hervorhebt. Diese Möglichkeit kennzeichnet Lévinas als Versuch, aus der Konzeption der Intentionalität eine spezifische Weise der »Erinnerung dieser vergessenen Gedanken«[46] hervorzutreiben, »die die Objektivität anstreben und die dieser ein Dorn im Auge sind«[47]. Das aus der Metaphysik Abgeblendete ist in Husserls Intentionalitäten zwar präsent, entfaltet seinen ganzen Geltungsanspruch aber erst im ethisch aufgeladenen, diachronisch gesetzten Verhältnis zum Anderen.
Mit Edmund Husserl verkehrte im Göttingen um 1915/16 auch ein Student der Zoologie und Philosophie, der in den 20er Jahren mit Publiaktionen hervortrat: Helmuth Plessner. Plessner notiert eine anekdotische Erinnerung an jenen Professor und »Ontologen aus Leidenschaft«, der, wie im Fall von Lévinas, zum Referenzrahmen des eigenen Philosophierens hinzukam:
»Ich erinnere mich einer kleinen Szene am Tor seines Gartens in Göttingen. Wir sprachen über Fichte und seinen seltsamen Begriff vom Ich, das die Natur aus sich hervorbringt. Da nahm er seinen Spazierstock, stemmte ihn gegen den Türpfosten und sagte: `So wie ich diesen Widerstand hier erfahre, muß die Philosophie sich des Seins versichern´«
Nicht nur deshalb ist diese Episode aufschlussreich, weil Husserl hier unbescheiden die Rolle der Philosophie übernimmt, die sich normativ als Selbstversicherung des Seins im Sein definiert, sondern vor allem wegen des Gegenstands der Unterhaltung. Offenkundig war Plessner im Gespräch mit Husserl die Relation des Subjekt-Ichs zur absoluten produktiven Natur, die Fichte postuliert hatte, angelegen. In diese Fragestellung ist damit aber auch schon hineingelegt, was anfangs an Hand der Anerkennungsverhältnisse problematisiert wurde: Ist nicht die Immanenz des Selbstbewusstseins zugleich Bedingung der Unmöglichkeit absoluter Alterität? Ist nicht ein Begriff vom Ich »merkwürdig«, der sich als Einheitsbedingung allen Wissens installiert und darin Fremderfahrung einschließt?
Zeitlebens hat Plessner Überlegungen angestellt, welche hinter den Subjektidealismus zurückgreifen und zu einer Dimension menschlicher Selbstverständigung vorstoßen sollten, die methodisch von der Spezifik menschlicher Organismen nicht abstrahieren kann (wie es Hegels Hiatus des Selbstbewusstseins tut). Zahllose Schriften und Aufsätze widmete Plessner der Bestimmung des eigenen systematischen Standpunkts, den er jedoch nirgends so sehr präzisierte wie in im ersten Kapitel seines Hauptwerks Die Stufen des Organischen und der Mensch (1928):
»Philosophische Hermeneutik als die systematische Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit des Selbstverstehens des Lebens im Medium seiner Erfahrung durch die Geschichte lässt sich nur in Angriff nehmen – auf Grund einer Erforschung der Strukturgesetze des Ausdrucks.«[48]
Plessner bringt seine methodische Zielsetzung hier auf die entscheidende Formel und rekonstruiert holzschnittartig die für ihn relevanten Traditionen der Philosophie. Von Dilthey her war ihm die Logik der Hermeneutik geläufig, die nicht an den Objektivationen des Geistes, sondern an geschichtlich entzifferbaren Verstehensvollzügen ansetzt. Erweitert wird diese Komponente durch eine von Misch wissenschaftsphilosophisch radikalisierte Verwendungsweise der Hermeneutik, die »Leben« fortan an die »Selbsttranszendenz«[49] menschlichen Ausdrucksverhaltens zurückbinden wollte. Drittens ist Plessners Vorhaben augenfällig, die Ermöglichungsbedingungen geschichtlich-politischer Erfahrungen zu eruieren, d.h. seine Problemstellung ist transzendentalphilosophisch orientiert[50].
Im Folgenden sollen summarisch einige Schritte Plessners auf dem Weg zu einer Spezifizierung menschlichen Lebens angedeutet werden. Das zweite Kapitel des zweiten Teils stellt dann Plessners Ableitungsvorschlag zum Problem der Alterität in den Mittelpunkt. Abschließend soll eine Synopse der Gedankengänge von Lévinas und Plessner im Hinblick auf eine gemeinsame Figur der Unergründlichkeit gezeigt werden, die Jacobi in die Debatte mit Hegel einführte.
III. 2 Das »Antlitz« und die Mitwelt. Über Plessners Herleitung der Alterität in den Stufen des Organischen.
Im Titel seines Hauptwerks ist Plessners Gedanke enthalten, für die Analyse der Natur insgesamt Stufen als Differenzierungskriterium einzuführen. Die Anordnung organischen Lebens qua Stufen lenkt den Blick auf die jeweilige Grenze der Lebendigkeit oder die Grenze der jeweiligen Integriertheit einer Lebensform in die Prozesse seiner Umwelt.
Holz hat daran erinnert, dass Plessner Belebtheit von Unbelebtheit über das Phänomen der »Doppelaspektivität«[51] abhebt. Jedes Lebewesen erleidet Fremdtätigkeit und übt Eigentätigkeit aus – »der Antagonismus dieser beiden Wirkungen lässt sich fassen als die den Lebewesen äußerliche und die ihnen innerliche Seite ihrer Weltbeziehung«[52]. Mediatisiert wird diese Beziehung zur Welt über die Organe des Lebewesens, das auf diese Weise in Positur zum eigenen Umweltmilieu gestellt ist. Die Gegebenheit einer Verhaltensposition zur eigenen Umwelt markiert Plessner im Begriff der »Positionalität«. Während nun Pflanzen umfassend und als »unselbständiger Abschnitt«[53] in das Geschehen ihrer Umwelt eingegliedert sind, unterbricht sich beim Tier der Kontakt mit der Umwelt, und zwar in der »Einheit des Körpers«[54] als Zentrum des Verhaltens.
Den Analysen der »geschlossenen Positionalität« tierischen Lebens hat nun Plessner eine der für seine Gesamtkonzeption tragfähigsten Thesen eingeschrieben. Plessner operationalisiert hier eine Unterscheidung zwischen Leib und Körper des Lebewesens:
»Er (der Organismus, Anm. d. Verf.) ist die über die einheitliche Repräsentation der Glieder vermittelte Einheit des Körpers, welcher eben dadurch von der zentralen Repräsentation abhängt. Sein Körper ist sein Leib geworden, jene konkrete Mitte, dadurch das Lebenssubjekt mit dem Umfeld zusammenhängt. […] Auf diese Weise bekommt die Mitte, der Kern, das Selbst oder das Subjekt des Habens bei vollkommener Bindung an den Körper Distanz zu ihm. Obwohl rein intensives Moment der Positionalität des Körpers, wird die Mitte von ihm abgehoben, wird er ihr Leib, den sie hat.«[55]
In der geschlossenen Position des Tiers differenziert sich der Körper von dem in ihn gesetzten, »raumhaften«, nicht lokalisierbaren Kern zu jenem Doppelaspekt, der alles »höhere Leben« durchzieht.. Allerdings stehen Körper und Leib unvermittelt zusammen und ermöglichen die totale Konvergenz des Tiers mit dem »Hier-Jetzt«[56]. Plessners Punkt ist, dass ein Tier zwar aus dem eigenen psychophysischen Aktionszentrum des Körpers heraus lebt, dass es »aus seiner Mitte heraus, in seine Mitte hinein, aber nichts als Mitte«[57] lebt. Im qualitativen Übergang zu einer Seinsposition, der die Differenz zwischen Leib und Körper, zwischen einer Kontaktoberfläche zur Welt und einem subkutanen »Subjekt des Habens«, einem Selbst, ihrerseits noch einmal gegeben ist, situiert Plessner die menschliche Lebensform.
Auf entscheidende Weise ist der Mensch aus der Vorangepasstheit an seine Umwelt herausgehoben. Was als »verborgene Mitte« der frontal gegen die Umwelt gestellten tierischen Leibexistenz entzogen bleibt, wird dem Menschen in einem reflexiven Schritt selbst zum Gegenstand. Abermals in den Stufen macht Plessner auf die anthropologische Konsequenz für den derart deterritorialisierten Menschen aufmerksam:
»Ihm ist der Umschlag vom Sein innerhalb des eigenen Leibes zum Sein außerhalb des Leibes ein unaufhebbarer Doppelaspekt der Existenz, ein wirklicher Bruch seiner Natur. Er lebt diesseits und jenseits des Bruches, als Seele und als Körper und als die psychophysisch neutrale Einheit dieser Sphären. […] Sie (die Einheit, Anm. d. Verf.) ist der Bruch, der Hiatus, das leere Hindurch der Vermittlung, die für den Lebendigen selber dem absoluten Doppelaspekt und Doppelcharakter von Körperleib und Seele gleichkommt, in der er lebt.«[58]
Mit der in der Exzentrischen Positionalität angelegten »Entsicherung« menschlichen Seins, der »keimhaften Spaltung«[59] von Leib-Sein und Körper-Haben, geht Plessner nicht zuletzt zur phänomenologischen Tradition auf Distanz. Er beschließt die Stufen mit einer Differenzierung dreier Wirklichkeitsbereiche, die der Logik der Exzentrischen Positionalität unterliegen: Außenwelt, Innenwelt und Mitwelt. In Sonderheit der Mitweltbegriff soll hier noch kurz expliziert werden, denn in ihm deutet sich Plessners transzendentalphilosophische Kritik an jenen »berühmten Theorien des Analogieschlusses und der Einfühlung«[60] an, die nicht zuletzt von Husserl und Lévinas verfolgt wurden.
Die Figur der »Exzentrischen Positionalität« sensibilisierte Plessner endgültig für die Problematik der Intersubjektivität bzw. Alterität, die nun nicht mehr umstandslos in einem Appräsentationsakt aufzuheben ist. Plessner vollzieht in seiner Interpretation der Mitwelt den Wechsel von einem explanandum zu einem explanans. Die Mitwelt soll nicht, wie Husserl es nahegelegt hatte, als ein zu erklärendes Interaktionsfeld von Bewusstseinsträgern aus der Projektion eigener Leibhaftigkeit auf die bewusste Leibhaftigkeit des Anderen erst abgeleitet werden. Plessner zufolge bewegt sich die personale Identifizierung des Anderen wie des Eigenen selbst in einem vorauszusetzenden Raum der Lebendigkeit. Nur auf der Grundlage eines transpersonalen »Wir« können Zuschreibungen in der »Ich«– »Du« – »Er, Sie, Es«– Form schlechterdings in Anspruch genommen werden, und eben diesen Raum nennt Plessner »Mitwelt«.
Nirgends zieht Plessner in den Stufen seine systematische Differenz zu den Phänomenologen schärfer als in der Erörterung der Mitwelt, wenn er diese als Sphäre des »Geistes« offen legt:
»Real ist die Mitwelt, wenn auch nur eine Person existiert, weil sie die mit der exzentrischen Positionsform gewährleistete Sphäre darstellt, die jeder Aussonderung in der ersten, zweiten, dritten Person Singularis und Pluralis zugrunde liegt. […] So ist sie das reine Wir oder Geist. Und nur so ist der Mensch Geist, hat er Geist. Er hat ihn nicht in derselben Weise, wie er einen Körper und eine Seele hat. Diese hat er, weil er sie ist und lebt. Geist dagegen ist die Sphäre, kraft deren wir als Personen leben, in der wir stehen, gerade weil unsere Positionsform sie erhält.«[61]
Während Lévinas in der theologischen Symbolik der »Spur« das »Magnetfeld der Selbstvergewisserung«[62] sprengte, das ihm aus dem Intersubjektivitätskonzept Husserls geläufig war, umkreisen Plessners Ausführungen zur »Mitwelt« die klassische transzendentalphilosophische Problematik des Geists. Die lebendige Ebene des Geistes konstituiert zugleich ein Modell unendlicher Stellvertretung, wenn sie der »früheren rationalistischen Konnotationen entledigt und zur menschlichen Allgemeinheit der ineffablen Individualität geworden ist«[63].
In dem Maße, in dem der exzentrische Standort des Anderen als Standort des Eigenen vollziehbar wird, ziehen sich die Inter- und Transaktionen der Individuen gleichsam unter dem Gesichtspunkt des »Einen Menschen«[64] zusammen, unter dem »alles, was Menschenantlitz trägt, ursprünglich verknüpft bleibt, wenn auch die vitale Basis in Einzelwesen auseinandertritt.«[65]
Lévinas hat bekanntlich den Ursprung des ethischen Verhältnisses zum Anderen nicht begrifflich-philosophisch geklärt, sondern theologisch verschoben, um ihn in seiner Gegründetheit auf die Offenbarung, genauer: als »Spur« eines göttlichen Absoluten zum Tragen kommen zu lassen. Es ist nun vor dem Hintergrund einer Lévinas-Lektüre aufschlussreich, wenn Plessner im Schlusspassus des Mitweltkapitels der Stufen auf jene jüdisch-christliche Metaphorik vorausgreift, die für das Denken und die Schriften Lévinas´ so leitend ist:
»Die Sphäre, in der wahrhaft Du und Ich zur Einheit des Lebens verknüpft sind und einer dem andern ins aufgedeckte Antlitz blickt, ist aber dem Menschen vorbehalten, die Mitwelt, in der nicht nur Mitverhältnisse herrschen, sondern das Mitverhältnis zur Konstitutionsform einer wirklichen Welt des ausdrücklichen Ich und Du verschmelzenden Wir geworden ist.«[66]
In der Sphäre des Geistes oder des transzendenten »Wir«, die als Beschränkung dem Sein des Individuums konstitutiv voraufgeht, blickt »einer dem andern ins aufgedeckte Antlitz«. Die Mitwelt stellt sich als das säkulare Äquivalent zu Lévinas Vorstellung einer abwesenden Anwesenheit Gottes dar, durch die allein »Bewegungen ohne Wiederkehr«[67], die »unabgeschlossen und asymmetrisch«[68] im intersubjektiven Verkehr stünden, zu einem gelebten ethischen Verhältnis transformiert werden.
Im letzten Kapitel soll der Versuch gemacht werden, in der Philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners nun ebenfalls einen Begriff der Person dingfest zu machen. Dabei bewegt sich Plessners Ansatz auf jene Tradition zu, von der Jacobis salto mortale und Lévinas´ Ethik von Antlitz zu Antlitz gleichermaßen getragen sind, eine Tradition, die jede Bestimmung der Person notwendig an das Element der Unergründlichkeit, Unbeweisbarkeit und Unsagbarkeit zurückübersetzt.
IV. Abschluss. Die Grenzen der Person und das Denken des Undenkbaren bei Jacobi, Lévinas und Plessner.
In der Diskussion der Texte Lévinas´ war eine Figur zum Vorschein gekommen, welche die Abwesenheit jeder Bezugsmöglichkeit zum Anderen markierte: eine »Spur« des unendlich abwesenden und unverfügbaren Absoluten, welches in Diachronie zu den Zeitlichkeitsverhältnissen des menschlichen Seins verharrt. Unsere »Antwort« auf das »Antlitz, das zugleich gibt und entzieht«[69] wird in einem zeitlichen Sinne vollzogen, sie soll auf eine durch den Anderen zur Gegenwart durchgreifende Zukunft hingeordnet sein. Das »Ereignis der Person« besteht in der Erfahrung des Subjekts, den Raum der eigenen Existenz nicht mehr verfügbar und symmetrisch ausfüllen zu können, und als »Person« überfällt der Andere das nur vermeintlich und befristet souveräne Ego-Subjekt, insofern es in dessen sicher geglaubtes Terrain unvermutet hereinbricht.
Es scheint doch, als seien Lévinas´ Hinweise zum Begriff der Person an dieser Stelle tatsächlich gar nicht so weit fortgerückt von der in Plessners Anthropologie konstitutiven Exzentrischen Positionalität. Welche Einwände könnte er gegenüber einer Position machen, die nichts Geringeres als die unendliche Offenheit menschlicher Lebensform, deren »Stehen im Nirgendwo« oder »offene Immanenz« zum sich immer selbst durchschreitenden Prinzip erklärt?
Seine Einwände beträfen ganz sicher das geschichtlich-hermeneutische Verfahren, das Plessner in einem drei Jahre nach den Stufen publizierten Text, in Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht, in die Debatte brachte. Aus dem zentralen Befund der Stufen, der für das menschliche Leben virulenten Exzentrischen Positionalität, zieht Plessner nun (wie auch Krüger hervorhebt[70] )die geschichtlich-politische Konsequenz. Wenn es stimmt, dass menschliches Handeln im Vollzug der Exzentrierung eine »primäre Differenz von Zentrum und Horizont und somit von Vertrautheit und Fremdheit«[71] einschließt, dann werden sämtliche soziokulturellen Produktionen des Menschen auf ihre Geschichtsbedingtheit, ihre »Entsicherung« und Relativierung hin durchsichtig. Nur aus der Einsicht in die unendliche Unbestimmtheit und Unabgeschlossenheit seines Daseins wächst dem Menschen die potestas zu, »sich selbst und seine Welt handelnd zu bestimmen«[72]. In die Geschichtlichkeit seiner eigenen Lebensvollzüge hineingestellt, muss sich der Mensch als Macht und in einer absoluten Relation der Unbestimmtheit selbst in Anspruch nehmen. Wenn der Mensch sich begreift innerhalb einer Relation der Unbestimmtheit, in der Spannung, die Eigenes und Anderes, Hier und Dort zugleich separiert und als vertauschbare Orte bezieht, dann und nur dann ist der Mensch nach Plessner eine »Person«. Sich als »Verhältnis von Verhältnissen«[73] realisierend schlägt der »Person« die Drohung einer geschichtlichen Kontingenz entgegen, die nur in Begriffen von Rollenspiel und Schauspiel zu bewältigen ist.
Plessner ringt auf dem methodischen Boden seiner Philosophischen Anthropologie mit einer Gedankenbewegung, in der das Unergründliche (des menschlichen Wesens und seiner geschichtlichen Gestaltungspotenziale) seinerseits verbindlich wird. In einer wiederum an den Duktus Lévinas´ anklingenden Textstelle behauptet Plessner, dass »die Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, vor Gott, selber als Prinzip zum Vorschein kommt«[74]. Auf der »Nachtseite seiner Weltoffenheit«[75] zahlt der Mensch den Preis der Verborgenheit seines eigenen Wesens für sich selbst.
Volker Schürmann hat den idiosynkratischen Schritt Plessners beschrieben, das Prinzip der Unergründlichkeit mit dem aus den Stufen fortgeführten Prinzip der Exzentrizität ineinander zu blenden:
»Diese eigentümliche Verschränkung findet ihren Ausdruck auch darin, daß die beiden Prinzipien auch in umgekehrter Weise den beiden Begründungsdimensionen zugeordnet werden können: In solcher Perspektive ist das Prinzip der Unergründlichkeit das Prinzip der Ansprechbarkeit des Menschen als eines Gleichen unter Gleichen, und das Prinzip der Exzentrizität gibt diejenige Bestimmung an, die als ontisch realisiert unterstellt werden muß, um den Menschen so ansprechen zu können.«[76]
Plessner setzt in seiner machtanalytischer Weiterführung der Philosophischen Anthropologie ebenfalls eine Primatverschiebung ins Werk, eine Verschiebung allerdings, die nicht dem Vorrang der Ethik vor der Ontologie gleichkommt. Vielmehr treten Anthropologie, Philosophie und Politik als unableitbare und gleichursprüngliche Formen nebeneinander, insofern sie nicht a priori maßstäblich für die Gestaltungsmöglichkeiten des Geschichtlichen sind. Eine weitere neuralgische Stelle aus Macht und menschliche Natur gibt Auskunft über die Relation von Eigenem und Fremdem, die alle Primatsetzungen außer Vollzug setzt:
»So als das Andere seiner selbst auch er selbst ist der Mensch ein Ding, ein Körper, ein Seiender unter Seienden, welches auf der Erde vorkommt, eine Größe der Natur, ihren Schwerkrafts- und Fallgesetzen, ihren Wachstums- und Vererbungsgesetzen wie ein Stück Vieh unterworfen, mit Maß und Gewicht zu messen, bluthaft bedingt, dem Elend und der Herrlichkeit einer blinden Unermesslichkeit ausgeliefert. […] Er (der Mensch, Anm. d. Verf.) ist auch das, worin er sich nicht selbst ist, und er ist es in keinem äußerlichen und geringeren und nachgeordneten Sinne.«[77]
Vergleichend könnte man sich eine Passage in Lévinas´ Die Zeit und der Andere ins Gedächtnis rufen, die das von Plessner angedeutete intermediäre Verhältnis auch zwischen Selbst und Anderem eliminiert:
»Doch inmitten des Verhältnisses zum anderen, das unser soziales Leben charakterisiert, erscheint schon die Anderheit als eine nicht reziproke Beziehung, das heißt als der Gleichzeitigkeit zuwiderlaufend. Der andere, insofern er anderer ist. Ist nicht nur ein alter ego; er ist das, was ich gerade nicht bin.«[78]
Die systematische Differenz der Alteritätstheorien bei Plessner und Lévinas markiert sich nicht zuletzt in der Frage nach dem alter ego: Während Lévinas in der Diachronie den Schlüssel für die Absolutstellung des Anderen gegenüber dem Selbst entdeckt und die alter ego-Beziehung als verdinglichend verwirft, hat Plessner ein Mitweltverhältnis vor Augen, das im Anderen zwar das Eigene begrenzt, nicht aber den Anderen strukturell unterläuft.
Auch auf einer methodisch engeren Ebene lässt sich die Antithetik der Gedankenbewegungen von Plessner und Lévinas beobachten. Lévinas stellt in der Absolutheit des Anderen, die sich nur im ethischen Verhältnis aufrechterhält, die Negativität der Geschichte vor Augen. Geschichte enthüllt sich als ein Ort der Gewalt, insofern sie die fragile Beziehung von Antlitz zu Antlitz in der »Gerechtigkeit des Vergleichens«[79] rationalisiert und pluralisiert:
»Sobald es aber einen Dritten gibt, muß ich vergleichen, das Unvergleichliche des Anderen mit aller nur möglichen Behutsamkeit vergleichen. Die Gerechtigkeit des Vergleichens kommt notwendigerweise nach der Barmherzigkeit. Sie verdankt der Barmherzigkeit alles, aber sie verneint sie ständig. Darin liegt schon das Politische«.[80]
Lévinas lässt offen, wodurch sich eine solche Politik der Balance, die das Eintreten eines Dritten nicht um den Preis des Verlusts der Barmherzigkeit gegenüber dem Zweiten geschehen lässt, auszeichnen soll.
Demgegenüber kann Plessner im Programm seiner Philosophischen Anthropologie das Geschichtlich–Politische positiv projektieren. Das Politische ist gleichsam die existenzielle Folie, durch die dem Menschen der » geschichtsaufschließende Horizont eines Lebens«[81] positiv durchscheint. Vom Politischen aus ist gerade das performative Potenzial der Körper-Leib-Differenz freizusetzen, das Geschichte immer wieder neu möglich macht.
Sowohl die unendliche Alterität des Anderen in Lévinas´ theologischer Ethik als auch jene Unbestimmtheitsrelation, die gemäß Plessners Philosophischer Anthropologie als offene Frage in das Leben des Menschen als eines homo absconditus hineinragt, vollziehen also den offenen Bruch mit philosophischen Totalbegründungen aus der Traditionslinie des Deutschen Idealismus. Beide geben darin ein Echo auf jene im Spinoza–Streit losgetretene Debatte, in der schon Jacobi die Grenzen philosophischer Systeme vermerkte – Grenzen, die er in seinem Argument des salto mortale sichtbar machte.
Tatsächlich aber hat Plessner im allerletzten Absatz der Stufen dezidiert einem solchen anthropomorphen »Sprung in den Glauben«, mit dem Jacobi sich aus der Logik des Verstands herauskatapultierte, widersprochen. Den Schlussakkord seiner Philosophischen Anthropologie setzt bekanntermaßen das Bekenntnis zu einer Unbestimmtheit, die sich von der Relation auf einen absoluten Grund lossagt:
»Ein Weltall lässt sich nur glauben. Und solange er glaubt, geht der Mensch ›immer nach Hause‹. Nur für den Glauben gibt es die ›gute‹ kreishafte Unendlichkeit, die Rückkehr der Dinge aus ihrem absoluten Anderssein. Der Geist aber weist Mensch und Dinge von sich fort und über sich hinaus. Sein Zeichen ist die Gerade endloser Unendlichkeit. Sein Element ist die Zukunft. Er zerstört den Weltkreis und tut uns wie der Christus des Marcion die selige Fremde auf.«[82]
Jacobis antimetaphysischer salto mortale, eine auf das Antlitz des Anderen hin entgrenzte Spur bei Lévinas, und das Modell der Exzentrischen Positionalität Plessners: All diese Konstruktionen sind gleichsam getragen von einem Desiderat in philosophischen Begründungszusammenhängen und einem Sprung aus der Metaphysik in eine Dimension erfahrener Lebendigkeit. Just in dieser Dimension stehen aber nicht Subjekte in Verkehrs- und Austauschprozessen, sondern Personen, und in diesem mehr interpersonalen als intersubjektiven Raum eröffnet sich eine opake Grenze, an die eine philosophische Metaphysik nicht mehr heranreicht.
Liest man Jacobi, Lévinas und Plessner aber synoptisch hinter- oder gegeneinander, so wird evident, warum Plessners philosophisch-anthropologisches Projekt zugleich flexibler, tiefergreifend und angreifbarer als die Modelle des dialogischen Denkens ist. Plessners Mensch nämlich ist ein radikal nacktes, boden– und heimatloses, verzweifelt säkulares Wesen, denn wenn es entlang der »Gerade endloser Unendlichkeit« zu leben hat, so stürzt es sich mit seinem salto mortale nicht in tiefen Glauben, sondern in die Leerstellen der Geschichte, in denen es sich zuletzt bewähren muss.
Literaturverzeichnis
Bernhardt, Uwe:
Ohne Fundament? Neue Debatten um die Ethik von Lévinas. In: Philosophische Rundschau. Eine Zeitschrift für philosophische Kritik. Band 48 (2001). S. 313-334.
Christ, Kurt:
Jacobi und Mendelssohn. Eine Analyse des Spinozastreits. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1988.
Dober, Hans-Martin:
Lévinas und Rosenzweig. Die Verschärfung der Totalitätskritik aus den Quellen des Judentums. In: Lévinas. Zur Möglichkeit einer prophetischen Philosophie. Hrsg. von Michael Mayer und Markus Hentschel. Gießen: Focus Verlag, 1990 (=Schriftenreihe Parabel des Evangelischen Studienwerks Band 12). S. 144-162.
Folkers, Horst:
Zum Begriff der Freiheit in Spinozas »Ethik”, Kants «Kritik der reinen Vernunft” und Fichtes »Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre«. In: Spinoza in der europäischen Geistesgeschichte. Berlin: Hentrich, 1994 (=Studien zur Geistesgeschichte Bd. 16). S. 244-262.
Han, Byung-Chul:
Über die Aneignung. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. Heft 11, November 2003. S. 1057 – 1061.
Haucke, Kai:
Das Unverfügbare und die Unantastbarkeit der Würde. Habermas, die Bioethik und Plessners philosophische Anthropologie. In: Philosophische Rundschau. Eine Zeitschrift für philosophische Kritik. Band 49 (2002). S. 165 – 178.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich:
Phänomenologie des Geistes. Werke, Band 3. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991 (=Suhrkamp–Taschenbuch Wissenschaft Bd. 603).
Heinrichs, Johannes:
Dialektik oder Dialogik? In: Der Dialogbegriff am Ende des 20. Jahrhunderts. Internationale wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 225. Geburtstags von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hrsg. von Erwin Hasselberg, Ludwig Martienssen und Frank Radtke. Berlin: Hegel Institut e.V., 1996. S. 59-65.
Holz, Hans-Heinz:
Die Systematik der Sinne. In: Unter offenem Horizont. Anthropologie nach Helmuth Plessner. Hrsg. von Jürgen Friedrich und Bernd Westermann. Mit einem Geleitwort von Dietrich Goldschmidt. Frankfurt am Main: Lang, 1995 (=Schriftenreihe DAEDALUS Europäisches Denken in deutscher Philosophie). S. 117-127.
Homann, Karl:
F.H. Jacobis Philosophie der Freiheit. Freiburg/München: Alber, 1973.
Hundeck, Markus:
»Conatus essendi« und »inkarniertes Subjekt«. Ein inszenierter Dialog zwischen Baruch de Spinoza und Emmanuel Lévinas. In: Emmanuel Lévinas – eine Herausforderung für die christliche Theologie. Hrsg. von Josef Wohlmuth. 2., verbesserte Aufl. Paderborn et al.: Schöningh, 1999. S. 121-141.
Husserl, Edmund:
Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie. Herausgegeben, eingeleitet und mit Registern versehen von Elisabeth Ströker. Hamburg: Meiner, 1977.
Jacobi, Friedrich Heinrich:
Einige Betrachtungen über den frommen Betrug und über eine Vernunft welche nicht die Vernunft ist. An Joh. Georg Schlosser. In: Werke, Zweiter Band. Hrsg. von Friedrich Roth und Friedrich Köppen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.
Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung. In: Werke, Dritter Band. Hrsg. von Friedrich Roth und Friedrich Köppen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.
Über die Lehre des Spinoza, in Briefen an Herrn Moses Mendelssohn . In: Werke, Vierter Band. Hrsg. von Friedrich Roth und Friedrich Köppen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.
Beilagen zu den Briefen über die Lehre des Spinoza. In: Werke, Vierter Band. Hrsg. von Friedrich Roth und Friedrich Köppen. Darsmtadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.
Konersmann, Ralf:
Person. Ein bedeutungsgeschichtliches Panorama. In: Internationale Zeitschrift für Philosophie Heft 2/1993. S. 199-227.
Krewani, Wolfgang Nikolaus:
Diachronie und Schöpfung. In: Emmanuel Lévinas – eine Herausforderung für die christliche Theologie . Hrsg. von Josef Wohlmuth. Zweite, verbesserte Auflage. Paderborn et al.: Schöningh, 1999. S. 43-62.
Krüger, Hans-Peter:
Zwischen Lachen und Weinen. Band II: Der dritte Weg Philosophischer Anthropologie und die Geschlechterfrage. Berlin: Akademie Verlag, 2001.
Lévinas, Emmanuel:
Die Zeit und der Andere. Übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Ludwig Wenzler. 3. Aufl. Hamburg: Meiner, 1995.
Humanismus des anderen Menschen. Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Ludwig Wenzler. Hamburg: Meiner, 1989.
Darin:
Die Bedeutung und der Sinn (1964). S. 9-59.
Humanismus und An-Archie (1968). S. 61-83.
Ohne Identität (1970). S. 85-104.
Ethik und Unendliches. Gespräche mit Philipp Nemo (1982). Aus dem Französischen von Dorothea Schmidt. Hrsg. von Peter Engelmann. Wien: Passagen Verlag, 1996.
»Die Menschheit ist biblisch«. In: Jüdisches Denken in Frankreich. Gespräche mit Pierre Vidal–Naquet, Jacques Derrida, Rita Thalmann, Emmanuel Lévinas, Léon Poliakov, Jean–Francois Lyotard, Luc Rosenzweig. Hrsg. und übersetzt von Elisabeth Weber. Frankfurt am Main: Jüdischer Verlag, 1994. S. 117-131.
Mosès, Stephane:
System und Offenbarung. Die Philosophie Franz Rosenzweigs. Mit einem Vorwort von Emmanuel Lévinas. Aus dem Französischen von Rainer Rochlitz. München: Wilhelm Fink Verlag, 1985 (=Schriftenreihe Übergänge Band 11).
Plessner, Helmuth:
Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Gesammelte Schriften Band IV. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.
Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht. In: Gesammelte Schriften Band V. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. S. 135-234.
Homo absconditus (1969) . In: Gesammelte Schriften Band VIII. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. S. 353-366.
Ad memoriam Edmund Husserl. In: Politik – Anthropologie – Philosophie. Aufsätze und Vorträge. Hrsg. von Salvatore Giammusso und Hans–Ulrich Lessing. München: Fink, 2001 (= Schriftenreihe Übergänge Band 40). S. 297-303.
Rosenzweig, Franz:
Das neue Denken. Einige nachträgliche Bemerkungen zum »Stern der Erlösung« (1925). In: ders: Die Schrift. Aufsätze, Übertragungen und Briefe. Hrsg. von Karl Thieme. Königstein/Taunus: Jüdischer Verlag Athenäum, 1984. S. 186-211.
Sandherr, Susanne:
Eine Religion für Erwachsene. Versuch über das Subjekt im Ausgang von Emmanuel Lévinas. In: Emanuel Lévinas – eine Herausforderung für die christliche Theologie. Hrsg. von Josef Wohlmuth. Paderborn et al.: Schöningh, 1999. S. 97-109.
Sandkaulen, Birgit:
Helmuth Plessner: Über die Logik der Öffentlichkeit. In: Internationale Zeitschrift für Philosophie. Heft 2/1994. S. 255-273.
»Was geht auf dem langen Wege vom Geist zum System nicht alles verloren«. Problematische Transformationen in der klassischen deutschen Philosophie. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 50/3 (2002). S. 363-375.
Schürmann, Volker:
Unergründlichkeit und Kritik–Begriff. Plessners Politische Anthropologie als Absage an die Schulphilosophie. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 45/3 (1997). S. 345-361.
Srubar, Ilja:
Macht und soziale Institutionalisierung. Zu Plessners Anthropologie der Macht. In: Unter offenem Horizont. Anthropologie nach Helmuth Plessner. Hrsg. von Jürgen Friedrich und Bernd Westermann. Mit einem Geleitwort von Dietrich Goldschmidt. Frankfurt am Main: Lang, 1995 (= Schriftenreihe DAEDALUS. Europäisches Denken in deutscher Philosophie Band 7). S. 299-306.
Sturma, Dieter:
Philosophie der Person. Die Selbstverhältnisse von Subjektivität und Moralität. Paderborn et al.: Schöningh, 1997.
Taureck, Bernhard:
Lévinas zur Einführung. 1. Aufl. Hamburg: Junius, 1991.
Valzania, Giotto:
Zur Philosophie von Jacobi. In: Philosophische Rundschau. Eine Zeitschrift für philosophische Kritik. Band 49 (2002). S. 156-164.
Wenzler, Ludwig:
Zeit als Nähe des Abwesenden. Diachronie der Ethik und Diachronie der Sinnlichkeit nach Emmanuel Lévinas. In: Emmanuel Lévinas: Die Zeit und der Andere. Übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Ludwig Wenzler. 3. Aufl. Hamburg: Meiner, 1995. S. 67-92.
Menschsein vom Anderen her. - Einleitung zu: Emmanuel Lévinas: Humanismus des anderen Menschen. Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Ludwig Wenzler. Anmerkungen von Theo de Boer, Adriaan Peperzak und Ludwig Wenzler. Mit einem Gespräch zwischen Emmanuel Levinas und Christoph von Wolzogen als Anhang "Intention, Ereignis und der Andere". - Hamburg: Meiner 1989. XXXVI+152 S., S. VII-XXXVI.
[...]
[1] Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft. In: Kants gesammelte Schriften. Erste Abtheilung: Werke, Fünfter Band. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Reimer, 1913. S. 87 (A 155). »Der Mensch ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in seiner Person muß ihm heilig sein. In der ganzen Schöpfung kann alles, was man will, auch bloß als Mittel gebraucht werden; nur der Mensch, und mit ihm jedes vernünftige Geschöpf, ist Zweck an sich selbst.«
[2] Martin Brasser, Einleitung. In: Person. Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart. Hrsg. von Martin Brasser. Stuttgart: Reclam, 1999. S. 26.
[3] Brasser, S. 23.
[4] Susanne Sandherr, Eine Religion für Erwachsene. Versuch über das Subjekt im Ausgang von Emmanuel Lévinas.. In: Emmanuel Lévinas – eine Herausforderung für die christliche Theologie. Hrsg. von Josef Wohlmuth. 2., verbesserte Auflage. Paderborn et al.: Schöningh, 1999. S. 109.
[5] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes. In: Werke, Band 3. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991 (= Suhrkamp–Taschenbuch Wissenschaft Bd. 603). S. 147.
[6] Vgl Ralf Konersmann, Person. Ein bedeutungsgeschichtliches Panorama. In: Internationale Zeitschrift für Philosophie Heft 2/1993, S. 23.
[7] Birgit Sandkaulen, » Was geht auf dem langen Wege vom Geist zum System nicht alles verloren.« Problematische Transformationen in der klassischen deutschen Philosophie. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 50/3 (2002), S. 374.
[8] Friedrich Heinrich Jacobi, Über die Lehre des Spinoza, in Briefen an Herrn Moses Mendelssohn . In: Werke, Vierter Band. Hrsg. von Friedrich Roth und Friedrich Köppen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. S. 72f.
[9] Sandkaulen, » Was geht auf dem langen Wege vom Geist zum System nicht alles verloren.« Problematische Transformationen in der klassischen deutschen Philosophie, S. 371.
[10] Vgl Jacobi, Über die Lehre des Spinoza, in Briefen an Herrn Moses Mendelssohn , S. 236: »Die Philosophie kann ihre Materie nicht erschaffen; diese liegt immer da in gegenwärtiger oder vergangener Geschichte.«
[11] Friedrich Heinrich Jacobi, Einige Betrachtungen über den frommen Betrug und über eine Vernunft welche nicht die Vernunft ist. An Joh. Georg Schlosser. In: Werke, Zweiter Band. Hrsg. von Friedrich Roth und Friedrich Köppen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. S. 471.
[12] So lassen Jacobis Briefe an Fichte und Kant jene »Unwissenheitslehre« bzw. »Unphilosophie« hervortreten, die natürlich die Kritik der wissenschaftsphilosophisch ambitionierten Zeitgenossen auf sich zog.
Vgl Karl Homann, F.H. Jacobis Philosophie der Freiheit. Freiburg, München: Alber, 1973. S. 159.
[13] Friedrich Heinrich Jacobi, Beilagen zu den Briefen über die Lehre des Spinoza. In: Werke, Vierter Band. Hrsg. von Friedrich Roth und Friedrich Köppen. Darsmtadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. S. 77.
[14] Friedrich Heinrich Jacobi, Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung. In: Werke, Dritter Band. Hrsg. von Friedrich Roth und Friedrich Köppen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. S. 418f.
[15] Kurt Christ, Jacobi und Mendelssohn. Eine Analyse des Spinozastreits. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1988 S. 163.
[16] Johannes Heinrichs, Dialektik oder Dialogik? In: Der Dialogbegriff am Ende des 20. Jahrhunderts. Internationale wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 225. Geburtstags von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hrsg. von Erwin Hasselberg, Ludwig Martienssen und Frank Radtke. Berlin: Hegel Institut e.V., 1996. S. 61f.
[17] Vgl Horst Folkers, Zum Begriff der Freiheit in Spinozas »Ethik«, Kants »Kritik der reinen Vernunft« und Fichtes »Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre«. In: Spinoza in der europäischen Geistesgeschichte. Hrsg. von Hanne Delf, Julius H. Schoeps und Manfred Walther. Berlin: Hentrich, 1994 (=Studien zur Geistesgeschichte Bd 16). S, 248f.
[18] Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie. Herausgegeben, eingeleitet und mit Registern versehen von Elisabeth Ströker. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1977. S. 126.
[19] Ebd., S. 131.
[20] Emmanuel Lévinas, Bibel und Philosophie (1981). In: Ethik und Unendliches. Gespräche mit Philippe Nemo. Aus dem Französischen von Dorothea Schmidt. Hrsg. von Peter Engelmann. Wien: Passagen Verlag, 1996. S. 21.
[21] Ebd.
[22] Ebd., S. 23.
[23] Uwe Bernhardt, Neue Debatten um die Ethik von Lévinas. In: Philosophische Rundschau 48 (2001). S. 316.
[24] Bernhard Taureck, Lévinas zur Einführung . 1. Aufl. Hamburg: Junius, 1991. S. 43.
[25] Emmanuel Lévinas, Humanismus und An-archie (1968). In: Humanismus des anderen Menschen. Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Ludwig Wenzler. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1989. S. 73f.
[26] Emmanuel Lévinas, Heidegger (1981). In: E thik und Unendliches. Gespräche mit Philipp Nemo, S. 28.
[27] Emmanuel Lévinas, Ohne Identität (1970). In: Humanismus des anderen Menschen , S. 94.
[28] Wolfgang Nikolaus Krewani, Diachronie und Schöpfung. In: Emmanuel Lévinas – eine Herausforderung für die christliche Theologie . Hrsg. von Josef Wohlmuth. Zweite, verbesserte Auflage. Paderborn et al.: Schöningh, 1999. S. 43.
[29] Ludwig Wenzler, Zeit als Nähe des Abwesenden. Diachronie der Ethik und Diachronie der Sinnlichkeit nach Emmanuel Lévinas. Nachwort. In: Emmanuel Lévinas: Die Zeit und der Andere. Übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Ludwig Wenzler. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1995. S. 69.
[30] Franz Rosenzweig, Das neue Denken. Einige nachträgliche Bemerkungen zum »Stern der Erlösung« (1925). In: ders: Die Schrift. Aufsätze, Übertragungen und Briefe. Hrsg. von Karl Thieme. Königstein/Taunus: Jüdischer Verlag Athenäum, 1984. S. 193.
[31] Ebd., S.188.
[32] Freilich ist Giotto Valzania darin Recht zu geben, dass humanes Handeln seinerseits nicht von einem »Erkennen« dessen loszulösen ist, was getan werden soll, und dass in der Performativität der Sprache Begründung und Handeln von Anbeginn zusammenfallen. Jacobi und die dialogische Tradition, von der hier die Rede ist, suspendieren aber just die Figur des »Erkennens« durch den Offenbarungslauben, und lassen die Absolutheit der Unterscheidung Begründung/Humanität unangetastet.
Giotto Valzania, Zur Philosophie von Jacobi. In: Philosophische Rundschau, Band 49 (2002), S. 161.
[33] Hans Martin Dober, Lévinas und Rosenzweig. Die Verschärfung der Totalitätskritik aus den Quellen des Judentums. In: Lévinas. Zur Möglichkeit einer prophetischen Philosophie. Hrsg. von Michael Mayer und Markus Hentschel. Gießen: Focus Verlag, 1990 (=Schriftenreihe Parabel des Evangelischen Studienwerks Band 12). S. 146.
[34] Stephane Mosès, System und Offenbarung. Die Philosophie Franz Rosenzweigs. Mit einem Vorwort von Emmanuel Lévinas. Aus dem Französischen von Rainer Rochlitz. München: Wilhelm Fink Verlag, 1985 (=Schriftenreihe Übergänge Band 11). S. 84.
[35] Dober, S. 148.
[36] Emmanuel Lévinas, Die Bedeutung und der Sinn (1972). In: ders.: Humanismus des anderen Menschen, S. 53.
[37] Wenzler, Zeit als Nähe des Abwesenden. Diachronie der Ethik und Diachronie der Sinnlichkeit nach Emmanuel Lévinas, S. 81.
[38] Byung-Chul Han: Über die Aneignung. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken Heft 11 (November 2003), S. 1060.
Han ist allerdings nicht zuzustimmen, wenn er das von Lévinas ins Spiel gebrachte Désinteressement für unplausibel hält, weil es »in ein kaltes Desinteresse umschlagen« könne (Ebd). Lévinas´ ohnehin idiosynkratischer Sprachgebrauch meint hier wohl den Umschlagspunkt von den Seinsvollzügen des Selbst zu einem gelingenden »Sein für den Anderen«, nicht aber die Negation von »Interesse« als einer ethischen Verhaltensform.
[39] Ebd.
[40] Ludwig Wenzler umschreibt die diversen paradoxalen Denkfiguren bei Lévinas als eine »Phänomenologie des Unsichtbaren«, in dem Erscheinendes (wie etwa das Gesagte oder vor allem das Antlitz des Anderen) auf ein Tieferes zurückweist, ohne es zugleich als sein Prinzip in Anspruch nehmen zu können. Ludwig Wenzler, Menschsein vom Anderen her . In: Emmanuel Lévinas: Humanismus des anderen Menschen, S. XXIV.
[41] Von diesem unendlichen Urheber können wir allerdings kaum sagen, er sei uns immer schon einen Schritt voraus, denn das Verhältnis zum Unendlichen ist eben atemporal und unbewegt. In dieser Hinsicht ist Lévinas´ Metapher der Spur also keineswegs zwingend.
[42] Emmanuel Lévinas, Totalität und Unendlichkeit. Zitiert nach: Person. Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, S. 149.
[43] Emmanuel Lévinas, Jenseits des Seins. Zitiert nach: Person. Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, S. 150.
[44] Emmanuel Lévinas, Bemerkungen über den Sinn. Zitiert nach: Person. Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, S. 148.
[45] Lévinas, Bibel und Philosophie, S. 24.
[46] Ebd, S. 22.
[47] Ebd.
[48] Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Hrsg. von Günter Dux et al. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. S. 60.
[49] Ebd.
[50] Das Moment des Transzendentalen hat bei Plessner allerdings nicht-traditionelle Züge. Gemeint ist eine Analyse der Ermöglichung menschlicher Selbstverständigung im Ausgang von der naturphilosophisch zu bestimmenden Spezifik menschlichen Lebens. Gemeint ist nicht die Apriorität subjektiver Reflexionsbedingungen, die der Erkenntnis von Seiendem vorausgesetzt sind.
[51] Hans Heinz Holz, Die Systematik der Sinne. In: Unter offenem Horizont. Anthropologie nach Helmuth Plessner. Hrsg. von Jürgen Friedrich und Bernd Westermann. Mit einem Geleitwort von Dietrich Goldschmidt. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang Verlag, 1995 (=DAEDALUS: Europäisches Denken in Deutscher Philosophie Band 7). S. 120.
[52] Ebd.
[53] Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie , S. 219.
[54] Ebd., S. 296.
[55] Ebd., S. 296f.
[56] Ebd. S. 360.
[57] Ebd.
[58] Ebd., S. 365.
[59] Ebd., S. 372.
[60] Ebd, S. 374.
[61] Ebd., S. 377f. (Hervorhebung von mir, Anm. d. Verf.)
[62] Markus Hundeck, »Conatus essendi« und »inkarniertes Subjekt«. Ein inszenierter Dialog zwischen Baruch de Spinoza und Emmanuel Lévinas. In: Emmanuel Lévinas – eine Herausforderung für die christliche Theologie, S. 134.
[63] Birgit Sandkaulen, Helmuth Plessner: Über die »Logik der Öffentlichkeit«. In: Internationale Zeitschrift für Philosophie. Heft 2/1994. S. 269. Birgit Sandkaulen vermerkt kritisch gegen Plessner, dass die Umfundierung des anthropologischen Gesetzes natürlicher Künstlichkeit (Stufen) in die gesellschaftliche Sphäre, d.h. den Geist (Macht und menschliche Natur), «das Individuum als solches« (S. 271) wertrelativistisch in eine das Politische konstituierende Freund–Feind–Differenz hypostasiert. Plessner war es demgegenüber aber um die Profilierung einer methodischen Unergründlichkeit zu tun, die zwar der Exklusivität des Eigenen sowohl als des Anderen entgegenläuft, aber als Methode absolut gelten will.
[64] Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, S. 378.
[65] Ebd.
[66] Ebd., S. 382 (Hervorh. d. Verf.).
[67] Dieter Sturma, Philosophie der Person. Die Selbstverhältnisse von Subjektivität und Moralität. Paderborn et al.: Schöningh, 1997. S. 309.
[68] Ebd.
[69] Emmanuel Lévinas, Die Zeit und der Andere, S. 51.
[70] Hans Peter Krüger, Zwischen Lachen und Weinen II: Der dritte Weg Philosophischer Anthropologie und die Geschlechterfrage. Berlin: Akademie Verlag, 2001. S. 105.
[71] Ilja Srubar, Macht und soziale Institutionalisierung. Zu Plessners Anthropologie der Macht. In: Unter offenem Horizont. Anthropologie nach Helmuth Plessner, S. 300.
[72] Ebd.
[73] Kai Haucke, Das Unverfügbare und die Unantastbarkeit der Würde. Habermas, die Bioethik und Plessners philosophische Anthropologie. In: Philosophische Rundschau Band 49 (2002), S.172.
[74] Helmuth Plessner, Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht. In: Gesammelte Schriften Band V. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. S. 149.
[75] Helmuth Plessner, Homo absconditus (1969). In: Gesammelte Schriften Band VIII. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. S. 359.
[76] Volker Schürmann, Unergründlichkeit und Kritik–Begriff. Plessners Philosophische Anthropologie als Absage an die Schulphilosophie. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 45/3 (1997), S. 353.
[77] Plessner, Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht, S. 225f.
[78] Lévinas, Die Zeit und der Andere, S. 55 (Hervorh. d. Verf.).
[79] Emmanuel Lévinas, »Die Menschheit ist biblisch«. In: Jüdisches Denken in Frankreich: Gespräche mit Pierre Vidal–Naquet, Jacques Derrida, Rita Thalmann, Emmanuel Lévinas, Léon Poliakov, Jean–Francois Lyotard, Luc Rosenzweig. Hrsg. und übersetzt von Elisabeth Weber. Frankfurt am Main: Jüdischer Verlag, 1994. S. 121.
[80] Ebd.
[81] Plessner, Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht, S. 220.
[82] Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, S. 424f.
- Quote paper
- Thomas Ebke (Author), 2004, Homo absconditus. Das Motiv der unergründlichen Person in den Schriften von Friedrich Heinrich Jacobi, Emmanuel Lévinas und Helmuth Plessner, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108509