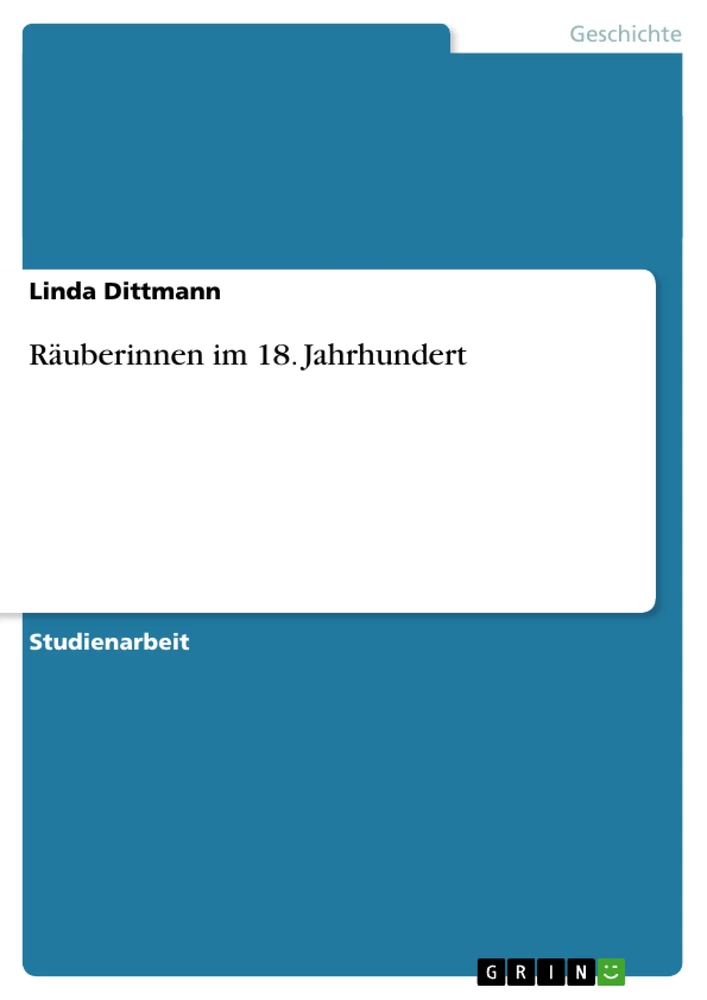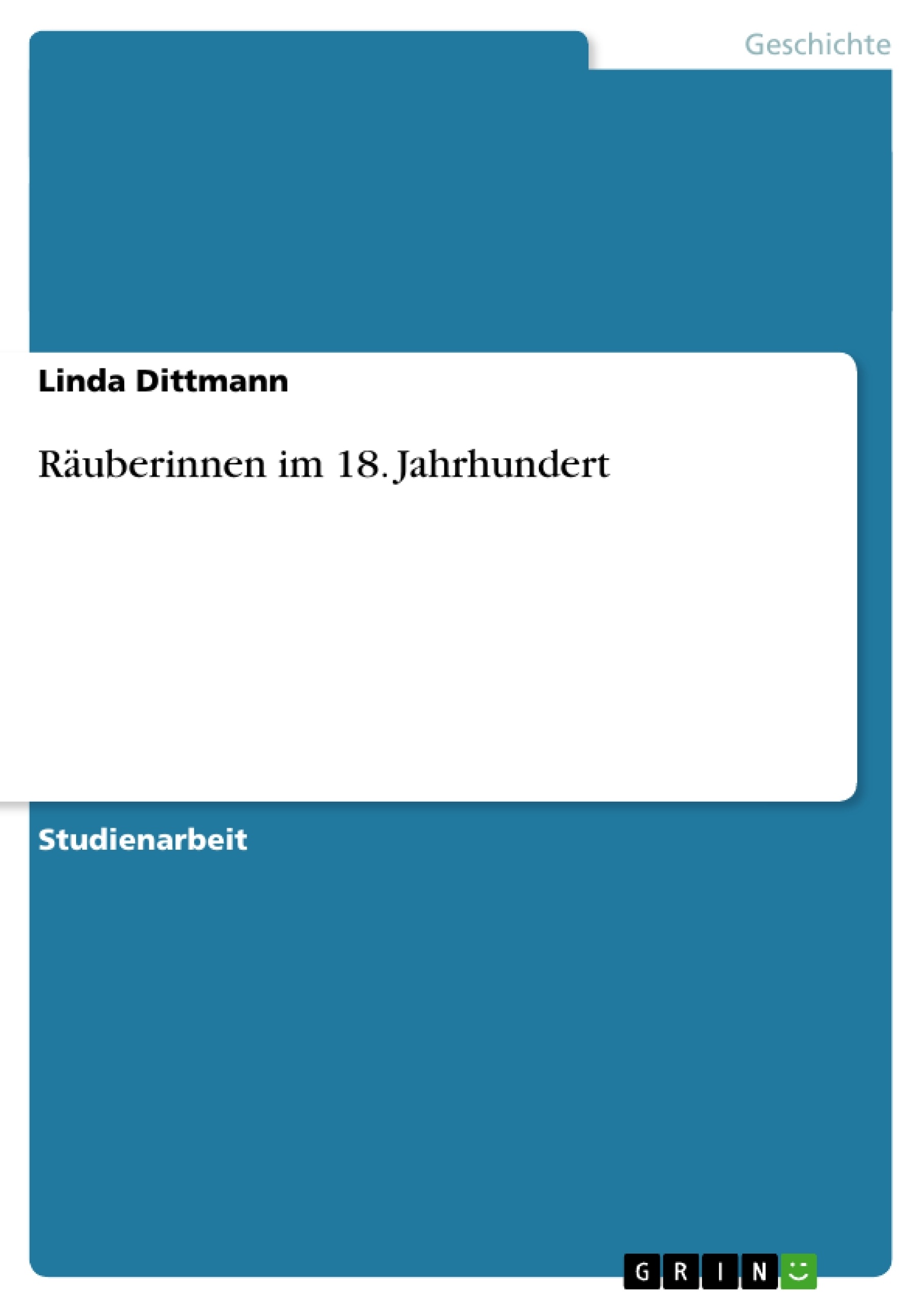Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das romantische Ideal des Räuberlebens auf die harte Realität der Armut und Kriminalität trifft. Diese fesselnde Analyse entführt Sie in das Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts, um das verborgene Leben der Räuberinnen zu enthüllen – Frauen, die oft gezwungen waren, in einer von Männern dominierten Welt zu überleben. Jenseits von Legenden und Mythen erkundet dieses Buch die wahren Beweggründe, die diese Frauen in die Arme des Gesetzes trieben, von bitterer Armut und sozialer Ausgrenzung bis hin zu rechtlichen Hürden und dem Wunsch nach Freiheit. Entdecken Sie die vielschichtigen Rollen, die sie in Räuberbanden spielten: Kundschafterinnen, Schmugglerinnen, Hehlerinnen und Versorgerinnen, die oft das Rückgrat der kriminellen Organisation bildeten. Doch war ihr Leben wirklich von Gleichberechtigung geprägt? Tauchen Sie ein in die düstere Realität von Gewalt, Ausbeutung und den ständigen Kampf ums Überleben. Anhand von historischen Dokumenten, Verhörprotokollen und Fallstudien, darunter das erschütternde Schicksal der berüchtigten Alten Lisel, wird ein authentisches Bild dieser faszinierenden und tragischen Figuren gezeichnet. Erforschen Sie die Bedeutung von Kleidung als Werkzeug zur Tarnung und zum Rollenwechsel, und enthüllen Sie die komplexen psychologischen und sexuellen Motive, die hinter der Wahl von Männerkleidung stecken könnten. Dieses Buch ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in der Kriminalitätsgeschichte, ein unvergessliches Porträt von Überlebenswillen, Widerstandsfähigkeit und dem unerbittlichen Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. Es bietet neue Perspektiven auf die Geschlechterrollen, die Ursachen von Kriminalität und die oft übersehenen Geschichten derer, die am Rande der Gesellschaft lebten. Eine packende Lektüre für alle, die sich für Geschichte, Kriminologie und die verborgenen Seiten der menschlichen Existenz interessieren.
Inhalt
1. Einleitung
2. Mythos Räuberinnen
3. Grausame Realität der Räuberinnen
3.1 Gründe für ein Leben als Räuberin
3.2 Die Rolle der Frau in einer Räuberbande
3.3 Kleidung – wichtiges Attribut einer Räuberin
3.4 Gleichberechtigung der Frau
3.5 Fahndung und Bestrafung
4. Die Alte Lisel – das Leben einer Räuberin
5. Schluß
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Sicherlich kennt jeder Räuberfilme wie „Robin Hood“, hat das Buch „Ronja, Räubertocher“ gelesen oder als Kind Räuber und Gendarm gespielt. In welcher Art auch immer, kaum einer hat sich nicht schon einmal in das Leben eines Räubers hineinversetzt - das romantische Leben, versteckt in Höhlen, im Wald oder auf Baumhäusern, immer der Gefahr ins Auge sehen; man nimmt den Reichen und gibt den Armen. Doch hat das Leben einer Räuberbande wirklich so ausgesehen? Welche Rolle spielen die Frauen in dieser Thematik? Sind sie so mutig und kühn, wie in Astrid Lindgrens „Ronja, Räubertochter“? Sind sie Räuberbräute – schön und begehrenswert? All diese Fragen sollen in der folgenden Arbeit betrachtet werden. Zunächst soll geklärt werden, ob die Räuberinnen tatsächlich ein abenteuerliches Leben geführt haben, wie es in der Trivialliteratur oft geschildert wird. Anhand von Verhörprotokollen und Fachliteratur versuche ich darzustellen, wie die Frauen in Räuberbanden des 18. und 19. Jahrhunderts lebten. In diesem Zusammenhang müssen natürlich auch die Ursachen genannt werden, warum Frauen kriminelle Handlungen ausführten. Frauen, die einer Räuberbande angehörten, mussten ganz bestimmte Aufgaben und Funktionen übernehmen. Diese Funktionen werden in Punkt 3.2 näher erläutert.
Leider gibt es kaum schriftliche Überlieferungen von Frauen die in Räuberbanden agierten. Die wenige Literatur, die sich mit diesem Thema beschäftigt, hat ihre Erkenntnisse aus Verhörprotokollen, Schublisten und Geständnissen. Meine Arbeit bezieht sich auf folgende Werke: „Die grossen Räuberinnen“ von Boehncke, Hindemith und Sarkowicz, „Sackgreifer und Beutelschneider. Die Diebesbande der Alten Lisel, ihre Streifzüge um den Bodensee und ihr Prozeß 1732“ von Andreas Blauert. Außerdem waren mir noch die Aufsätze von Monika Machnicki, „Sie trug stets das Brecheisen unter dem Rock“ und von Wolfgang Scheffknecht, „Arme Weiber“ hilfreich.
Da sich die Literatur von Blauert mit der Diebesbande um die Alte Lisel beschäftigt und daher sehr ausführlich ist, wird am Ende meiner Arbeit das Leben der Alten Lisel ein abrundendes Beispiel für die Thematik meiner Arbeit sein.
2. Mythos Räuberinnen
Wunderschön sind sie, intelligent und sie besitzen eine erotische Anziehungskraft, denen Männer nur sehr selten widerstehen können. Die Räuberbraut in der Literatur verführt die Bandenmitglieder und wechselt somit ständig die Partner[1]. Schenkt man der romantisierenden Literatur Glauben, so trugen sie häufig Männerkleidung. Durch diesen Rollenwechsel konnten sie an Seite ihres Liebsten unerkannt bleiben oder sicher auf Reise gehen, manchmal war es auch „das patriotische Motiv der Soldatinnen“[2], welches sie in die Männerrolle schlüpfen ließ. In den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts fand die Literatur über Räuber und Banditen großen Zuspruch, besonders bei den weiblichen Leserinnen. So wurden den männlichen Räubern, die in der bisherigen Trivialliteratur schon erfolgreich waren, weibliche Begleiter oder Gegenstücke zugesprochen[3].
Allerdings, wie es in „Die großen Räuberinnen“ beschrieben wird: „das Räuberleben war nie romantisch, sondern immer nur grausam, für die Überfallenen ebenso wie für die, die damit ihren Lebensunterhalt verdienten.“[4].
3. Grausame Realität der Räuberinnen
Wenn man an die grausame und brutale Vorgehensweise von Räuberbanden im 18. Jahrhundert denkt, kann man sich nur kaum vorstellen, dass auch Frauen Teil dieser Banden gewesen sein sollen. Dies scheint sich auch in einigen Statistiken widerzuspiegeln. So sollen am Ende des 17. Jahrhunderts, in Salzburg 70% der Bettler männlich gewesen sein[5]. Dennoch widerlegt Scheffknecht diese These mit folgenden Beispielen und Zahlen: Eine Schubliste aus dem Jahre 1793 aus Bludenz weist von 57 aufgegriffenen, vagierenden Erwachsene 31 als weiblich auf. Dies bedeutet, dass mehr als 54% Frauen waren. Als weiteres Beispiel sind Listen aus Lustenau zu nennen. Auch hier ist der Anteil an aufgegriffenen Frauen höher (63,5%)[6]. Jedoch räumt Scheffknecht ein, dass diese Zahlen nur von Schublisten stammen, also nicht allgemein gesehen werden können. Hier gelten die Zahlen nur für Vagantinnen, die aufgegriffen wurden und nicht für die Frauen, die fliehen konnten. Außerdem muss noch berücksichtigt werden, dass „Mitglieder von Räuberbanden […] nicht leicht aufzugreifen“ waren[7]. Somit ist nicht klar, in welcher Anzahl Frauen unter den schwerkriminellen aufzufinden waren. Hier nennt Scheffknecht eine Prozentzahl von 46,5. Aber auch diese Zahl ist nicht als zuverlässig anzusehen. Er geht davon aus, dass der Anteil höher gewesen sein muss, denn auch die Ehefrauen und Geliebten streiften mit den Banden von Ort zu Ort. Da sie nicht unbedingt „wegen krimineller Delikte aufgefallen waren“[8] und somit nicht aktenkundig gewesen sind, waren sie auch nicht auf den Listen zu finden[9].
3.1 Gründe für ein Leben als Räuberin
Im vorhergehenden Abschnitt wurde schon verdeutlicht, dass ein großer Anteil von Räubern im 18. Jahrhundert weiblich war. Doch was brachte Frauen dazu, zu Stehlen, Rauben und, im schlimmsten Fall zu Morden? Zum einen war natürlich die Armut ein Hauptgrund dafür[10]. Zum anderen waren Vaganten auf der untersten Gesellschaftsschicht und somit kaum in der Lage, ein nach den im 18. Jahrhundert moralischen Ansichten geregeltes Leben zu führen. Hiermit war das Abrutschen in die Kriminalität, um sein Leben zu erhalten, vorbestimmt[11]. Frauen hatten natürlich weniger Möglichkeiten als Männer, Arbeit zu finden[12]. Hierzu kommt, dass Frauen schlechter bezahlt wurden, wenn sie denn Arbeit hatten[13]. Das bedeutet also, dass Frauen in der Regel ärmer waren als Männer. Eines der häufigsten Gründe, warum Frauen in kriminelle Schichten absanken, waren die rechtlichen Bestimmungen, die eine Heirat bzw. Ehe betrafen. Eine von der Obrigkeit genehmigte Heiratserlaubnis war die Vorraussetzung für eine Eheschließung. Außerdem musste ein von der Obrigkeit angegebenes Vermögen vorhanden sein, um eine Ehe abschließen zu können[14]. Junge Mädchen, die unehelich Kinder gebaren, mussten damit rechnen, dass sie dem Lande verwiesen wurden[15]. In „Die grossen Räuberinnen“ wird verdeutlicht, wie solch ein Schicksal ablaufen kann. Wenn die Eltern eines armen Mädchens starben und diese junge Frau somit allein und ohne Verwandte war, zudem auch noch schwanger wurde, war sie dem vagierenden Leben verdammt. Da außereheliche Schwangerschaften, wie schon erwähnt, Strafen mit sich zogen, musste das Mädchen für gewöhnlich ihr letztes Eigentum dem Gericht hinterlassen und wurde dem Dorf verwiesen. Wenn sie denn noch Arbeit hatte, konnte sie auch hier nicht mit Hilfe rechnen. Dem Mädchen wurde somit jegliche Möglichkeit genommen, wieder Fuß zu fassen[16]. Hier wird auch dargestellt, dass dieser Werdegang relativ häufig vorkam. Zu dem Teil der Vagantinnen, die aus sozialen Gründen in die kriminellen Schichten abrutschten, kommt natürlich auch noch der Teil an Räuberinnen, die in dieses Leben hineingeboren und erzogen wurden.
3.2 Die Rolle der Frau in einer Räuberbande
In einer Räuberbande waren die Rollen meist klar verteilt oder wie Scheffknecht ausdrückt: „Hier läßt sich eine grobe „Arbeitsteilung“ nach Geschlechtern feststellen.“[17]. Tatsächlich war es so, dass das Rauben Männersache war. Allerdings muss in diesem Zusammenhang auch verdeutlicht werden, dass eine Räuberbande kaum überlebt hätte, wären da nicht die Frauen gewesen. Frauen waren grundlegend dafür zuständig, die Bande über Wasser zu halten, wenn es gerade keine Gelegenheiten für Raubzüge gab[18]. Dies geschah dann durch Markt- und Taschendiebstahl, Betteln, Sackgreifen und Prostitution[19]. Eine weitere Aufgabe war natürlich die Versorgung der Kinder, die in der Bande mitgeführt wurden[20]. Allerdings kam es auch häufiger vor, dass Frauen aktiv an Raubzügen teilnahmen. Dies geschah, wenn nicht genügend Männer zur Verfügung standen. Frauen übernahmen dann die Rolle des Wachehaltenden und waren dafür verantwortlich, dass die Ware sicher vom Diebesort entfernt wird. Das hatte auch noch einen entscheidenden Vorteil, denn „eine mit Wäsche oder Stoff bepackte Frau [war] weitaus unauffälliger […] als eine ähnlich ausstaffierte Männerschar.“[21]. In der Regel hatte die Frau in einer Bande aber nichts mit dem eigentlichen Akt des Raubens zu tun. Wenn ein Raub zu planen war, hatte die Frau ganz andere Funktionen - sie regelte die Vor- und Nacharbeit. Die Vorarbeit begann damit, herauszufinden wo es sich zu Rauben lohnte. Die Frau konnte sich meist frei bewegen und Informationen beschaffen, was für die männlichen Mitglieder der Banden oft unmöglich war, denn sie wurden gesucht und mussten sich verstecken. So legten die Frauen den Grundstein für einen Diebeszug. Damit war allerdings die Arbeit für die weiblichen Bandenmitglieder noch nicht getan. Nach dem Raubzug musste die Ware auch noch gewinnbringend an den Mann gebracht werden. Diese Aufgabe übernahmen natürlich die Frauen, denn wie eben schon dargestellt, konnten sie sich freier bewegen[22]. Genauso wichtig, wie die Vor- und Nacharbeit von Überfällen und Raubzügen ist die Funktion des Schmuggelns, wenn Mitglieder der Bande inhaftiert wurden. Dies war Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts noch recht einfach für die Frauen, denn ein Passwesen, wie wir es heute kennen, gab es zu jener Zeit noch nicht. So konnte man vorgeben, die Schwester oder Ehefrau des Inhaftierten zu sein. Wurde den Damen trotz alledem ein Besuch verweigert, haben sie durch Bestechung doch das Ziel erreicht. Bei dem Gefangenen angekommen, versorgten sie die Inhaftierten mit Ausbruchswerkzeug und Nachrichten der Außenwelt[23]. Ohne die Arbeit und das Informationsnetz der Frauen, wären sicherlich wesentlich mehr Bandenmitglieder inhaftiert bzw. exekutiert wurden. Nicht nur, dass die Frauen Kundschafter- und Schmuggeldienste übernahmen, als die Räuber schon längst gefangen waren, sie wollten dieses im Vorhinein schon ausschließen. Sie versuchten Kontakte zu Polizisten aufzubauen und deren Vertrauen zu gewinnen, um von denen herauszufinden, wann eine Durchsuchung anstehen könnte. Eine wichtige Aufgabe in diesem Zusammenhang war auch, dass die Frauen den inhaftierten Kameraden Alibis verschafften[24]. Bei diesen ganzen Maßnahmen, war es nicht verwunderlich, dass die Gefangenen oft schnell wieder auf freiem Fuß waren. Ob durch geschmuggeltes Werkzeug oder falsche Alibis, die Frauen sorgten dafür, dass die gefangenen Kameraden nicht lange inhaftiert waren.
Obwohl die Bandenstruktur meist so aussah, dass Frauen die oben genannten Aufgaben hatten und die Männer die leitende Positionen einnahmen, gab es durchaus Räuberbanden, bei denen Frauen das Sagen hatten oder wo die Gruppe nur aus weiblichen Mitgliedern bestand[25]. Hier sind einige Gruppen zu nennen, wie zum Beispiel die Gruppe um Barbara Waldnerin und Magdalena Kriegin oder Margaretha Böckin, die mit Anna Waldvögtin agierte. Diese Gruppen verübten die üblichen Verbrechen, wie Markt- und Taschendiebstahl. Margaretha Böckin betätigte sich noch der Prostitution und nahm an Einbrüchen teil. Jedoch waren im größten Teil nur Frauen die Opfer dieser Banden. Anna Maria Rickin, die Schwester von Magdalena Kriegin, soll 66 Marktdiebstähle getätigt haben, aber nicht ein einziges mal soll ein männliches Opfer dabei gewesen sein. Das hatte auch Gründe, denn unter Frauen fielen die Diebinnen weniger auf, als unter Männern[26]. Elisabetha Gaßner, auch Schwarze Lies genannt, ist jedoch ein Beispiel, dass Frauen auch Männer bestahlen[27]. Eine der bekanntesten Räuberin, die den Ton in einer Bande angab, ist Elisabetha Frommerin, die Alte Lisl gewesen, auf dich ich später aber noch genauer eingehen werde.
3.3 Kleidung – wichtiges Attribut einer Räuberin
Da Frauen für den Markt- und Taschendiebstahl zuständig waren, mussten sie natürliche auch Stauraum haben, wo sie ihr Diebesgut sicher unterbringen konnten. Dafür war der Rock gedacht – ein „Spezial-Rock […], der „als Magazin“ eingerichtet war […] Gewöhnlich werden zwei Unterröcke zur Gole zusammengenäht und vorn im faltenreichen Oberkleide und im Unterrock wird ein langer Schlitz gelassen, um die Ware einstecken zu können.“[28]. Allerdings kam es auch vor, dass Frauen in die Rolle der Männer schlüpften, indem sie Männerkleidung trugen. So soll Julie Blasius einmal mit ihrem Gelieben, den Schinderhannes, in Männerkleidung an einem Raubzug teilgenommen haben[29]. Nicht nur ein Rollenwechsel bei einem Diebeszug könnte Grund gewesen sein, dass Frauen Männerkleidung trugen. Sicherlich sind auch die romantisierenden Gründe, die in Punkt 2 genannt wurden, vorhanden gewesen, warum Frauen sich der Kleidung von Männern betätigten. Jedoch wird die ausschlaggebende Leitgedanke jener gewesen sein, sich vor der Prostitution zu schützen. Machnicki nennt aber auch noch einen weiteren Grund, nämlich dass es auch noch „tieferliegende psychologische und sexuelle Motive“ gegeben haben muss. Die Männerverkleidung gab lesbischen Frauen die Möglichkeit, ihre Vorlieben ausleben zu können[30].
3.4 Gleichberechtigung der Frauen
Bei einigen italienischen Räuberbanden könnte man von einer Gleichberechtigung unter den Bandenmitgliedern ausgehen, denn die Brigantessen, die italienischen Räuberinnen, waren immer gleich den Männern gekleidet und wie diese bewaffnet […], [mussten] aber außer dem Nähen keine andern Frauendienste verrichten. Gekocht wird immer von den Männern. Die Brigantinnen sind in der Regel selbstständige Glieder der Bande, wie die Männer, und zeigen nicht selten mehr Mut und Ausdauer als diese[31]
In den deutschen Räuberbanden ging es, wie geschildert nicht so gleichberechtigt zu. Die Frauen trugen selten Waffen, keine Männerkleidung und waren auch weniger an den Raubzügen beteiligt. Dennoch hörten die Männer auf die Frauen, wenn es um das Planen eines Einbruches ging[32]. Inwiefern Frauen in den Banden misshandelt, vergewaltigt oder gar getötet wurden, wird nicht ganz klar, denn in „Die grossen Räuberinnen“ wird beiderlei Situationen beschreiben. So sollen:
Mißhandlungen von Frauen bis hin zum Mord […] in Räuberbanden fast an der Tagesordnung [gewesen sein]. Manche Männer hatten gleich mehrere „Beischläferinnen“ oder trieben sich in Bordellen herum, wo sie das Geraubte in wenigen Tagen verjubelten. Frauen galten fast als persönlicher Besitz und wurden nicht selten von Räuber zu Räuber weitergereicht.[33]
An andere Stelle wird genau das Gegenteil berichtet, da soll sexuelle Freizügigkeit eher selten gewesen sein. Vergewaltigungen von Frauen in der Bande und Frauen bei Überfällen waren gar nicht gern gesehen[34]. Dennoch gab es Frauen, die gewisse „Macht“ über die Männer hatten. So auch Christina Schettinger, diese war wunderschön und konnte Friedrich Schwahn so beeinflussen, dass dieser sogar ihren Bruder erschießt[35]. Abschließend zu dieser Thematik lässt sich folgendes Zitat von Hermann Bettenhäuser einbetten:
Die weiblichen Mitglieder sind regelmäßig die unglücklichsten und elendesten Geschöpfe der Bande. Sind sie einmal in dieses Milieu hineingeraten, ist ein schnelles Absinken auf die unterste Stufe der Prostitution unvermeidlich; sie sind Sklavin und Packesel eines rohen, häufig trunksüchtigen Kerls, geschätzt solange sie jung und kräftig sind, aber schnell verstoßen und damit dem Elend ausgeliefert, sobald sie aus irgendeinem Grunde lästig werden. Mitunter werden zwischen männlichen und weiblichen Bandenmitgliedern Ehen geschlossen; das dient aber vorzugsweise dazu, bei polizeilichen Kontrollen einen möglichst ehrbaren Eindruck zu machen. Respektiert wird diese Bindung nie, meist herrscht in der Bande Promiskuität.[36]
3.5 Fahndung und Bestrafung
In den Steckbriefen und Protokollen von Verhörungen, wurde sehr viel Gewicht in die äußere Beschreibung gelegt, da die Frauen meist durch Narben und andere Verkrümmelungen gebrandmarkt waren[37]. Sie werden folgendermaßen beschrieben: „Liselj, N. auß dem Schwabenland, in 40 Jahren, kurtz und gemeiner Taille, rund und bleiches Angesicht, schwartz Haubt = Haar, streicht den Märckten nach, kommt Schwäbisch gekleidet, und hat zwey Kinder.“[38] Um auf eine Liste zu kommen, war nicht einmal eine kriminelle Tat notwendig, oftmals reichte es schon aus „rote Haare“ zu haben, oder mit ihren Mann aufgefasst zu werden[39]. Wenn die Frauen gefangen wurden, mussten sie allerdings nur selten mit einer Todesstrafe rechnen. Meist wurden sie in Zuchthäuser gesteckt, was einem Tode, bei dem Zustand der Gefängnisse gleichzusetzen war[40]. Oft wurden die Frauen aber auch an den Pranger gestellt und gebrandmarkt.
4. Die Alte Lisel – das Leben einer Räuberin
Dem Schicksal einer Brandmarkung konnte auch Elisabetha Frommerin nicht entgehen. Die Alte Lisl, wie sie auch genannt wurde, war „Kopf und Herz“ einer Diebesbande[41]. Im Alter von 40 Jahren wurde sie endgültig geschnappt und zum Tode verurteilt. Man hat sie angeklagt als Beutelschneiderin, Marktdieben und Sackgreiferin[42]. Die Alte Lisel ist zwar schon öfters erwischt wurden, doch sie ist immer wieder mit einem blauen Auge bzw. mit einer gekürzten Nase davon gekommen. Sie wurde in Chur bei einem Diebstahl gefasst, da sie vor der Tat zuviel Weit getrunken hat. Obwohl man die Alte Lisel acht Tage verhört hat, konnte man ihr nur den misslungenen Diebstahl, den sie im Rausch verübt hatte nachweisen. An den Pranger wurde sie gestellt und man hat ihr die Nase gekürzt. Hätte man ihr noch weite Diebstähle nachweisen könne, wäre die Strafe ganz sicher härter ausgefallen[43]. Die Alte Lisel saß auch schon 15 Wochen in Sigmaringen in Haft, wo ihr aber die Flucht gelang[44]. Noch länger musste sie in Buchloe verharren, wo sie mit ihrer 15 jährigen Tochter Columbina Knoblocherin inhaftiert war. Columbina Knoblocherin ist die Tochter ihres ersten Mannes, Andreas Knoblocher, ein Falschspieler. Die Lisel wurde nach zwei Jahren von ihm verlassen. Lorentz Guenther, der Vater von Eva Maria, Lisel’s zweite Tochter, wurde in Horb hingerichtet. Aber die Lisel war nicht lang allein. Der Geiger Stöffele war für einige Jahre ihr Begleiter. Aus dieser Beziehung stammen ihre Söhne, Victor und Franz. Da der Geiger Stöffele ein weitbekannter Dieb war, wurde auch er hingerichtet[45]. So kam es, dass sie Thomas Schidenhalm kennen lernte, der sie bis zu ihrer letzten Verhaftung begleitet. Dieser war wesentlich jünger als die Lisel. Er war ca. 26 Jahre alt und die Lisel muss um die 40 Jahre gewesen sein. Laut Blauert kam dieser „Altersunterschied […] im Gaunermilieu des 18. Jahrhunderts durchaus häufig vor. […] Solche Altersunterschiede hatten natürlich ein unterschiedliches Maß an Lebenserfahrung zur Folge, über das die betreffende Person verfügen konnte.“[46]. Diese Tatsache lässt natürlich vermuten, dass die Lisel die Anführerin dieser Bande gewesen sein muss. Obwohl sich ständig andere Gauner zu der Bande von der Alten Lisel gesellten und auch wieder verließen, waren Columbina, Anna Meyle, Lisels Magd, und Thomas Schidenhalm Lisel’s ständige Begleiter. 1731 kam dann noch der Tüpflete Hans zu der Bande[47].
Auch hier scheint es einen Konflikt zwischen Mann und Frau in der Bande gegeben zu haben, denn Columbina erwähnte bei Verhören, dass der Thomas Schidenhalm Columbina und die Alte Lisel geschlagen haben soll. Außerdem habe er oft das Geld beim Trinken und Spielen ausgegeben[48]. Generell ist es auch hier der Fall, dass die Frauen auch „Frauenarbeit“ machten. Das heißt also, dass auch die Frauen in der Bande der Alten Lisel Geld mit Taschen- und Marktdiebstählen verdienten[49]. „Sie stahlen Stoff, Schmuck, Kleidung, Rosenkränze und immer wieder Geld. Das Geschick der Frauen war beachtlich.“[50] Die Pelze, Stoffe, Leder und Kleiderstücke, welche entwendet wurden, hatte man entweder selber getragen oder an ein einen Hehler weiterverkauft.
So zogen sie von Stadt zu Stadt, Tag ein Tag aus, bis zu einem unheilsvollen Mittwochmorgen. Die Gruppe hatte gerade Unterschlupf in Gailingen gefunden, als sie die Nachricht ereilte, dass sich eine Polizeistreife näherte. So schnell sie konnten, packten sie ihre Diebesbeute zusammen und versuchten zu fliehen. Allerdings wurde die Gruppe nach einer regelrechten Hetzjagd von einer 15-köpfigen Streife festgenommen. Obwohl die Lisel bei den Verhören hartnäckig war und alles abstritt, konnte sie nach 5 Monaten Verhörung nicht mehr standhalten. Lisel wurde mit den Aussagen von Columbina und Thomas konfrontiert und brach zusammen, sie konnte ihre Taten nicht mehr leugnen. So wurde die Alte Lisel am 17.August 1732 gehängt.
5. Schluß
Man kann also davon ausgehen, dass das Leben einer Räuberin durchaus nicht so abenteuerlich und romantisch war, wie es in der Trivialliteratur allzu gern darstellt wird. Die Frauen waren meist gezwungen zu Stehlen, um sich über Wasser zu halten. Sind sie einmal abgerutscht in die unterste soziale Gesellschaftsschicht, so waren sie im Teufelskreis gefangen. Dann blieb ihnen kaum etwas anderes übrig, als sich einer Räuberbande anzuschließen. Hier waren sie ein wichtiger Grundbaustein, sie organisierten, führten Kurierdienste aus, fungierten als Hehler, planten Raubzüge, versorgten die Kinder und ernährten die Banden durch Diebstähle und Bettelein, wenn die Männer keine Raubzüge unternehmen konnten. Obwohl sie eine wichtige Rolle in der Bandenlogistik übernahmen und für den Unterhalt sorgten, konnten man die Frauen in einer Räuberbande nicht beneiden, denn sie wurden von ihren Männern geschlagen und vergewaltigt.
6. Literaturverzeichnis
Blauert, Andreas, Sackgreifer und Beutelschneider. Die Diebesbande der Alten Lisel, ihre Streifzüge um den Bodensee und ihr Prozeß 1732. Konstanz 1993
Boehncke, Heiner/Hindemith, Bettina/ Sarkowicz, Hans, Die grossen Räuberinne – „Und wenn der Kopf fällt, sag ich hoppla“. Frankfurt/M. 1994 (Heyne Bücher)
Machnicki, Monika, „Sie trug stets das Brecheisen unter dem Rock“ – aber hat sie es auch benutzt?. Zur Rolle der Frauen in den Räuberbanden des 18. und 19. Jahrhunderts, in: Siebenmorgen, Harald (Hrsg.), Schurke oder Held? Historische Räuber und Räuberbanden. Sigmaringen 1995 (Volkskundliche Veröffentlichungen des Badischen Landesmuseums Karlsruhe 3).
Scheffknecht, Wolfgang, Arme Weiber – Bemerkungen zur Rolle der Frau in den Unterschichten und vagierenden Randgruppen der frühneuzeitlichen Gesellschaft, in: Niederstätter, Alois (Hrsg.), Hexe oder Hausfrau. Das Bild der Frau in der Geschichte Vorlarbergs, Sigmaringendorf 1991
[...]
[1] Machnicki, Monika, „Sie trug stets das Brecheisen unter dem Rock“- aber hat sie es auch benutzt?, Zur Rolle der Frauen in den Räuberbanden des 18. und 19. Jahrhunderts, in: Siebenmorgen, Harald (Hrsg.), Schurke oder Held? Historische Räuber und Räuberbanden. Sigmaringen 1995, S. 146 f.
[2] ebenda, S. 150
[3] Boehnicke, Heiner/ Hindemith, Bettina/ Sarkowicz, Hans, (Hrsg.), Die grossen Räuberinnen - „Und wenn der Kopf fällt, sag ich hoppla“, Frankfurt 1994, S. 229
[4] ebenda, S. 8
[5] Scheffknecht, Wolfgang, Arme Weiber – Bemerkungen zur Rolle der Frau in den Unterschichten und vagierenden Randgruppen der frühneuzeitlichen Gesellschaft. in: Niederstätter, Alois (Hrsg.), Hexe oder Hausfrau. Das Bild der Frau in der Geschichte Vorlarbergs, Sigmaringendorf 1991, S. 93
[6] ebenda, S. 94
[7] ebenda, S. 94
[8] ebenda, S. 94
[9] ebenda, S. 94
[10] Machnicki, „Sie trug stets das Brecheisen unter dem Rock“, S. 152
[11] Boehncke/Hindemith/Sarkowicz, Die grossen Räuberinnen, S. 182 f.
[12] Scheffknecht, Arme Weiber, S. 93
[13] Boehncke/Hindemith/Sarkowicz, Die grossen Räuberinnen, S. 183
[14] ebenda S. 183
[15] ebenda S. 184
[16] ebenda S. 184 f.
[17] Scheffknecht, Arme Weiber, S. 96
[18] ebenda S. 97
[19] Machnicki, „Sie trug stets das Brecheisen unter dem Rock“, S. 146
[20] ebenda S. 147
[21] Boehncke/Hindemith/Sarkowicz, Die grossen Räuberinnen, S. 197
[22] ebenda, S. 199 ff.
[23] ebenda, S. 201 f.
[24] ebenda, S. 201 f.
[25] Scheffknecht, Arme Weiber, S. 97
[26] Boencke/Hindemith/Sarkowicz, Die grossen Räuberinnen, S. 189 f.
[27] ebenda, S. 73
[28] Machnicki, „Sie trug stets das Brecheisen unter dem Rock“, S. 147
[29] Boencke/Hindemith/Sarkowicz, Die grossen Räuberinnen, S. 195
[30] Machnicki, „Sie trug stets das Brecheisen unter dem Rock“, S. 150 f.
[31] Boehncke/Hindemith/Sarkowicz, Die grossen Räuberinnen, S. 7
[32] ebenda, S. 200
[33] ebenda, S. 210
[34] Boehncke/Hindemith/Sarkowicz, Die grossen Räuberinnen, S. 212
[35] ebenda, S. 47 ff.
[36] Machnicki, „Sie trug stets das Brecheisen unter dem Rock“, S. 143
[37] ebenda, S. 146
[38] Blauert, Andreas, Sackgreifer und Beutelschneider. Die Diebesbande der Alten Lisel, ihre Streifzüge um den Bodensee und ihr Prozeß 1732. Konstanz 1993, S. 31
[39] Machnicki, „Sie trug stets das Brecheisen unter dem Rock“, S. 147
[40] Boehncke/Hindemith/Sarkowicz, Die grossen Räuberinnen, S. 215
[41] Blauert, Sackgreifer und Beutelschneider, S. 19
[42] Boehncke/Hindemith/Sarkowicz, Die grossen Räuberinnen, S. 42
[43] Blauert, Sackgreifer und Beutelschneider, S. 61
[44] ebenda, S. 19
[45] ebenda, S. 32 f.
[46] ebenda, S. 46 f.
[47] ebenda, S. 19 ff.
[48] ebenda, S. 45
[49] ebenda, S. 23 f.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über Räuberinnen?
Dieser Text ist eine akademische Analyse des Mythos und der Realität von Räuberinnen im 18. und 19. Jahrhundert. Er untersucht die Rolle der Frau in Räuberbanden, die Gründe für ein Leben als Räuberin, die Aufgaben und Funktionen von Frauen innerhalb der Banden, und die Strafen, die ihnen drohten.
Welche Themen werden in dem Text behandelt?
Der Text behandelt Themen wie die Darstellung von Räuberinnen in der Literatur, die Armut als Ursache für Kriminalität, die soziale Rolle von Frauen in Räuberbanden, die Kleidung von Räuberinnen, die Gleichberechtigung innerhalb der Banden und die Strafverfolgung von Räuberinnen.
Welche Gründe führten Frauen dazu, Räuberinnen zu werden?
Hauptgründe waren Armut, mangelnde Arbeitsmöglichkeiten, restriktive Ehegesetze und uneheliche Schwangerschaften, die oft zur sozialen Ausgrenzung führten. Einige Frauen wurden auch in das Leben als Räuberin hineingeboren und erzogen.
Welche Rolle spielten Frauen in Räuberbanden?
Frauen waren für die Versorgung der Bande zuständig, durch Diebstahl, Bettelei und Prostitution. Sie beschafften Informationen für Raubzüge, verkauften die Beute, schmuggelten Werkzeuge in Gefängnisse und verschafften Alibis für inhaftierte Bandenmitglieder.
Gab es auch Räuberbanden, die von Frauen angeführt wurden?
Ja, es gab auch Räuberbanden, in denen Frauen das Sagen hatten oder die ausschließlich aus weiblichen Mitgliedern bestanden. Bekannte Beispiele sind die Gruppen um Barbara Waldnerin, Magdalena Kriegin und Margaretha Böckin.
Welche Art von Kleidung trugen Räuberinnen?
Frauen, die für Diebstähle zuständig waren, trugen spezielle Röcke mit viel Stauraum für das Diebesgut. Manchmal trugen sie auch Männerkleidung, um unerkannt zu bleiben oder sich vor Übergriffen zu schützen.
Waren Räuberbanden gleichberechtigt?
In einigen italienischen Räuberbanden gab es eine gewisse Gleichberechtigung, aber in den deutschen Banden waren Frauen seltener an Raubzügen beteiligt und trugen keine Waffen. Allerdings spielten sie oft eine wichtige Rolle bei der Planung von Einbrüchen.
Welche Strafen drohten Räuberinnen?
Räuberinnen wurden oft gebrandmarkt, in Zuchthäuser gesteckt oder an den Pranger gestellt. Todesstrafen waren seltener.
Wer war die "Alte Lisel"?
Die Alte Lisel war eine bekannte Räuberin, die im Alter von 40 Jahren gefasst und zum Tode verurteilt wurde. Sie war Anführerin einer Diebesbande und bekannt für Beutelschneiderei, Marktdiebstahl und Sackgreiferei.
Welche Literatur wird in diesem Text verwendet?
Der Text bezieht sich unter anderem auf "Die grossen Räuberinnen" von Boehncke, Hindemith und Sarkowicz, "Sackgreifer und Beutelschneider. Die Diebesbande der Alten Lisel, ihre Streifzüge um den Bodensee und ihr Prozeß 1732" von Andreas Blauert, sowie Aufsätze von Monika Machnicki und Wolfgang Scheffknecht.
- Quote paper
- Linda Dittmann (Author), 2004, Räuberinnen im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108497