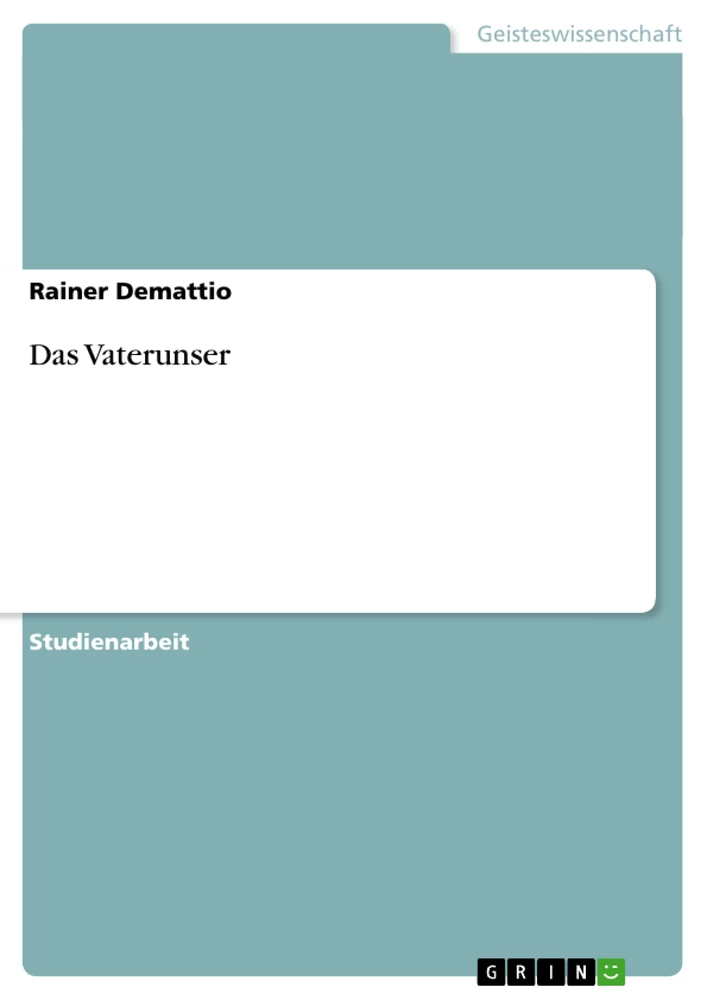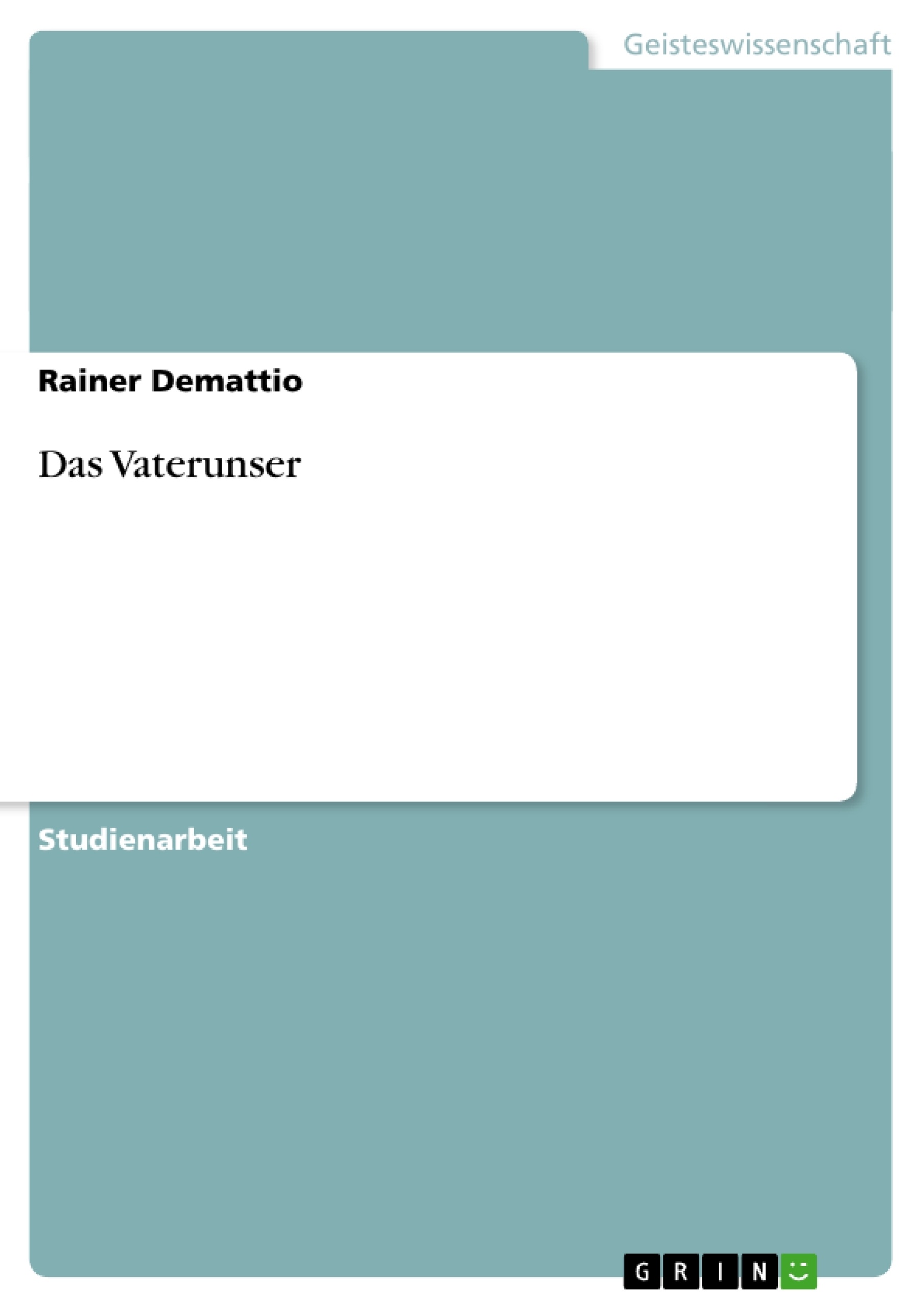Inhaltsverzeichnis
Das Unservater
(Mat. 6,7) Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen.
(Mat, 6,8) Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet.
(Mat. 6,9) So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt.
(Mat. 6,10) dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde.
(Mat. 6,11) Gib uns heute das Brot, das wir brauchen.
(Mat. 6,12) Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben.
(Mat. 6,13) Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. [Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.]
Verwendete Literatur
Anhang
Die Verse nach dem Vaterunser
Synoptischer Vergleich zum Vaterunser
Das Unservater
(Mat. 6,7) Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen.
Das hier zunächst angesprochene Geplapper der Heiden soll wohl kein konkretes Phänomen darstellen. Es könnte sich auf die damalige Praxis des Heidentums beziehen, unzählige Gottesepitheta aneinander zu reihen. Damit und durch die Verwendung unverständlicher Zauberworte sollte die magische Wirkung des Gebetes gesteigert werden. Doch es gab selbst in dem sogenannten Heidentum Stimmen, welche das Plappergebet vehement verurteilten.
Wir können wohl davon ausgehen, dass es diesem Text nur um eine äußere Erscheinungsform des Gebets geht. Zum einen zeigt dies die Fortsetzung. Zum Anderen auch die Analyse der heidnischen Gebetspraxis. Werden nun also viele Gottesnamen hintereinander ausgerufen, so möchte der Betende sein Ziel nicht verfehlen, die richte Bezeichnung zu verwenden um gehört zu werden. Er möchte Gott ehren, ihn gnädig stimmen um ihn zu etwas zu bewegen. So steht es auch im Text: „die Heiden meinen, Gott durch die Quantität ihrer Worte in Bewegung bringen zu können.“[1]
(Mat, 6,8) Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet.
Wir werden also aufgefordert es ihnen nicht gleichzutun. Daraus ergibt sich automatisch die Frage nach der Begründung für diese Mahnung. Und die Begründung lautet weder so, dass Gott unbestechlich sei, noch dass Gott allein durch die Reinheit und Wahrhaftigkeit der Bitte selbst zu etwas zu bewegen ist. Also sie geht weder auf die Qualität des Beters noch auf die des Gebets ein, sondern überrascht im darauf folgenden Satzteil. Unser Vater weiß schon was wir nötig haben, bevor wir ihn darum gebeten haben.
Ein solcher Gott, der diese unseren tiefsten Bitten schon kennt, der hat sich schon in Bewegung gesetzt. Er ist von der Ferne des Himmels in die Nähe des Menschen gekommen. Und er ist sogar den Menschen so Nahe, dass er bereits gehört hat, noch bevor er gerufen wurde. Das Erhörung des Gebets scheint keine Folge mehr desselben zu sein, sondern viel eher dessen Ursache.[2]
So erübrigt sich das Beten, das Rufen zu Gott auch nicht. Gerade in dem Faktum, dass Gott durch sein Wissen uns im Gebet voraus ist, liegt die väterliche Einladung ihn anzurufen und die Bereitschaft uns zu hören und uns zu helfen.[3]
Dass Gott menschliche Gebete erhört, dem Menschen begreiflich war und ganz in seiner Nähe war für Jesus gewiss. Mehr noch, die neue Welt in welcher Gott den Menschen antwortet, noch bevor sie in rufen war für Jesus nicht mehr fern. So bedurfte er auch des Geplappers nicht mehr, dass dafür bestimmt war, Gott dazu erst noch zu animieren müssen, sich zu bewegen.
Das führt uns zu einem ganz anderen Verständnis der Gebete. Gott, und das erschließt sich aus der von Jesus wahrgenommenen Nähe zu Gott, bleibt weiterhin Adressat der Gebete. Nur will das Gebet jetzt nicht mehr ihn in Bewegung bringen, sondern den Beter selbst. Das Gebet wird zur „Bewegung der Bitte“[4]. In der Bitte liegt das Selbstgeständnis des Bittenden, ein gewünschtes Ziel nicht alleine, ohne Hilfe, erreichen zu können. So verzichtet man darauf, sich etwas selbst zu geben, ein positiver Lebensvollzug eines Verzichts. Man bittet jemanden um etwas, „von dem er schon weiß, dass ich es brauche“[5], dann gelange ich zu der Situation in welcher ich es aus seiner Hand annehmen kann.
Besonders gilt das für das Gebet. Im Unser Vater finde ich sprachlichen Schutz davor, mir alles selbst geben zu wollen und auch zu geben. Der Mensch wird aus dem ´aus sich selbst leben` in ein Leben aus dem Bekommen geführt.
Eine Veräußerung des Gottesbezugs ist das Hauptanliegen der Frömmigkeitspraxis vor dem Menschen. Der beste Weg seinen Glauben also öffentlich darzustellen bietet das Gebet. Der Mensch ist im Gebet Gott ganz zugewandt und kann so den Bann dieser Veräußerung durchbrechen. Beim Menschen selber ist der Mensch doch meist versucht seinen Gegenüber zum Respekt zu bewegen. Im Gegensatz zu dieser bewegenden Struktur der menschlichen Interaktion steht nun der nicht mehr zu bewegen müssende Gott.
Dazu kommt noch das Ablassen des sich selbst geben Wollens, was nur Gott ihm geben kann (z.B.: die göttliche Liebe). Das Verschaffen findet hier ein Ende. So ist der Mensch im Gebet der Liebe ausgesetzt und jeder Versuch sich dabei Respekt zu verschaffen wird unweigerlich im Plappern enden.[6]
(Mat. 6,9) So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt.
Die Literatur greift sich aus diesem einleitenden Satz besonders gerne die Vateranrede heraus. Sie stellt einen besonderen Aspekt dieses Gebets dar und weist auch auf die neue Auffassung des Gottesbegriffs bei Jesus hin.
Der Vaterbegriff selber hat eine lange Vorgeschichte. Er gehört zu den Urphänomenen der Religionsgeschichte. So wurden unter anderen der Mondgott Sin aus Ur, der El von Ugarit und der hellenistische Zeus mit der Vateranrede angerufen.
Selten hingegen kommt der Vaterbegriff im Alten Testament vor. Dort wird er auch immer auf das Verhältnis des Gottes Israel zu seinem Volk bezogen gebraucht. Dabei ist jedoch nicht an eine mystische Überhöhung zu denken sondern an das erwählende Handeln Gottes. Gemeint ist „das Handeln Gottes in der Geschichte Israels und seines Königs“[7]. So wird auch verständlich, warum der Vatername für Israel nicht das bedeutete was er in dessen Umfeld bedeutete und deshalb auch nicht ohne weiteres hat übernommen werden können.[8]
Die Anrede selber, ´abba` (griechisch ´pater`) sei zwar nicht ungewöhnlich, aber dennoch ist es auffällig wie dies bei Jesus geschieht. ´Abba` ist ein umgangssprachlich aus dem Aramäischen übernommener Begriff. Der sich als „Kindersprache [und] Alltagswort mit ´lieber Vater`“[9] übersetzen lässt. So zeigt sich darin auch ein Grundzug des Grundverständnisses Jesu aus. Die Nähe Gottes erhält bei Jesus eine unüberbietbare Maßgeblichkeit.[10]
Dass diese ´Abba`-Anrede in griechischer Transkription überliefert wurde, zeigt die Wichtigkeit für die Gemeinden auf, diesen Sprachgebrauch Jesu in Erinnerung zu behalten. Zumeist hatte es eine christologische Relevanz in den Gemeinden. Sie wollten der Nähe Christus zu Gott Ausdruck verleihen. Durch die Tatsache, dass Jesus diese Anrede in die Welt gesetzt und sie den Jüngern im Herrengebet übergeben hatte, verlieh diese der Erinnerung eine anthropologische Bedeutung. Die Jünger konnten nun auf eine zuvor unbekannte Art Kinder Gottes sein, da Jesus ja auch ihr Gottesverhältnis neu bestimmte. Das Gebet berührt nicht nur „das Gottesverständnis sondern ganz entscheidend auch das Selbstverständnis des Menschen“[11].
So wird Raum geschaffen für die Kinder Gottes. Durch die Sohnschaft und durch die Nähe entsteht eine neue Gottesrelation des Menschen. Ein Schritt vom Arbeitsverhältnis zum Liebesverhältnis. Ein Schritt, bei welchem der verzeihende Vater seine Söhne ohne Gegenleistung auf- und annimmt.[12] Dieses Zugehen auf die Söhne vom Vater symbolisiert dann die „Bewegung der Liebe selbst“[13].
Aber nicht nur das Arbeitgeberverhältnis wird dadurch überwunden, sondern auch die Beziehungslosigkeit, da ein Arbeitsverhältnis eigentlich gar kein Verhältnis ist.[14]
Die Vateranrede gilt als ipsissima vox. Dadurch dass die jüdische Gebetsliteratur keinen Beleg für die Anrede Gottes mit ´Abba` beinhaltet, nimmt die Forschung an, es sei die ureigene Sprache Jesu.[15]
Die Zusage ´im Himmel´ soll Gott nicht transzendent-fern werden lassen. Es ist vielmehr ein Zuspruch an den, der im Himmel regiert und zwar dass dieser auch die Geschicke hier auf Erden in seiner Hand hat.[16]
Kritische Stimmen an der Vateranrede stammen erst aus der Neuzeit. So prangert die Freudianische Psychologie die Zementierung neurotischer Vaterverbindungen und die Sozialpsychologie die Problematik eines Vatergottes in einer Zeit der vaterlosen Gesellschaft an. Aber auch die feministische Theologie kritisiert den Ausschluss der Frauen vom Gebet durch die Verfestigung eines patriarchalischen Gottes.
Trotz aller Kritik, die selbstverständlich selbstkritisch zu behandeln und wohl zu überlegen ist, bezieht sich die Vateranrede in der Bergpredigt wohl hauptsächlich auf die Metapher des Vaters. Dadurch handelt es sich dabei auch nicht um eine „Verfestigung der weltlichen Väterproblematik“[17], es ist viel eher eine Arbeit an dieser Problematik, die Vätern wie Kindern gleichermaßen zugute kommt. So darf man sich den Vaterbegriff nicht als eine Projektion vorstellen. Der Begriff, wie Jesus sie gebrauchte, bedeutete eine Kritik an diesen Vätern, welche sich als Arbeitgeber aufspielen oder überhaupt nicht in Erscheinung treten.
Zugleich handelt es sich hierbei um eine Kritik an der damals herrschenden Gottesvorstellung. Gott soll nicht weiter so in der Ferne und distanziert vom Menschen betrachtet werden.
Zusammenfassend ließe sich berichten, dass sich in der Gebetsanrede ´Vater` das Sohn- wie auch das Tochter-Sein des Menschen vollzieht. Der dadurch neu geschaffene Daseinsraum lässt mich nicht nur zu einem Sohn oder einer Tochter Gottes werden, sondern zudem noch zu Schwester oder Bruder der anderen Menschen. In dieser Konsequenz lässt sich die Kritik doch gerne ad acta legen, oder?[18]
Es folgen die drei ersten Bitten. Sie gehören eng zusammen und sind als betont eschatologische Bitten zu verstehen in welchem es voranging nur um eine Sache geht und zwar um das Kommen seiner Herrschaft.[19] Diese Bitten weisen sich als Bitten der Kinder Gottes aus und verstehen sich für den Vater als selbstverständlich. So greift auch die erste der drei Bitten die Heiligung des Namens Gottes auf. Dabei werden hauptsächlich zwei Dinge betont. Erstens wird vorangestellt das Heiligen betont, zweitens das `dein`, das explizit Gottes Namen in den Mittelpunkt stellt.[20]
So soll damit auch definitiv nicht der Mensch geheiligt werden, sondern allein Gott. Durch den Menschen wird ja auch definitiv sein Reich genauso wenig kommen oder sein Willen geschehen, wie sein Name durch sie geheiligt werden kann. Das Ziel der Bitte ist Gott selbst, er soll seine Herrlichkeit und Heiligkeit sichtbar werden lassen, sie steht für „die Person Gottes [und] für all das, was diese Person hervorbringt“[21]. So ist diese Passivform auch wieder Umschreibung des Gottesnamens.[22]
Doch diese Passivform steht auch für die Bewegung dorthin wo der Bittende das Gottsein Gott selber überlässt. So bildet sie eine Unterbrechung der Versuche Gottes Gottsein mit eigener (Menschen-)Hand herbei zu führen. Gott allein kann „seinen Namen zu Ehren bringen“[23].
Dieser ersten Bitte des Vater Unsers geht es nicht nur darum, dass „die Heiligung des Gottesnamens im Tun seines Willens“[24] besteht, sondern um die Unterscheidung des Gottesnamens von menschlichen Namen, um das Wahrnehmen Gottes, also um die Unterscheidung von Gottes Wirken und menschlichem Werk.[25]
(Mat. 6,10) dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde.
In der zweiten Du-Bitte wendet sich der Beter erneut Gott zu. Besondere Gewichtung erfährt zum einen das Reich Gottes und zum anderen das Kommen. Wie weiter oben geschrieben, kann des Reich nicht vom Menschen selber verwirklicht werden, da sie es nicht verwirklichen können dass „Gott sich dieser Welt annimmt“[26]. So sprechen diese Bitten nicht nur immer Gottes Ehre und Herrschaft an, sondern auch die Tatsache dass der Mensch und die Welt nicht zurechtkommen können, wenn Gott nicht zu seinem ´Herrenrecht` kommt. Der Schritt von Gott auf den Menschen und die Welt zu ist auch Gegenstand der 3. Bitte, da der Wille Gottes im Himmel ja jetzt schon geschieht, auf Erden aber noch geschehen muss. Das bedeutet aber keinesfalls die Ergebung des Menschen in einen schicksalhaft verstandenen Wille Gottes, da die Ebene menschlicher Verantwortung und menschlichen Handelns darüber hinaus gültig bleibt.[27]
Rein eschatologisch könnte diese Bitte als die baldige Wende der Welt verstanden werden. Bei Jesus spielt jedoch nicht nur dieser futuristische Gedanke der Gottesherrschaft eine Rolle, sondern gerade auch durch seine Person ihr Hereinragen in das Jetzt. Die Gottesherrschaft ist im Kommen inbegriffen und so wird auch darum gebetet, dass sie das Jetzt unter ihren Einfluss nehme.
Die Kürze dieser Bitte weist darauf hin dass mit ihr eindeutig und ausdrücklich Gottes Herrschaft erbeten wird, die sich nicht gut, wie in anderen Gebeten z. B. dem Achtzehnbittengebet, mit deren höchst menschlichen Wünschen verknüpfen lässt.
Auch hier bewegt sich wieder nicht Gott, denn er ist ja bereits am Kommen, sondern es bewegt sich der Betende der Gottesherrschaft entgegen indem er von seinem eigenen Herrschafts- und Machtanspruch abweicht und Gottesherrschaft Gottes Herrschaft sein lässt.[28]
Im Zuge des gnädigen Heilswillen Gottes ist auch die dritte Bitte verständlich. Sein Wille soll geschehen. Sein Willen eben in welchem Gott auf das Heil der Welt bedacht ist. Da geht es um das „Hineingenommenwerden des Menschen in Gottes zukünftiges Tun“[29]. So erwartet der Beter der Unservaters alles von Gott und ist ganz an den handelnden Gott gewiesen. Das allerdings nur, weil er sich nicht seine eigene Zukunft erschafft und entwirft, sondern sie als von Gott zugesagt erwarten darf.[30] So gesteht sich der Beter doppeltes ein. Erstens gibt es außer dem eigenen Willen noch einen anderen und zweitens liegt es nicht in der Reichweite des eigenen Willens, sich in die Bewegung des Gotteswillens einzuordnen.[31]
(Mat. 6,11) Gib uns heute das Brot, das wir brauchen.
Die nun folgenden beiden Wir-Bitten können als Aktualisierung der Du-Bitten verstanden werden. So gehört das Kommen des Reiches und das tägliche Brot zusammen. Die doppeldeutige Übersetzungsmöglichkeit des Griechischen ´epiousios` führte zu endlosen Debatten. Die eine Übersetzung würde dabei eine „bescheiden zugemessene Ration“[32] meinen, die andere ließe sich eher mit „auf den folgenden Tag bezogen, für morgen bestimmt oder nötig“[33] übersetzen. Seit Luther wurde die Bezeichnung ´täglich` geläufig.[34]
Dass dieses ´täglich` betont wird macht deutlich, dass das Unservater die Sorge begrenzt und dabei bekennt dass „der Mensch Tag um Tag auf Gottes Geben angewiesen ist“[35]. Dabei kommt dem Brot die Bedeutung aller Dinge die der Mensch während seines irdischen Daseins bedarf zu.
Die Bitte ist dabei durchaus als eine zu verstehen, die tatsächlich nicht nur Gleichnishaft sondern wirklich die irdischen Sorgen und Bedürfnisse vorträgt. Allerdings, und Jesus verbietet uns dieses, wird das sorgende Fragen des Menschen, mit welchem wir uns nur selbst übernehmen würden.
Um ein geistliches Anliegen geht es nach der Auslegung in der Linie Calvins und Luthers. In dieser ist unsere leibhaftige Wirklichkeit auch als von der Barmherzigkeit Gottes abhängig zu verstehen. Der Beter wird sich in dieser Bitte dessen gewahr, dass er „selbst nicht Produzent des Brotes ist“[36] sondern verwandelt sich sogar als „der vermeintliche Produzent des Brotes in den Empfänger“[37]. So ist sie gleichzeitig auch ein Bekenntnis dafür, dass wir ohne Gottes Güte, die unser ganzes Menschsein umfasst, und das Brot, welches er uns immer wieder schenkt, überhaupt erst gar nicht wären. Sie ist Lobpreis des Gebers allen Lebens und der Betende bekennt sich zu seiner Geschöpflichkeit. Das Brot wird dabei zum Zeichen der väterlichen Sorge und der unverdienbaren und unverdienten Güte Gottes. Und dieser Güte begegnen wir auch gerade in alltäglichen Dingen. So sprechen wir die Bitte nicht abseits von unserer Existenz sondern legen sie geradezu in diese hinein.[38]
Auf jeden Fall kommt in dieser solidarischen Bitte zum Ausdruck, dass jetzt schon alle das gemeinsam haben sollen, was sie heute zum Leben brauchen. Man kann nicht vor Gott Egoistischerweise nur für sich allein um sein Brot bitten, sonst würde man sich damit auch von den anderen und gleichermaßen von ihm trennen.[39]
(Mat. 6,12) Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben.
Dass es diesen Zusammenhang in der Herrschaft Gottes gibt, zwischen der Bitte und dem Verhalten der Leute, welche diese Bitte vortragen, tritt in der ´Vergebungsbitte` deutlich zutage. Wir sollen unseren Schuldnern vergeben, denn keiner kann um Vergebung bitten, der nicht selbst bereit ist zu vergeben. Es ist zwar nicht als Bedingung zu verstehen, aber Schuld trennt. Sie trennt den Menschen vom Menschen und damit auch den Menschen von Gott.[40]
Dabei muss an dieser Stelle ein kurzer Exkurs in das gegenwärtige Schuldphänomen folgen. Zum einen ist der Sprachgebrauch verräterisch. Wir reden heutzutage nicht mehr von Schuld, sondern viel eher von Schuldgefühlen. Diese Schuldgefühle betreffen den Einzelnen und bedürfen keiner Vergebung. Zum anderen wird diese Problematik häufig im Sinne des Terminus ´nobody is perfect` durch Verallgemeinerung überspielt. Irren ist menschlich, Schuld wird es dadurch auch. Sie wird dadurch wie auch die Vergebung zu einer ganz natürlichen, alltäglichen Sache. Doch wenn das Schuldproblem überspielt wird, wird dadurch gleichermaßen die Vergebung im Namen der Höflichkeit banalisiert. Zum dritten scheint Schuld durch Vergessen oder Selbstrechtfertigung bearbeitet zu werden. All diese Umgangsformen mit Schuld kennzeichnet, dass sie die Schuld übergehen. Das Vaterunser leitet dazu an, Gott um die Vergebung der Schuld zu bitten.[41]
Auch kann man diese Vergebung nicht als Vorleistung dafür verstehen, dass Gottes Vergebung automatisch darauf folgen muss. Sie verträgt sich einfach nicht mit einer „Verweigerung der Vergebung im Verhältnis von Mensch und Mensch“[42]. Dieser Punkt wir im weiteren Verlauf der Verse deutlich unterstrichen. So steht unter Mat. 6,14-15:
(14)Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. (15)Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben.
So liegt der Akzent auf der Mahnung zur Vergebung, da ja auch ohne die Bereitschaft zu dieser, die Gemeinde als Bruderschaft nicht bestehen kann und deshalb auch „ständig zur Vergebung aufgerufen werden muss“[43]. So wird die von Gott her widerfahrende Vergebung zum Echo, welches im Schallrohr Mensch, und zwar dadurch dass wir einander diese Vergebung gewähren, hör- und spürbar wird.[44]
Vorhin erwähnte ich die Trennung der Menschen durch Schuld. Jesus bietet die Überwindung dieser Trennung. Sie steckt in dem solidarischen Gedanken die in der Herrschaft Gottes liegt. Wer Jesu Handeln folgt, kann diese Separation aufheben. Derjenige der ´abba` sagt und so um die Teilnahme an der Überwindung bittet, steht nicht mehr alleine da. Dieser sucht die anderen in der Gemeinschaft des Vaters mit seinen Kindern.[45]
(Mat. 6,13) Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. [Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.]
Die letzten beiden Bitten, die 6. und die 7., kann man als eine Einheit verstehen. So hängen sie auch eng zusammen und meinen das gleiche nach der positiven wie auch nach der negativen Seite. Die Einsicht, dass die 7. Bitte zur Auslegung der 6. wird, bildet einen Schlüssel zum Verständnis des Textes.
Das Wort Versuchung lässt sich nur ansatzweise deuten. Damit kann die Erprobung des Menschen durch Gott gemeint sein mit welcher Gott uns sicher nicht aus seiner Hand lassen will, sondern im Gegensatz dazu immer fester in ihr machen möchte.[46] Aber sie meint wohl vielmehr eine Situation, in welcher das Böse nahe liegt.[47]
So kann diese letzte Bitte als ein Hilferuf verstanden werden. Das Böse droht alles in Frage zu stellen, was durch die heilsame Gottesherrschaft in der Wirklichkeit des Betenden Gestalt gewonnen hat. Doch nicht durch Flucht vor dieser Wirklichkeit des Bösen kann man der Gefahr des Abfalls in das Schändliche trotzen, sondern gerade dadurch, dass man sich ihr stellt und sie aushält. Gemeinsam wird sie ausgehalten, wie auch gemeinsam das Vaterunser gebetet wird.[48]
Betrachtet man diese Versuchung als „satanische Verführung“[49], so möchte uns Gott gerade vor dieser bewahren. Er verheißt uns, dass er uns in der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird, beistehen wird. Eschatologisch gesehen tut sich hier ein Horizont äußerster Versuchung auf. Darum auch kann man behaupten, der Betende bittet diese Bitte mit dem Gedanken, dass Gottes Reich endlich kommt.[50]
In der Bitte, mich vor dem Bösen zu bewahren kommt deutlich zum Ausdruck, dass ich nicht Herr über die Lage bin, die am Ende im Kampf gegen das Böse mündet. Wenn das Verlassen auf das Böse, ein Verlassen auf das Nichts sein soll, dann wird damit das Verlassen auf Gott, ein Verlassen auf seine Liebe oder eigentlich auf die Liebe selbst, ausgeklammert. Wenn ich mich nicht mehr auf diese Liebe verlasse, so kann ich mich nur noch auf mich selber verlassen. So kann ich mich selbst als Produzent des Bösen, welches sich selbst mit einer solchen Macht reproduziert, welcher ich nicht gewachsen bin, erkennen.
Diese Bitte will den Beter jedoch bewegen sich nicht auf sich selbst zu verlassen, wenn es um Versuchung geht. Sie ist eine Herausführung aus der Versuchung, sich auf nichts zu verlassen und eine Hinführung zum Aufgehobensein in der Liebe Gottes.[51]
Diese Bitte fällt ein wenig aus dem übrigen Rahmen heraus, da dieser eingliedrige und knappe Schlusssatz knapp und hart wirkt und sie als einzige der Bitten negativ formuliert ist.
Die Schlussdoxologie ordnet sich zwar schön in den Gebetsgrundzug ein, kam aber erst später dazu.
Verwendete Literatur
BECKER, Ulrich, Wenn ihr betet in :BECKER, JOHANNSEN, NOORMANN (Hg.), Neutestamentliches Arbeitsbuch für Religionspädagogen, Stuttgart u.a. 1997
Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Freiburg im Breisgau 1994
EICHHOLZ, Georg, Auslegung der Bergpredigt, 6. Auflage, Neuenkirchen-Vluyn 1984
GOTTFRIED, Adam, Bergpredigt in: LACHMANN, ADAM, REENTS (Hg.), Elementare Bibeltexte. Exegetisch-systematisch-didaktisch, Göttingen 2001 (TLL 2)
HALBFAS, Hubertus, Die Bibel erschlossen und kommentiert, Düsseldorf 2001
WEDER, Hans, Die „Rede der Rede“, eine Auslegung der Bergpredigt heute, 4. Auflage, Zürich 2002
Anhang
Die Verse nach dem Vaterunser
(14)Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben.
(15)Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben.
(16)Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt werde, daß sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.
(17)Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht,
(18)damit es nicht von den Leuten bemerkt werde, daß du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich.
(19)Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, und wo die Diebe nachgraben und stehlen.
(20)Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen.
(21)Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Synoptischer Vergleich zum Vaterunser
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] WEDER, Hans, Die „Rede der Rede“, eine Auslegung der Bergpredigt heute, 4. Auflage, Zürich 2002, S. 171
[2] Vgl. WEDER, S. 171 f.
[3] Vgl. EICHHOLZ, Georg, Auslegung der Bergpredigt, 6. Auflage, Neuenkirchen-Vluyn 1984, S. 120
[4] WEDER, S. 172
[5] Ebd.
[6] Vgl. WEDER, S. 170 ff.
[7] EICHHOLZ, S. 117
[8] Vgl. EICHHOLZ, S. 116 f.
[9] EICHHOLZ, S. 118
[10] Vgl. WEDER, S. 176
[11] Ebd.
[12] Vgl. hierzu: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32)
[13] WEDER, S. 177
[14] Vgl. WEDER, S. 176 f.
[15] Vgl. EICHHOLZ, S. 119
[16] Vgl. EICHHOLZ, S. 119 f.
[17] WEDER, S. 178
[18] Vgl. WEDER, S. 177 ff.
[19] Vgl. EICHHOLZ, S. 120
[20] Vgl. WEDER, S. 179
[21] Ebd.
[22] Vgl. EICHHOLZ, S. 120 f.
[23] EICHHOLZ, S. 121
[24] WEDER, S. 180
[25] Vgl. WEDER, S. 179 f.
[26] EICHHOLZ, S. 121
[27] Vgl. EICHHOLZ, S. 121 ff.
[28] Vgl. WEDER, S. 181 ff.
[29] EICHHOLZ, S. 123
[30] Vgl. ebd.
[31] Vgl. WEDER, S. 183 f.
[32] BORNKAMM, Günther, Jesus von Nazareth, Stuttgart 1971, S. 188 zitiert nach BECKER, Ulrich, S.122
[33] JEREMIAS, Joachim, Jesus und seine Botschaft, Stuttgart 1982, S. 193 f. zitiert nach ebd.
[34] Vgl. BECKER, S. 122 f.
[35] EICHHOLZ, S. 125
[36] WEDER, S. 185
[37] Ebd.
[38] Vgl. EICHHOLZ, S. 125 ff.
[39] Vgl. BECKER, S. 122 f.
[40] Vgl. BECKER, S. 123
[41] Vgl. WEDER S. 187 f.
[42] EICHHOLZ, S. 130
[43] EICHHOLZ, S. 131
[44] Vgl. EICHHOLZ, S. 130 f.
[45] Vgl. BECKER, S. 123
[46] Vgl. EICHHOLZ, S.131 f.
[47] Vgl. WEDER, S. 190
[48] Vgl. BECKER, S. 123 ff.
[49] EICHHOLZ, S. 131
[50] Vgl. EICHHOLZ, S.131 ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Das Unservater"?
Der Text ist eine umfassende Analyse und Auslegung des Vaterunser-Gebets (Matthäus 6,7-13) aus biblischer und theologischer Sicht. Er untersucht die einzelnen Bitten, die Vateranrede, und die damit verbundenen Implikationen für das Gottesverständnis und das menschliche Selbstverständnis.
Was sind die Hauptthemen, die in der Analyse des Vaterunsers behandelt werden?
Zu den Hauptthemen gehören die Bedeutung des Gebets im Gegensatz zum "Geplapper" der Heiden, die Vateranrede ("Abba") und ihre Implikationen für die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die Heiligung des Namens Gottes, das Kommen des Reiches Gottes, die Erfüllung des göttlichen Willens, die Bitte um das tägliche Brot, die Vergebung der Sünden und die Bewahrung vor Versuchung und dem Bösen.
Welche Bedeutung hat die Vateranrede ("Unser Vater im Himmel") im Kontext des Textes?
Die Vateranrede wird als Ausdruck einer neuen, intimen Beziehung zwischen Gott und Mensch interpretiert. Die Verwendung des aramäischen Wortes "Abba" (lieber Vater) unterstreicht die Nähe und Vertrautheit, die Jesus mit Gott verband, und die er seinen Jüngern vermitteln wollte. Dies steht im Gegensatz zu einem distanzierten oder rein formellen Gottesbild.
Wie wird die Bitte "Dein Reich komme" im Text ausgelegt?
Die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes wird nicht nur als eschatologische Hoffnung auf eine zukünftige Welt verstanden, sondern auch als Aufruf, dass Gottes Herrschaft bereits jetzt in das Leben der Menschen und die Welt hineinwirkt. Es geht darum, dass Gott sich dieser Welt annimmt und dass der Mensch sich Gottes Herrschaft entgegenbewegt, indem er von seinem eigenen Herrschafts- und Machtanspruch abweicht.
Was bedeutet die Bitte "Gib uns heute das Brot, das wir brauchen" im Text?
Diese Bitte wird als Anerkennung der Abhängigkeit des Menschen von Gott für seine grundlegenden Bedürfnisse interpretiert. Das "Brot" steht symbolisch für alles, was der Mensch zum Leben braucht. Die tägliche Wiederholung der Bitte erinnert daran, dass der Mensch Tag für Tag auf Gottes Geben angewiesen ist und nicht selbst der alleinige Produzent seines Lebensunterhalts ist. Sie schließt auch die Solidarität mit anderen mit ein, indem man sich für eine gerechte Verteilung der Lebensnotwendigkeiten einsetzt.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Vergebung und der Bitte "Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben" erklärt?
Die Vergebungsbitte betont die untrennbare Verbindung zwischen der Vergebung durch Gott und der Bereitschaft des Menschen zur Vergebung. Es wird nicht als Bedingung für Gottes Vergebung dargestellt, aber es unterstreicht, dass Schuld trennt und dass die Verweigerung der Vergebung die Gemeinschaft zerstört. Die Bereitschaft zur Vergebung wird so zum Echo der göttlichen Vergebung im menschlichen Miteinander.
Welche Interpretationen werden für die Bitte "Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen" angeboten?
Die Bitte um Bewahrung vor Versuchung wird als Hilferuf verstanden, der vor der Gefahr des Abfalls in das Böse warnt. Sie bittet um die Kraft, Versuchungen zu widerstehen und sich dem Bösen entgegenzustellen, anstatt vor ihm zu fliehen. Es geht um die Erkenntnis, dass man nicht aus eigener Kraft Herr über die Lage ist und auf Gottes Hilfe angewiesen ist, um der "satanischen Verführung" zu entgehen. Die Bewahrung vor dem Bösen wird mit der Liebe Gottes in Verbindung gebracht, da die Ablehnung Gottes zu einer Überlassenheit zu sich selbst führt, was die Gefahr des Bösen verstärkt.
Welche Literatur wird im Text verwendet?
Im Text werden folgende literarische Werke verwendet:
- BECKER, Ulrich, Wenn ihr betet in :BECKER, JOHANNSEN, NOORMANN (Hg.), Neutestamentliches Arbeitsbuch für Religionspädagogen, Stuttgart u.a. 1997
- Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Freiburg im Breisgau 1994
- EICHHOLZ, Georg, Auslegung der Bergpredigt, 6. Auflage, Neuenkirchen-Vluyn 1984
- GOTTFRIED, Adam, Bergpredigt in: LACHMANN, ADAM, REENTS (Hg.), Elementare Bibeltexte. Exegetisch-systematisch-didaktisch, Göttingen 2001 (TLL 2)
- HALBFAS, Hubertus, Die Bibel erschlossen und kommentiert, Düsseldorf 2001
- WEDER, Hans, Die „Rede der Rede“, eine Auslegung der Bergpredigt heute, 4. Auflage, Zürich 2002
- Quote paper
- Rainer Demattio (Author), 2003, Das Vaterunser, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108231