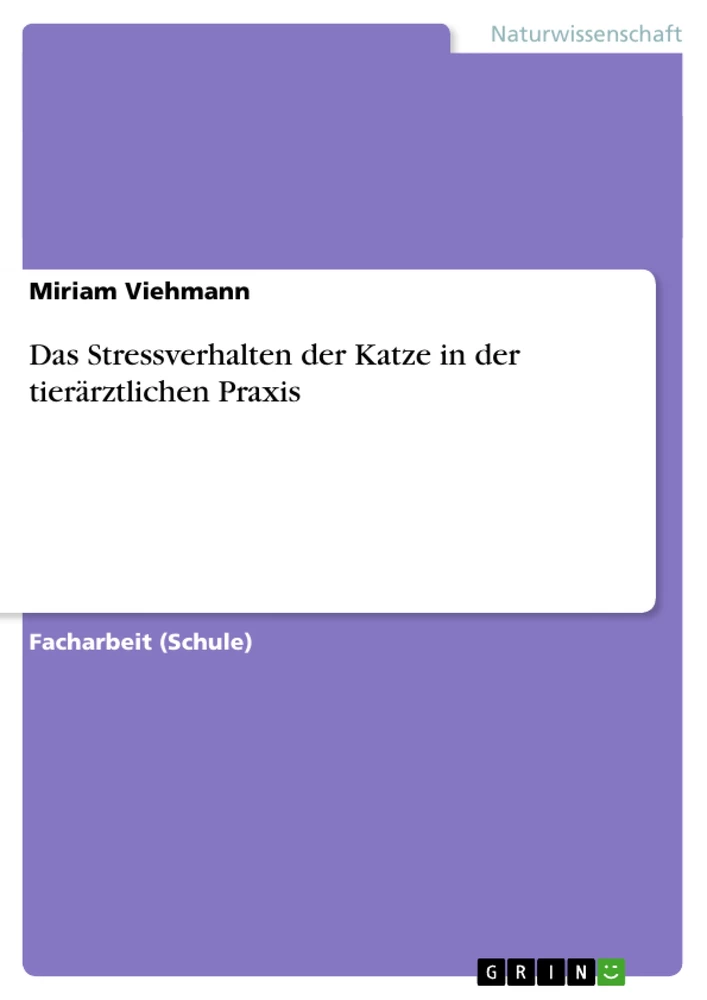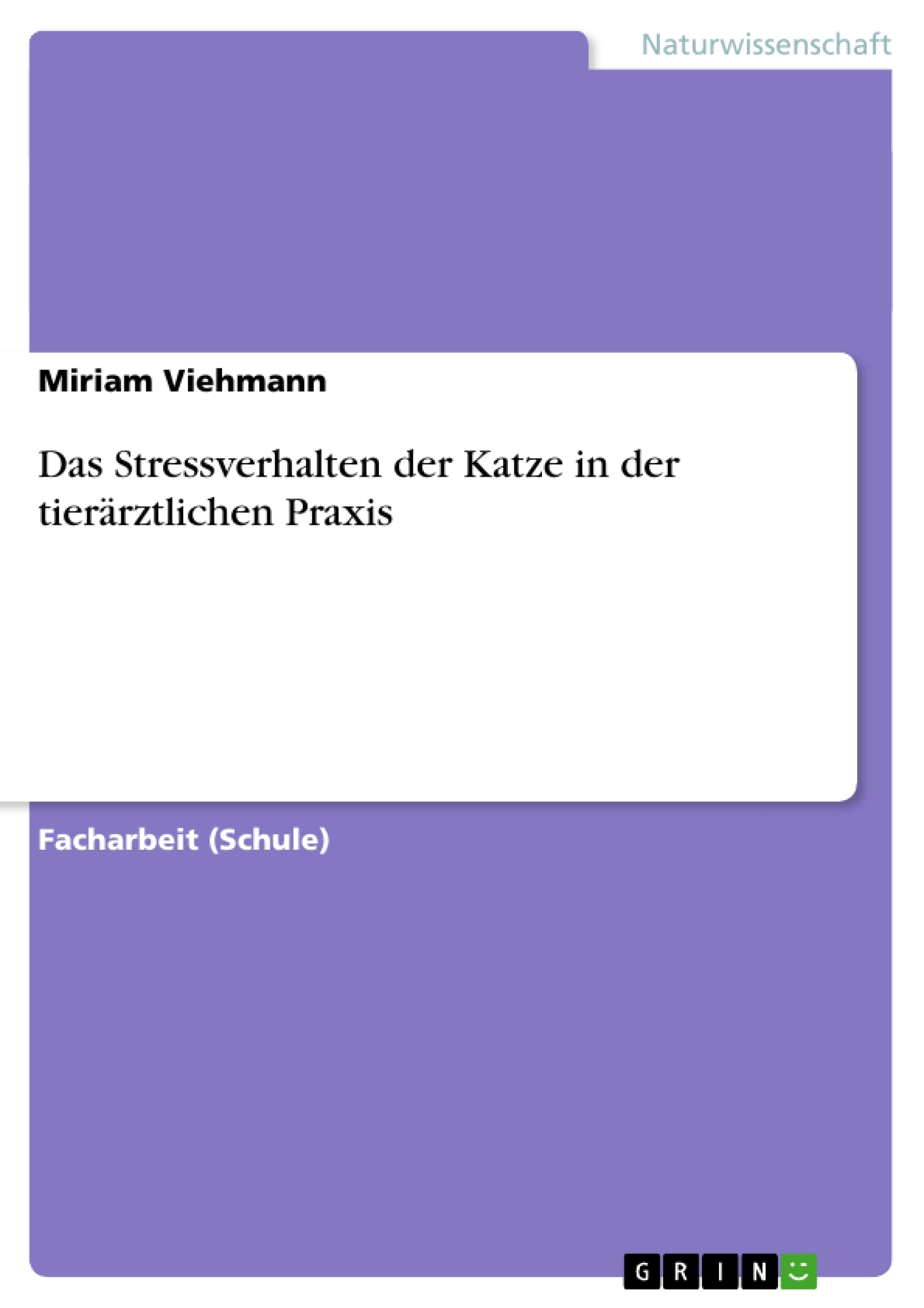Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Tierarztpraxis und beobachten das subtile Zusammenspiel von Angst, Abwehr und Akzeptanz im Verhalten einer Katze. Diese tiefgreifende Analyse enthüllt die komplexen Stressreaktionen von Katzen in der ungewohnten Umgebung einer Tierarztpraxis. Durch detaillierte Beobachtungen des Angriffs-, Abwehr- und Fluchtverhaltens werden die vielfältigen Reaktionen der Samtpfoten auf medizinische Eingriffe beleuchtet. Die Studie untersucht, wie sich Stressoren wie Transport, fremde Gerüche und die Anwesenheit von Tierärzten auf den Blutzuckerspiegel der Tiere auswirken. Mittels Blutanalyse, insbesondere der Glucosebestimmung bei wachen und narkotisierten Katzen, wird ein objektiver Stressparameter ermittelt. Dabei werden verschiedene Blutentnahmetechniken verglichen, um die stressauslösenden Faktoren während der Behandlung zu identifizieren. Ergänzend dazu werden Katzenbesitzer mithilfe eines Fragebogens zu ihren Erfahrungen und Wahrnehmungen befragt, um ein umfassendes Bild des Katzenverhaltens in der Tierarztpraxis zu erhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass Katzen individuell auf Stress reagieren und dass die Einschätzung der Besitzer oft von den tatsächlichen physiologischen Stressreaktionen abweicht. Diese Arbeit bietet nicht nur wertvolle Einblicke in die Katzenpsychologie und Tierarztangst, sondern gibt auch praktische Empfehlungen zur Stressreduktion beim Tierarztbesuch. Erfahren Sie, wie Sie den Transport für Ihre Katze angenehmer gestalten, das Wartezimmer entspannter erleben und die Behandlung stressfreier gestalten können. Entdecken Sie die feinen Unterschiede im Verhalten von Katern und Katzen und lernen Sie, die Signale Ihres Tieres besser zu verstehen, um den Tierarztbesuch für alle Beteiligten zu erleichtern. Ein unverzichtbarer Ratgeber für jeden Katzenbesitzer, Tierarzt und alle, die das Wohlbefinden von Katzen am Herzen liegt. Tauchen Sie ein in die Welt der Katzenverhaltensforschung und entdecken Sie neue Wege, um die Gesundheit und das Glück Ihrer Katze zu fördern. Diese wissenschaftliche Untersuchung bietet fundierte Erkenntnisse und praktische Tipps für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Katze im Kontext der Tiermedizin. Untersucht werden auch die Auswirkungen von Kastration und Sterilisation auf den Stresslevel der Tiere, sowie die Bedeutung von Gewöhnungseffekten bei regelmäßigen Tierarztbesuchen. Eine detaillierte Analyse der Laborergebnisse wird den Meinungen der Besitzer gegenübergestellt. Abschließend werden Maßnahmen zur Stressvermeidung vorgestellt, die von der Auswahl des richtigen Transportkäfigs bis hin zum Verhalten im Behandlungsraum reichen, um den Tierarztbesuch für Katzen stressfreier zu gestalten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Literaturübersicht
2.1 Definition Stress
2.2 Verhaltensweisen von Katzen
2.2.1 Angriffsverhalten
2.2.2 Abwehrverhalten
2.2.3 Fluchtverhalten
3. Material und Methodik
3.1 Eigene Beobachtungen zu den Verhaltensweisen der Katze auf dem Behandlungstisch
3.2 Blutglucosebestimmung als Stressparameter
3.2.1 An wachen Tieren aus der vena antebrachi
3.2.2 An narkotisierten Tieren
3.2.2.1 aus der Ohrrandvene
3.2.2.2 bei der Ohrtätowierung
3.3 Befragung der Katzenbesitzer mit Hilfe eines Fragebogens
4. Ergebnisse und Interpretation
4.1 Auswertung der Blutergebnisse zur Glucosebestimmung
4.1.1 der wachen Tiere aus der vena antebrachii
4.1.1.1 bei weiblichen Katzen
4.1.1.2 bei männlichen Katzen
4.1.2 der narkotisierten Tiere
4.1.2.1 aus der Ohrrandvene
4.1.2.1.1 bei weiblichen Katzen
4.1.2.1.2 bei männlichen Katzen
4.1.2.2 bei der Ohrtätowierung
4.1.2.2.1 bei weiblichen Katzen
4.1.2.2.2 bei männlichen Katzen
4.2 Auswertung des Fragebogens
5. Diskussion: Vergleich der Laborergebnisse mit den Besitzermeinungen
6. Zusammenfassung
1. Einleitung
Heutzutage halten sich immer mehr Menschen ein Haustier, sei es um in unserer single-dominierten Gesellschaft einen Ansprechpartner zu haben, sei es um Nervosität und den beruflichen Stress leichter abbauen zu können. „Des Deutschen liebstes Tier ist die Katze,…“1 da sie sowohl pflegeleicht und somit problemlos in der Wohnung zu halten ist, als auch sich als Einzelgänger den Tag über selbst beschäftigen kann ohne so sehr unter der Abwesenheit des Besitzers zu leiden wie das Rudeltier der Hund. Somit stellt die Katze das ideale Heimtier für Berufstätige dar. Wer aber eine Katze in seiner Wohnung aufnimmt, der möchte auch, dass diese gesund und frei von jeglichen Parasiten ist. Folglich muss sich jeder Tierhalter früher oder später mit dem Thema „Tierarztbesuch“ auseinandersetzen. Während ein Hundebesitzer sein Tier nur anzu-leinen braucht, um es zum Tierarzt zu bringen, ist der Katzenbesitzer vor viel größere Probleme gestellt: als hätte die Katze einen „siebten Sinn“ dafür, dass ihr ein Tierarzt-besuch bevorsteht, ist sie häufig schon vor dem Anblick des Transportbehälters verschwunden. Eine hektische Suche, begleitet von den Lockrufen des Besitzers, die die Gesuchte wohlweislich ignoriert, beginnt. Ist die Katze dann endlich entdeckt, so hat man sie noch lange nicht eingefangen. Bei dem Versuch sie in den Käfig zu setzen wehrt sie sich nach Leibeskräften: sie beißt, kratzt und windet sich. Wenn sie dann schlussendlich nach wildem Kampf doch in der Transportbox untergebracht ist, sind alle Beteiligten schon reichlich gestresst.2
Im Rahmen meiner Facharbeit versuchte ich das Verhalten der Katze in der Tierarzt-praxis zu analysieren und anhand des Blutparameters Glucose Stress bei Katzen nachzuweisen.
2. Literaturübersicht
2.1 Definition „Stress“
„ Ein Organismus ist Streß unterworfen, wenn seine Anpassungsmechanismen über ihre normalen Grenzen strapaziert sind, entweder wegen der Intensität oder der Dauer der Stressreaktion.“ Valenstein (1976)3
Die „Kurzdefinition“ von Stress gestaltete sich schwierig, da in der mir zur Verfügung stehenden Literatur der Begriff „Stress“ entweder zu wissenschaftlich erklärt war oder jeder Autor krankheitsbezogen den Stress erklärte. Daher basiert der folgende Abschnitt im Wesentlichen auf nachstehend genannten drei Werken: der Physiologie des Menschen von R.F. Schmidt und G. Thews (Seite 663), der Allgemeinen Pathologie für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin von W. Frei (Seite 7) und der Vet. Med. Endokrinologie von Friedemanndöcke (Seite103,380).
„Streß bedeutet äußerste Anspannung aller vegetativen Funktionen, nämlich Atmung, Kreislauf und Stoffwechsel, zur Abwehr der Noxe und zur Wieder-herstellung der Homöostase.“4
Von Stress spricht man also, wenn krankmachende Faktoren im Körper neben den spezifischen Störungen zusätzlich einen komplexen Abwehrmechanismus hervorrufen. Dieser führt zu Reaktionen im Körper, die stets von einer Steigerung der Gluco-corticoidsekretion begleitet werden. Die andauernde Einwirkung der krankmachenden Faktoren, auch Stressoren genannt, führt zur eigentlichen Stressbelastung. Zu den Stressoren zählt man u.a. extreme Temperaturschwankungen, Durst, Hunger, lange Transporte, Infektionen, körperliche Anstrengungen, aber auch psychische Auseinandersetzungen mit dem sozialen Umfeld, wie Rangordnungskämpfe oder Konkurrenz um begrenzte Ressourcen. All diese Reize rufen zahlreiche Reaktionen des Organismus hervor, die mit einer Steigerung der Glucocorticoidsekretion einhergehen. Bei den Glucocorticoiden spielt besonders das Cortisol im Bezug auf Stress eine zentrale Rolle5, da es hauptsächlich im Einweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel wirkt und dort „einen erhöhten Ab- und Umbau der Eiweiße zu Glucose.“6 bedingt. Somit scheint der biologische Sinn von Stress darin zu bestehen, schnell verfügbare Energie bereitzustellen, die umgehend in die Blutlaufbahn abgegeben wird, um eine Leistungs-steigerung des Körpers zu erzielen und so die Überlebenschancen des Individuums zu steigern.7
Mit anderen Worten: „Der Organismus wird in höchste Spannung (Streß) und damit in den bestmöglichen Zustand versetzt, seine bedrohte Existenz- ganz allgemein gesprochen- durch Kampf und Flucht zu schützen bzw. im übertragenden Sinne Infekte, Infektionen und andere Noxen zu überwinden.“8
Hans Selye, der auch als „Vater der Stressforschung“ bezeichnet wird, nannte die unspezifische Körperreaktion auf die stressauslösenden Faktoren „Alarmreaktion“, die mit einer sympathikogenen Erregung einhergeht und deren Aufgabe es ist, die Widerstandsfähigkeit des Körpers wiederherzustellen. Bei anhaltender Reizeinwirkung geht die Alarmreaktion in das „Adaptionsstadium“ über, das begleitet wird von einer erhöhten Widerstandsfähigkeit des betroffenen Organismus. Gelingt es dem Körper, dank der hormonalen Umstellung, die Belastung auszugleichen, so wird die Stress-situation aufhören, andernfalls kommt es bei andauerndem Stress zum „Erschöpfungs-stadium“, das unter Umständen zum Tode führen kann.
Diese Stress-Trias, Alarmreaktion- Adaptionsstadium- Erschöpfungszustand, fasste Selye allgemein als „General Adaption Syndrome“ zusammen. Bei dem allgemeinen Anpassungssyndrom kommt es zu einer vermehrten Glucocorticoidausschüttung, die sich auf die Gluconeogenese auswirkt, d.h. es kommt zu einer gesteigerten Neubildung von Glucose. Hierbei konnten bei Katzen, die unter großem Druck standen, schon Blut-zuckerwerte bis zu 400 mg/dl gemessen werden.9 Zum Vergleich: die Normalwerte der Katze liegen bei 55-100 mg/dl.10
2.2 Verhaltensweisen von Katzen
Viele der Verhaltensmuster, die ich während meiner Praxisaufenthalte beobachten konnte und die in direktem Zusammenhang mit meiner Facharbeit wichtig sind, stammen aus dem Bereich der Angriffs- und Abwehrhandlungen, der Fluchtreaktionen, sowie der kindlichen Triebhandlungen.
Hat die Katze noch keine abschreckenden Erfahrungen mit Menschen gemacht, so zeigt sie dem Menschen gegenüber unbefangen das Flankenreiben, „Köpfchen geben“ und das Präsentieren der Genitalzone mit hochgestrecktem Schwanz - Verhaltensmerkmale, die man sowohl zwischen Katze und Kater, als auch zwischen Mutterkatze und Welpe beobachten kann.11
Körperhaltung und Mimik dagegen, die eindeutig dem Angriffs- oder Abwehrverhalten zugeordnet werden können, sind selten; meist überlagern sich beide Komponenten in unterschiedlicher Intensität. So sind beim „Katzenbuckel“ zum Beispiel, beide Stimmungen gleich stark vertreten: einerseits symbolisiert die Katze mit dem Katzen-buckel höchste Angriffs- andererseits auch stärkste Abwehrbereitschaft. Mit dem Vorderkörper weicht die Katze einer Gefahr, hier dem Tierarzt, aus, während die Hinterhand sich in einer Drohgebärde aufrichtet. Da die Hinterläufe der Katze länger als ihre Vorderläufe sind, rundet sich der Katzenrumpf zum sog. „Katzenbuckel“.
Erfahrungsgemäß überwiegt jedoch eine der zwei Komponenten: Körperhaltung und Mimik drücken dann die jeweilige Gefühlssituation der Katze aus.
2.2.1 Die Angriffshaltung
Bei der Angriffshaltung sind die Ohren steil aufgerichtet und soweit nach außen gedreht, dass die Ohrmuschel von vorne kaum noch sichtbar ist und nur die Rückseiten der Ohren zu erkennen sind. Die Pupillen der Katze sind zu kleinen Schlitzen verengt; ihr Blick ist starr auf den Gegner gerichtet.
Auch die Schnurrhaare können der Katze als Stimmungsbarometer dienen: sind sie breit gefächert und nach vorne gerichtet, so signalisiert die Katze Spannung und Aktions-bereitschaft. Die Lippen werden zurückgezogen und es erklingt ein furchteinflößendes Fauchen, Grollen oder Spucken. Auch wird eine Angriffshaltung durch peitschende Bewegungen mit dem Schwanz oder das Vorstrecken des Kopfes, bei dem der Nacken ungeschützt bleibt, verdeutlicht.12
2.2.2 Die Abwehrhaltung
Befindet sich eine Katze in Abwehrhaltung, so sitzt sie zusammengekauert, meist mit dem Rücken zur Käfigwand. Die Ohren sind nach hinten eingeknickt, sowie seitlich herabgezogen und liegen flach am Kopf an. Um den empfindlichen Nacken zu schützen, zieht die Katze den Kopf ein; dem Angreifer, in diesem Fall dem Tierarzt, dreht sie die Bauchseite und die vier Pfoten mit gespreizten Krallen zu. Beobachtet man eine abwehrbereite Katze, so sieht man sie immer nur mit Tatzenhieben kämpfen, da ein Biss den Nacken ungeschützt ließe. Ein weiteres auffallendes Merkmal der Abwehr-haltung sind die stark erweiterten Pupillen, bei denen die Iris kaum mehr zu erkennen ist- ein Kennzeichen der Adrenalinausschüttung. Einige Tiere haben zudem das Maul ein wenig geöffnet, so dass die Zähne sichtbar werden, während der Schwanz unwillig hin und her schlägt. Mit Spucklauten, fauchen oder knurren will die Katze signalisieren: “Komm’ nur! Ich habe keine Angst vor dir!“.13
Weiterhin kann man bei einer ängstlichen Katze ein gleichmäßig gesträubtes Fell am ganzen Körper beobachten. Bei einer angriffsbereiten Katze ist dies hingegen nur in einem schmalen Feld der Rückenlinie und am Schwanz der Fall.
Ziel der Abwehrhaltung ist die Flucht. Ist diese der Katze bei einem überlegenem Gegner oder einem versperrtem Fluchtweg verwehrt, so wandelt sich die Abwehr in einen Angriff um, der den Gegner zu einem Zurückweichen zwingen soll, um so eine Fluchtmöglichkeit zu erzielen.14
2.2.3 Das Fluchtverhalten
Die Fluchtreaktion an sich unterliegt den Gesetzen, die Hedinger zum Fluchtverhalten der Tiere fand: „Ein Tier flieht […] erst dann, wenn der Mensch eine gewisse Entfer-nung zu ihm unterschritten hat.“ Diese Entfernung nennt man Fluchtdistanz und wird wie folgt definiert: die Fluchtdistanz ist „… diejenige Entfernung […], auf die sich ein Mensch einem wilden Tier nähern muß, um es durch seine bloße Annäherung zur Flucht zu veranlassen.“ Meist genügt eine Flucht von wenigen Metern und die Flucht-distanz ist wiederhergestellt. Wird die Fluchtdistanz zu schnell unterschritten und der Abstand zum Verfolger noch kleiner, so ist an einem bestimmten Punkt die Wehrdistanz erreicht und es kommt zum Angriff. Wird die Katze also an ihrer Flucht gehindert, wie zum Beispiel in der Praxis, wenn sie auf dem Behandlungstisch festgehalten wird, so setzt „bei Unterschreitung einer gewissen Distanz, der kritischen Distanz, die kritische Reaktion ein“ und die Katze greift an. Dieser Angriff ist rein defensiv und muss daher als eine Art Notwehrreaktion verstanden werden. 15
3. Material und Methodik
3.1 Eigene Beobachtungen zu den Verhaltensweisen der Katze auf dem Behandlungstisch
Während meiner Praxisaufenthalte konnte ich bei den vorgestellten Katzen sowohl Angriffs, als auch Abwehr- und Fluchtverhalten beobachten.
Ängstliche Katzen versuchten sich in ihrem Käfig zu verstecken und zogen sich, so weit es ihnen möglich war, an die hintere Käfigwand zurück. Wollte man sie aus ihrer schützenden Deckung herausholen, so legten sie zwar die Ohren an, leisteten aber ansonst keinerlei Gegenwehr. Diese Tiere setzten häufig im Käfig Urin oder Kot ab, sei es bereits während der Fahrt zur Praxis, im Wartezimmer oder erst im Behandlungs-raum beim Herausnehmen aus dem Käfig.
Im Gegensatz dazu stand die angriffsbereite Katze: griff man zu ihr in den Käfig und unterschritt damit die kritische Distanz, so setzte sie sich auf die Hinterläufe, fauchte und schlug nach der Hand des Tierarztes.
Allen Katzen gemeinsam war deren Fluchtbereitschaft. Sobald sich ihnen die Möglich-keit zur Flucht bot, versuchten sie entweder wieder in den schützenden Käfig zu gelangen, oder sprangen vom Behandlungstisch und suchten ein Versteck. Bevorzugt wurden hier von allen Katzen dunkle Orte aufgesucht, wie z.B. unter dem Schreibtisch oder hinter der Röntgenanlage. Bei dem Versuch die fliehenden Katzen zu verfolgen, zeigten sie eine Flucht in die Deckung. Waren sie in die Enge getrieben, so legten sie die Ohren an, fauchten und demonstrierten die typischen Drohgebärden der Abwehr- und Angriffsreaktionen.
Selbst bei Katzenwelpen konnte ich dieses Verhalten feststellen. Wurden junge Katzen ohne Korb in das Behandlungszimmer gebracht, krallten sich die Kleinen panisch an die Besitzer und versuchten auf die Schulter und unter das Haar zu gelangen.
Daneben habe ich auch Katzen beobachten können, die völlig indifferent auf dem Behandlungstisch saßen und jegliche Behandlung über sich ergehen ließen. Diese Katzen jedoch zählten zu den seltenen Patienten.
3.2 Glucosebestimmung als Stressparameter
Da Stresssituationen von dem betroffenem Organismus immer mit einer Änderung des Blutzuckerspiegels beantwortet werden und die Höhe der gemessenen Glucosewerten eine objektive Aussage über den momentan empfundenen Stress darstellt, untersuchte ich die Glucoseausschüttung sowohl bei wachen Katzen, als auch bei narkotisierten Tieren. Zur exakten Bestimmung verwendete ich hierzu das Blutzuckermessgerät EuroFlash von der Firma Lifescan mit den dazugehörigen EuroFlash Teststreifen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Bild 1: von links nach rechts: EuroFlash Testreifen, EuroFlash Kontrolllösung, Schnellübersicht, Benutzerhandbuch, EuroFlash Messgerät, Lanzettengerät)
Die Blutentnahmestellen und die Entnahmetechniken variierten und sind im folgenden Teil beschrieben.
3.2.1 an wachen Tieren aus der vena antebrachii
Für die Blutentnahme aus der Vorderfußvene (vena antebrachii) wurden willkürlich gesunde Katzen im Behandlungsraum ausgewählt, deren Alter zwischen 1 Jahr und 10 Jahren lag.
Auf dem Behandlungstisch hielt eine Helferin die Tiere mit leichtem Griff im Genick fest. Um die Blutentnahme möglichst stressfrei durchzuführen, staute die Helferin anstatt mit einem Staustrick, nur mit Daumen und Zeigefinger die Vorderfußvene, indem sie die Katzenpfote mit festem Druck oberhalb des Ellenbogens umschloss.
(Bild 2: Fellkürzen an der Einstichstelle durch den Tierarzt)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Während des Stauvorgangs kürzte der Tierarzt mit einer Schere das Fell an der Einstichstelle. Da Katzen das Geräusch der Scheermaschine oft als unangenehm emp-finden und zu fliehen versuchen, wurde hier bewusst auf deren Verwendung verzichtet. Anschließend entnahm der behandelnde Tierarzt mit einer Einwegkanüle Nr.1 der Katze einen Tropfen Blut, das ich sofort mit dem Austreten aus der Kanüle auf ein Testplättchen des Mess-geräts Euro Flash auftrug. Binnen 15 Sekunden lag der gemessene Glucosewert in mg/dl vor.
3.2.2 an narkotisierten Tieren
3.2.2.1 aus der Ohrrandvene
Die Blutentnahme aus der Ohrrandvene wurde ausschließlich bei narkotisierten Katzen durchgeführt, die ich zuvor im Behandlungsraum willkürlich ausgewählt hatte. Unter den zu testenden Katzen befanden sich nur gesunde Tiere, die zwischen 6 Monaten und 10 Jahren alt waren.
(Bild 3)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Blutentnahme selbst erfolgte jeweils nach einem operativen Eingriff, entweder einer Kastration oder einer Sterilisation. Zur Blut-entnahme staute die Helferin die Vene, indem sie das Katzenohr zwischen Daumen und Zeigefinger zusammenpresste. Der Tierarzt punktierte die Ohr-randvene mit einer Kanüle Nr.1, wobei ich das austretende Katzenblut sofort auf das Testplättchen des Messgeräts Euro Flash auftrug (vgl. Bild 3). Von Interesse war, ob eine Operation den Katzenkörper trotz Narkose in Alarmbereitschaft versetzt, d.h. vermehrt Glucose ins Blut abgegeben wird, oder ob die Narkose für den Katzenkörper eine stressfreie Stoffwechsellage bedeutet.
3.2.2.2 Bei der Ohrtätowierung
Wie die Blutentnahme aus der Ohrrandvene wurde auch der Tätowierungsvorgang nur bei narkotisierten Tieren durchgeführt. Ich wählte die zu testenden Katzen, wie schon bei den vorherigen Versuchen, willkürlich und alterstunabhängig im Operationssaal aus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Bild 4: Tätowiervorgang)
Nach der jeweiligen Operation, Sterilisation oder Kastration, legte die Helferin das Katzenohr zwischen Druckplatte und Abstreiffeder der Tätowierzange (vgl. Seite 21, Anhang I) und presste deren Schenkel mit kräftigem Druck zusammen. Nach Öffnen der Zange traten dann meist einige Tropfen Blut aus den Einstich-stellen aus, die ich unverzüglich auf das Testplättchen des Messgeräts Euro Flash auftrug.
3.3 Befragung der Katzenbesitzer mit Hilfe eines Fragebogens
Um das Verhalten der Katze als tierärztlicher Patient aus der Sicht des Tierbesitzers zu beurteilen, fertigte ich einen Fragebogen mit 15 Fragen zum Verhalten der Katze in der Tierarztpraxis an (genauer Fragebogen siehe Seite 22, Anhang II). Neben den allgemeinen Angaben wie Alter und Geschlecht des Tieres, sollten die Tierbesitzer auch auf Fragen zu ihren Erfahrungen und Beobachtungen zum Verhalten ihrer Katze in der Tierarztpraxis und beim Einfangen in der gewohnten Umgebung eingehen. Den Frage-bogen verteilte ich willkürlich an Katzenbesitzer, die im Zeitraum zwischen Februar 2002 und August 2002 ihre Katze zum Tierarzt brachten und bat sie mir den Frage-bogen noch während ihres Praxisaufenthalts auszufüllen.
4. Ergebnisse und Interpretation
4.1 Auswertung der Blutergebnisse zur Glucosebestimmung
4.1.1. der wachen Tieren aus der vena antebrachii
4.1.1.1 bei weiblichen Katzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1
F ür die Blutentnahme aus der Vorderfußvene wurden neun weibliche Tiere unter-schiedlichen Alters ausgewählt und getestet. In obiger Tabelle 1 sind, nach dem Alter der Katzen geordnet, die einzelnen Ergebnisse aufgelistet. Auffällig ist hierbei, dass nur bei zwei der neun Tiere eine vermehrte Glucoseausschüttung im Blut festzustellen war. Da der normale Blutzuckerwert bei Katzen zwischen 55-100 mg/dl liegt, standen diese beiden Tiere folglich deutlich unter Stress. Interessant ist, dass es sich bei diesen gestressten Katzen bereits um ältere Tiere handelt. Gerade bei den jüngeren Katzen hätte ich eher einen höheren Glucosewert vermutet, da sie sich eingesperrt in einem Käfig, in einer ihnen unbekannten Umgebung mit neuen Gerüchen und fremden Menschen befanden. Ein Erklärungsversuch, warum die jungen Katzen stressfreier reagieren, wäre, dass junge Tiere besonders neugierig sind und in den meisten Fällen noch keine negative Erfahrung mit dem Tierarzt gemacht haben, so dass sie in dieser neuen Situation eine indifferente Haltung zeigen.
Bei der Gegenüberstellung der Blutglucosetestergebnisse und der Anzahl der Tierarzt-besuche pro Jahr, kam ich zum Ergebnis, dass alle stressfreien Katzen in ihrem Leben mindestens zwei Mal pro Jahr Patient in der Tierarztpraxis waren. Daraus lässt
sich schließen, dass die Katzen nicht nur zum Tierarzt gebracht wurden, wenn sie ernstlich verletzt waren, sondern auch zu Routinebehandlungen wie z.B. der Impfung oder Entwurmung. Da Katzen normalerweise „…von der Spritze und dem fast schmerzlosen Einstich der Nadel unbeeindruckt…“16 bleiben, liegt die Vermutung nahe, dass sie sich an den Tierarztbesuch gewöhnen können, sich also ein Lerneffekt einstellt. Solch ein Lerneffekt ist umgekehrt auch bei den gestressten Tieren feststellbar, allerdings nicht in der Form, dass sich die Katzen an den Tierarzt gewöhnen, sondern im Gegenteil, dass die Katzen die Tierarztpraxis mit einem schlimmen Erlebnis verbinden, wodurch ihr Körper ist in höchste Alarmbereitschaft versetzt wird.
4.1.1.2 bei männlichen Katzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2
Insgesamt testete ich das Blut von acht Katern, das aus der Vorderfußvene entnommen wurde. Bei drei dieser acht Kater lagen die Werte mit 113 mg/dl, 145 mg/dl und 178 mg/dl deutlich über dem Normwert von 55-100mg/dl (vgl. Tabelle 2). Auffallend ist hier das Alter der drei getesteten Tiere: sowohl ein recht junger Kater mit 2 Jahren, als auch ein alter Kater mit 10 Jahren wiesen einen erhöhten Blutglucosewert auf. Folglich ist der Blutglucosewert nicht eine Frage des Alters, sondern eher eine Frage der Stress-empfindung. (Eine altersbedingte Diabetes konnte im Falle des 10jährigen Katers ausgeschlossen werden.) Stellt man hier die Anzahl der Tierarztbesuche ins Verhältnis zum Alter, so findet man eine Gemeinsamkeit: bei jedem gestressten Tier lagen die Tierarztbesuche bezogen auf deren Alter unter drei Mal pro Jahr. Die stressfreien Kater hingegen waren alle öfter als drei Mal pro Jahr Patient in der Tierarztpraxis. Somit könnte man hier einen positiven Gewöhnungseffekt vermuten. Zwar steht diese Aussage im Widerspruch zu dem niedrigen Glucosewert des fünf Jahre alten Katers, der erst ein einziges Mal in der Tierarztpraxis war, dies erklärte ich mir aber so, dass dieser Kater noch keinerlei Erfahrungen mit dem Tierarzt gemacht hat, weder gute noch schlechte und folglich dem Tierarzt ganz neutral gegenüberstand.
4.1.2 der narkotisierten Tieren
4.1.2.1 aus der Ohrrandvene
4.1.2.1.1 bei weiblichen Katzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3
Nach ihrer Sterilisation wurde fünf weiblichen Katzen Blut aus der Ohrrandvene entnommen und auf ihren Glucoseanteil im Blut getestet (siehe Tabelle 3). Das Alter der Katzen lag zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, was dem normalen Sterilisationsalter entspricht. Die Blutzuckerwerte der fünf getesteten Tiere befanden sich alle im Normalbereich, d.h. der operative Eingriff in Vollnarkose, sowie die anschließende Venenpunktion konnte nicht als Stress mit einer vermehrten Glucoseaus-schüttung gemessen werden.
Auf eine Blutentnahme bei verunfallten Katzen verzichtete man bewusst, da anzunehmen ist, dass der Blutzuckerspiegel von diesen Tieren aufgrund des Unfall-schocks über den Normwerten liegt. Hinzu kommt, dass man den angeschlagenen Organismus nicht noch zusätzlich belasten wollte.
4.1.2.1.2 bei männlichen Katzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4
Ebenso wie bei der Blutentnahme aus der Ohrrandvene von weiblichen Katzen wurden auch beim männlichen Geschlecht nur gesunde Kater getestet, die zur Kastration gebracht wurden. Insgesamt untersuchte ich die Blutglucose von sieben Katern im Alter zwischen sechs Monaten und 10 Jahren (siehe Tabelle 4). Vergleicht man die beiden Tabellen 3 und 4 miteinander, so stellt man fest, dass sich die Glucosewerte nahezu ähnlich sind. Nur zwei Kater wiesen einen erhöhten Blutzuckerspiegel auf. Von dem gestressten 9-Monate alten Kater ist bekannt, dass er zum ersten Mal in der Tierarztpraxis war. Ob sich dieser Umstand allerdings auf seine Glucoseausschüttung zurückführen lässt, kann ich nur vermuten. Der einjährige Kater, dessen Wert mit 147 mg/dl deutlich über den Normalwerten lag, stand vor seiner Kastration bereits vier Stunden im Käfig eingesperrt in der Praxis, während der Praxisbetrieb normal weiter-lief. Dies könnte zu einer vermehrten Glucoseausschüttung geführt haben, da er Hunde und andere Katzen gesehen, gehört und gerochen hat, auf Grund seiner Gefangenschaft aber nicht seinem natürlichen Fluchttrieb folgen konnte und er somit seinen Körper in ständiger Angriffs- bzw. Abwehrbereitschaft hielt.
4.1.2.2 bei der Ohrtätowierung
4.1.2.2.1 bei weiblichen Katzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 5
Da das Tätowieren aufgrund seiner vielen kleinen Einstiche einen größeren Eingriff darstellt, als die Blutentnahme aus der Ohrrandvene, interessierte es mich, ob es Unter-schiede zwischen den beiden Blutentnahmetechniken im Bezug auf die Höhe des Glucosespiegels gibt. Hierzu erweiterte ich meine Versuchsreihe, indem ich von sechs Katzen das bei der Tätowierung austretende Blut testete (vgl. Tabelle 5). Die Ergebnisse waren erstaunlich. Obwohl die Tätowierung nur unter Vollnarkose durchgeführt wurde, lagen die hier gefundenen Glucosewerte deutlich über denen aus der Ohrrandvenen-entnahme. Nur bei zwei von sechs Katzen lag der Blutzuckerspiegel im Normalbereich. Die hohen Testergebnisse (bis zu 214 mg/dl) interpretierte ich so, dass bei der Tätowierung, trotz der Vollnarkose, ein akuter Schmerz bis ins Bewusstsein vordrang, was bei der Blutentnahme aus der Ohrrandvene wohl nicht geschah. Die Unterschiede zwischen den Entnahmetechniken waren folgende: Bei der Ohrrandvene stach der Tierarzt nur einmal kurz punktuell ein, während bei der Tätowierung flächendeckend Einstiche bzw. teilweise sogar ganze Durchstiche stattfanden. Da die Katzen jeweils im Anschluss an die Sterilisation tätowiert wurden, könnten die hohen Blutzuckerwerte auch ein Hinweis darauf sein, dass die Wirkung des Narkosemittels während des Tätowiervorgangs bereits nachließ.
4.1.2.2.2 bei männlichen Katzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 6
Auch Katern wurde bei der Tätowierung, nach vorangegangener Kastration, Blut entnommen, das ich auf den Glucosegehalt hin untersuchte. In oben stehender Tabelle 6 sind die Ergebnisse zusammengefasst. Obwohl alle Werte unter 100 mg/dl und damit im stressfreien Bereich lagen, sind nicht alle Kater bei der Tätowierung stressfrei gewesen: mit 49 mg/dl lag der Blutzuckerspiegel einer der Kater deutlich unterhalb von den Normalwerten. Dieser sog. „Unterzucker“ ist ebenfalls als ein Indiz für eine durchlebte Stresssituation zu werten, obgleich eine Stresseinwirkung im Normalfall mit einer Glucoseerhöhung einhergeht.
Des weiteren fielen mir Unterschiede bei der Stressempfindung zwischen Katzen und Kater auf. Eine mögliche Erklärung für diese unterschiedlichen Werte wäre, dass die Kastration des Katers nur einen „äußerlichen Eingriff“ darstellt, der in ca. fünf Minuten vorbei ist. Die Sterilisation des weiblichen Tieres hingegen zählt mit dem tiefgreifenden Eingriff in die Bauchhöhle, zu einer „richtigen“ Operation. D.h. Kater können bereits nach fünf Minuten tätowiert werden, während dies bei Katzen erst nach 20-25 Minuten der Fall ist. Meine Ergebnisse zeigen, dass mit der Narkose die Schmerzempfindung zwar ausgeschaltet ist, der Katzenkörper aber anscheinend auf die größere Gewebe-durchtrennung und die längere Zeitspanne der Stresseinwirkung, die die Sterilisation mit sich bringt, mit einer vermehrten Glucoseausschüttung ins Blut reagiert.
4.2 Auswertung des Fragebogens
Bei der Auswertung von 40 Fragebögen fand ich folgende Ergebnisse:
Von den befragten Katzenhaltern waren 24 Besitzer eines weiblichen und 16 Besitzer eines männlichen Tieres, von denen insgesamt nur ein einziger angab eine Stallkatze zu halten.
Des weiteren fragte ich nach der Häufigkeit der Tierarztbesuche, die ich getrennt nach Alter und Geschlecht in der Tabelle 7 zusammenfasst habe, die auf Seite 23 im Anhang III einzusehen ist. Mit Hilfe der Tabelle errechnete ich einen Mittelwert, der angab, wie häufig eine Katze im Mittel zum Tierarzt gebracht werden sollte, um sich an die Tierarztpraxis zu gewöhnen. Diese Ergebnisse verwendete ich bereits bei der Aus-wertung der Blutergebnisse (vgl. 4.1.1.1 und 4.1.1.2).
Bei einer weiteren Frage sollten die Besitzer beurteilen, ob sich ihre Katze mit häufigeren Tierarztbesuchen an die ungewohnte Situation anpassen oder sich von Besuch zu Besuch mehr aufregen und somit stressen würde. Die Antworten der Katzen-besitzer unterschieden sich bei dieser Frage erheblich im Bezug auf das Geschlecht ihres Heimtieres. Während 11 (55%) der 20 Besitzer von weiblichen Tieren ankreuzten, dass sich ihre Katze an die ungewohnte Situation anpassen würde, meinten dies nur 4 (25%) der insgesamt 16 Katerbesitzer.
Die Antworten auf die Frage, welches Verhalten die einzelnen Katzen beim Anblick des Käfigs zeigen, sind in den nachfolgenden Tabellen 8 und 9 dargestellt.
Weibliche Tiere
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 8
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 9
Die Ergebnisse der Frage „wie reagiert die Katze auf den behandelnden Arzt?“ fallen bei den Katzenbesitzern nahezu ähnlich aus. Die Besitzer der weiblichen Tiere antworteten dreimal mit „panisch“ (33,3%), zweimal mit „aggressiv“ (8,3%), viermal
mit „fauchend“ (16,6%), einmal mit „Ohren anlegend“ (4,2%), fünfmal mit „ängstlich“ (20,8%), viermal mit „neugierig“ (16,6%) und elfmal mit „normal“ (45,8%). Bei den Fragebögen der Katerbesitzer war einmal „panisch“ (6,25%), zweimal „aggressiv“ (12,5%), einmal „fauchend“ (6,25%), fünfmal „ängstlich“ (31,25%) und achtmal „normal“ (50%) angekreuzt.
Auffallend bei den Aussagen bezüglich des Verhaltens der Katze auf der Autofahrt war für mich, dass von 40 befragten Besitzern 30 angaben, dass ihre Katze maunzt. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erfahrungen, die sowohl Paul Leyhausen in seinem Buch „Katzenseele Wesen und Sozialverhalten“ (Seite 172) beschreibt als auch mit denen, die Dr. med. vet. Gisela Jöhnssen in der Zeitschrift „Lebendige Tierwelt“ (Seite 19) angibt: „…Die Fahrt im Auto ist für nahezu alle Katzen ein äußerst unangenehmes Erlebnis und meist tun sie dies mit lautem Geschrei kund…“.
Die übrigen Ergebnisse sind in nachfolgender Tabelle 10 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 10
Auch bei der Frage, ob sich das Verhalten der Katze mit dem Betreten der Praxis verändert, waren sich die Besitzer beider Geschlechter nahezu einig. Dass das Verhalten ihrer Katze unverändert bliebe, kreuzten bei den Katzenbesitzern 23 von 24, bei den Katerbesitzern 11 von 16 an. Die Angaben zur Verhaltensänderung unterschieden sich in „unruhiger“ (2x), „neugierig“ (1x) und „urinieren“ (1x).
Die Antworten auf das Katzenverhalten nach dem Tierarztbesuch (Frage 14) gliedern sich folgendermaßen auf:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 11
Bei der letzen Frage sollten die Halter beurteilen, ob bzw. wie sehr der Tierarztbesuch ihre Katze stresst. Hier war nicht nur die Verteilung bezüglich der Geschlechtertrennung interessant, sondern auch im Hinblick auf deren Alter.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 12
Nach den Angaben der Besitzer von männlichen Tieren, stehen Kater bei einem Tier-arztbesuch generell unter Stress. Bereits junge Kater zeigen ihren Besitzern Gesten des „Unbehagens“ und „Unwohlseins“. Bei den Katzen hingegen zeigt sich, dass ältere Tiere entweder, wenn sie sich in der Tierarztpraxis befinden sehr unter Stress stehen, oder sie sich an den Tierarztbesuch mehr oder weniger gewöhnen. Insgesamt konnte ich anhand des Fragebogens zu dem Ergebnis gelangen, dass die weiblichen Tiere, laut Angaben der Besitzer, schneller mit der ungewohnten Situation umzugehen verstehen, als ihre männlichen Geschlechtspartner.
5. Diskussion: Vergleich der Laborergebnisse mit den Besitzermeinungen
Beim Vergleich der Blutglucosewerte mit den Besitzerangaben fiel mir auf, dass viele Tierbesitzer das Verhalten ihrer Katze im Bezug auf den Stress in der Tierarztpraxis (Fragebogen Frage 15) „falsch“ einschätzten. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass viele Tierbesitzer selbst den Tierarztbesuch als Stress empfinden und diesen somit auch auf ihr Tier übertragen oder glauben, dass ihre Katze ähnlich empfindet. Ein weiterer Grund wäre, dass nur wenige Tierhalter die Gesten ihrer Katze verstehen und richtig interpretieren. Allein aus meinen eigenen Beobachtungen kann ich die Folgerung ziehen, dass einige Blutzuckerwerte von Katzen, die laut fauchten und wild um sich schlugen im Normalbereich lagen, während die Glucosewerte von Katzen, die geduckt auf dem Behandlungstisch saßen, den Normalbereich oftmals überschritten. Um heraus-zufinden wie groß die Abweichung zwischen den Blutergebnissen und den
Fragebögen ist, schrieb ich mir die Namen der Katzen sowohl zu den Blutergebnissen, als auch zu den Fragebögen auf und verglich sie miteinander. Insgesamt konnte ich auf diese Weise 15 Fragebögen exakt den passenden Blutwerten zuordnen, deren Aussagen für sich sprachen: nur ein einziger der befragten Besitzer lag mit seiner Annahme richtig. Bei den übrigen Katzen lagen 60% der Glucosewerte zwischen 70-89 mg/dl; die Katzen waren somit also alle nicht gestresst, obwohl ihre Besitzer diese Ansicht vertraten. Die restlichen 40% der Glucosewerte lagen deutlich über den Normwerten: Es konnten bis zu 185 mg/dl gemessen werden, während jeder der betreffenden Besitzer bei dieser Frage mit „ja, etwas gestresst“ geantwortet hatte. Daraus lässt sich schließen, dass es oftmals gar nicht so einfach ist an den sichtbaren Verhaltensweisen zu unterschieden, ob ein Tier unter Stress steht oder nicht, da sich Stress bei jedem Tier individuell und auf eine andere Art und Weise äußern kann.
6. Zusammenfassung
Obwohl Katzen bereits seit vielen Jahrhunderten von Menschen als Haustier gehalten werden, zeigen sie in typischen Situationen dennoch dieselben Verhaltensmuster wie Wildkatzen. Flucht-, Angriff- und Abwehrreaktionen treten unter Stresseinfluss deutlicher hervor und fallen daher den Besitzern in der Tierarztpraxis stärker auf als Zuhause in der gewohnten Umgebung. Da aber Verhaltensweisen immer subjektiv beurteilt werden, wollte ich einen objektiven Stressparameter zur Beurteilung heranziehen. Die von mir gewählte Blutglucosebestimmung hat sich als aussage-kräftiges Kriterium in den Untersuchungen erwiesen, wobei, wie meine Arbeit zeigt, die Entnahmetechnik und der Ort der Entnahme genau definiert werden müssen. So konnte ich zum Beispiel bei keiner der weiblichen Katzen eine Glucoseausschüttung bei der Entnahme aus der Ohrrandvene nachweisen, während bei der Tätowierung 66,6% der getesteten Katzen unter Stress standen. Unterschiede zwischen der Vorderfussentnahme an wachen Tieren und den Ohrrandvenenergebnissen im narkotisierten Zustand waren erstaunlicherweise nicht feststellbar gewesen. Dafür aber gab es geschlechtsspezifische Unterschiede: bei der Entnahme aus der Ohrrandvene waren ausschließlich die männlichen Tiere (28.6%) gestresst. Auch bei der Tätowierung wichen die Werte von-einander ab; insgesamt konnte bei 66,6% der getesteten Katzen eine Glucoseerhöhung gemessen werden, während dies bei den Katern nur bei 14,2% der Fall war.
Anhand meiner Blutglucoseergebnisse und dem Fragebogen kam ich zu folgender Fest-stellung: Katzen können in fremder Umgebung sowohl mit einer Stresszunahme reagieren (21,4%), als auch indifferente Verhaltensmuster zeigen (78,6%). Wie die einzelne Katze reagieren wird, war sogar für den Tierbesitzer schwer vorhersehbar. Dies zeigte sich auch darin, dass viele Besitzer ihr Tier im Hinblick auf Stresssituationen falsch einschätzten (Vergleich Besitzerantworten mit den Glucosewerten).
Um den Tierarztbesuch für den Besitzer, wie auch der Katze stressfreier gestalten zu können möchte ich zum Ende meiner Arbeit mehrere Möglichkeiten zur Stressvermeidung aufzeigen. Diese fangen bereits mit der Auswahl des richtigen Käfigs an: Weidenkörbe mit einem Metallgitter vor der Öffnung bringen einige Nachteile mit sich, die man leicht mit einem Transportbehälter aus Kunststoff, der eine heraus-nehmbare Gittertür sowie ein abnehmbares Oberteil besitzt, umgehen kann. Sie lassen sich wesentlich leichter reinigen und die Verletzungsgefahr für die Katze ist geringer, da sie sich nun nicht mehr zwischen Verschlussgitter und Korbrand hindurchzwängen kann. Für die Autofahrt sollte man den Transportbehälter mit einem Stück alten Teppichboden oder einem Sitzkissen auslegen, das den Boden komplett abdeckt und nach Verschmutzung ausgetauscht werden kann. Diese Einlagen bieten der Katze, im Gegensatz zu Handtüchern, auf der Fahrt einen guten Halt, da sie nicht verrutschen.17
Nach dem Käfig kommt die Wahl des besten Transportmittels. „Das beste und für die Katze am wenigsten belastende Transportmittel ist und bleibt das Auto.18 […] Je weniger sich die Katze beim Transport aufregt, desto besser ist schließlich auch der Behandlungserfolg.“19 Daher sollte man, wenn man selbst kein Auto besitzt entweder den Nachbarn um eine Mitfahrgelegenheit ersuchen, oder ein Taxi nehmen.
Im Wartezimmer kann der Tierbesitzer Stress vermeiden, indem er leise und beruhigend mit seiner Katze spricht, versucht den Geräuschpegel insgesamt so niedrig wie möglich zu halten, einen Sitzplatz wählt, der ruhig gelegen ist und jegliche Aufregung von der Katze fern hält.20
Auch im Behandlungsraum sollte der Besitzer einige Regeln beachten. Zum einen sollte nur der Tierarzt die Katze aus ihrem Korb nehmen, da es dem Vertrauen der Katze zu ihrem Halter sehr schaden könnte, wenn er es wäre, der sie aus ihrem schützenden Käfig ins grelle Licht zerren würde. Sobald man dem Tierarzt seine Beobachtungen zu den Krankheitssymptomen dargelegt hat, sollte der Besitzer den Behandlungsraum ver-lassen. Dies hat folgende Gründe: erstens ist „eine ungeschickte Hilfe schlechter als gar keine“21, zweitens haben die meisten Tierärzte ohnehin eine gutausgebildete Kraft, die weiß, wie sie auch wehrhafte Katzen ruhigstellen können und drittens überträgt sich nicht selten die angespannte Erregung des Katzenhalters auf sein Tier, das ohnedies bereits unter Stress steht.
Um einen stressfreien Behandlungsablauf zu gewährleisten, sollte sich aber auch der Tierarzt an einige Regeln halten. Wenn möglich sollte er die Katze während und nach der Behandlung streicheln, ihr ruhig zuzureden und alle hastigen und ruckhaften Bewegungen unterlassen, da diese die Katze unter Umständen erschrecken könnten. Auch sollte er sie so behandeln, als wären alle Maßnahmen selbstverständlich, dadurch verliert sie das Gefühl, dass etwas Schlimmes mit ihr geschehen soll und sie gewinnt Vertrauen.22 Nach der Behandlung wird der Besitzer der Katze wie ein „edler Held“ vorkommen, der sie „aus der Todesgefahr gerettet hat, und die dankbare Katze wird womöglich noch anhänglicher“ werden.23 Wenn man eine junge Katze gleich mit diesen Maßnahmen konfrontiert, steht einem „stressfreien Tierarztbesuch“ im Normalfall nichts mehr im Wege.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(A) Rändelschraube
(B) Verschluss
(C) Ziffernkasten
(D) Abstreiffeder
(E) Druckplatte
(Entnommen aus der Bedienungsanleitung)
Umfrage zu meiner Facharbeit im Fachbereich Biologie über
„Das Verhalten von Katzen in der Tierarztpraxis“ :
1. Geschlecht Ihrer Katze ( ) männlich ( ) weiblich
2. Das ungefähre Alter Ihrer Katze _____ Jahre ____ Monate
3. Ist Ihre Katze eine ( ) Hauskatze oder ( ) Stallkatze? (zutreffendes bitte ankreuzen)
4. Hat Ihre Katze ständigen Kontakt zu Menschen? ( ) Ja ( ) Nein
5. Auch zu fremden Personen? ( ) Ja ( ) Nein
6. Hat Ihre Katze bereits Erfahrungen mit dem Tierarzt gemacht?
( ) Ja ( ) Nein
7. Wenn ja, wie oft waren Sie schon mit Ihrer Katze beim Tierarzt? ____mal
8. Sind Sie der Meinung, dass sich Ihre Katze bei häufigeren Praxisbesuchen (Bitte nur eines ankreuzen!!)
( ) an die ungewohnte Situation anpasst und sie gelassener nimmt
( ) stresst und von Mal zu Mal mehr aufregt
9. Wie reagiert Ihre Katze auf den Anblick des Käfigs
a) zuhause:
( ) panisch ( ) ängstlich ( ) neugierig ( ) normal
b) in der Praxis:
( ) panisch ( ) ängstlich ( ) neugierig ( ) normal
( ) erleichtert ( ) _________
10. Wie reagiert sie auf den Anblick des behandelnden Arztes?
(mehrere Antworten möglich)
( ) panisch ( ) aggressiv ( ) fauchend ( ) Schwanz schlagend ( ) Ohren anlegend ( ) ängstlich ( ) normal ( ) neugierig
( ) schnurrend ( ) anschmiegsam
11. Wie verhält sich Ihre Katze auf der Fahrt? (mehrere Antworten möglich)
( ) Schläfrig/ gelangweilt ( ) unruhig ( ) scharrt
( ) maunzt ( ) ängstlich ( ) panisch
12. Sind Sie der Meinung, dass sich das Verhalten Ihrer Katze mit dem Betreten der Praxis verändert?
( ) Nein
13. Wenn ja, wie? (Mehrere Antworten möglich)
( ) unruhiger ( ) sträubt das Fell ( ) faucht ( ) pinkelt
( ) maunzt klagend ( ) neugierig ( ) ________
14. Wie verhält sie sich nach dem Tierarztbesuch? (Mehrere Antworten möglich)
( ) beleidigt ( ) verkriecht sich ( ) normal ( ) gereizt
( ) ängstlich ( ) misstrauisch
15. Würden Sie sagen, dass der Praxisbesuch Ihre Katze stresst?
( ) Ja, sehr ( ) Ja, etwas ( ) normalerweise nicht ( ) überhaupt nicht
Für Ihre Mithilfe möchte ich mich herzlich bedanken
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 7
Literaturverzeichnis
Bücher und Zeitschriften:
1. Bundesverband Lebendige Tierwelt. Nr. 1, 1. Quartal 1998
praktischer Tierärzte:
2. Friedemanndöcke (Hrsg.): Veterinärmedizinische Endokrinologie. Jena, Stuttgart, 1994, 3. Auflage
3. Forth, Wolfgang (Hrsg.): ALLGEMEINE UND SPEZIELLE
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE für
Studenten der Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie,
Chemie, Biologie sowie für Ärzte und Apotheker.
Mannheim, Wien, Zürich, 1977, 2., überarb. u. erw. Aufl.
4. Frei, Walter: ALLGEMEINEN PATHOLOGIE für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin. Berlin, 1972, 6., neubearbeitete Aufl.
5. Jöhnssen, Dr. med. vet Einer wird gewinnen…. In: Bundesverband praktischer Gisela: Tierärzte: Lebendige Tierwelt. Nr. 1, 1. Quartal 2002
6. Kraft, Wilfried und KATZEN KRANKHEITEN Klinik und Therapie.
Dürr, Ulrich M.(Hrsg.): Hannover, 1978
7. Kraft, Wilfried und Kompendium der Klinischen Labordiagnostik bei
Dürr, Ulrich M.: Hund Katze Pferd. Hannover, 1981, 2., erweiterte Aufl.
8. Leyhausen, Paul: KATZENSEELE: Wesen und Sozialverhalten. Stuttgart, 1996
9. Leyhausen, Paul: Katzensprache. In: Müller, Ulrike: Katzen halten mit Herz und Verstand. München, 1984, 8. Aufl. 1993
10. Rotter, W. (Hrsg.): LEHRBUCH DER PATHOLOGIE für den Abschnitt der ärztlichen Prüfung. Stuttgart, 1975, Band 1
11. Schmidt, Robert F. und Physiologie des Menschen. Berlin, Heidelberg, 1936, 19., Thews, Gerhard (Hrsg.): überarbeitete Aufl. 1977
12. Vet Med Labor: VETERINÄRMEDIZINISCHES
LEISTUNGSVERZEICHNIS: Das Labor für Tierärzte. 1999
13. Vogel, Günter: Atlas zur Biologie. München, 1968, Band 2
Internetbeiträge:
http://www.zooplus.de/zooclub.asp?t=2291 aufgerufen am 27.01.2003
Danksagung
Ganz herzlich bedanke ich mich bei dem Praxisteam der Kleintierpraxis ... in ... für die Unterstützung bei der Blutentnahme, sowie für die fachliche Beratung und die Bereitstellung der Gerätschaften.
Auch gibt mein Dank all jenen Tierbesitzern, die sich die Zeit nahmen mir meinen Fragebogen zu beantworten und die mir erlaubten Ihre Tiere zu untersuchen.
Ich erkläre hiermit, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benützt habe.
, den . ...
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei enthält eine Facharbeit zum Thema "Das Verhalten von Katzen in der Tierarztpraxis". Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, eine Literaturübersicht (Definition von Stress, Verhaltensweisen von Katzen wie Angriffs-, Abwehr- und Fluchtverhalten), Material und Methodik (eigene Beobachtungen, Blutglucosebestimmung als Stressparameter bei wachen und narkotisierten Tieren, Befragung der Katzenbesitzer), Ergebnisse und Interpretation der Blutergebnisse und Fragebögen, eine Diskussion und eine Zusammenfassung.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt die steigende Anzahl von Haustieren, insbesondere Katzen, und die Herausforderungen, die Tierarztbesuche für Katzenbesitzer darstellen. Es wird auch die Zielsetzung der Facharbeit erläutert, nämlich die Analyse des Katzenverhaltens in der Tierarztpraxis und den Nachweis von Stress anhand des Blutparameters Glucose.
Welche Stressdefinition wird verwendet?
Die Arbeit verwendet verschiedene Definitionen von Stress aus der Literatur, wobei der Schwerpunkt auf der Reaktion des Organismus auf belastende Faktoren und der damit verbundenen Steigerung der Glucocorticoidsekretion liegt. Es wird auch das "General Adaption Syndrome" von Hans Selye (Alarmreaktion, Adaptionsstadium, Erschöpfungsstadium) erwähnt.
Welche Verhaltensweisen von Katzen werden beschrieben?
Beschrieben werden Angriffs-, Abwehr- und Fluchtverhalten. Die Arbeit geht auf Körperhaltung, Mimik und spezifische Verhaltensweisen in Bezug auf diese Kategorien ein.
Wie wurde die Blutglucosebestimmung durchgeführt?
Die Blutglucosebestimmung wurde sowohl bei wachen Katzen aus der Vena antebrachii als auch bei narkotisierten Katzen aus der Ohrrandvene und bei der Ohrtätowierung durchgeführt. Das Blutzuckermessgerät EuroFlash wurde zur Messung verwendet.
Welche Informationen wurden durch die Befragung der Katzenbesitzer gewonnen?
Mithilfe eines Fragebogens wurden Informationen zum Verhalten der Katzen in der Tierarztpraxis, beim Einfangen und während der Autofahrt gesammelt. Die Fragebögen enthielten Fragen zu Alter, Geschlecht des Tieres und den Erfahrungen der Besitzer mit dem Tierarztbesuch.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Blutanalyse?
Die Ergebnisse zeigen Unterschiede im Stresslevel der Katzen je nach Entnahmetechnik, Geschlecht und Häufigkeit der Tierarztbesuche. Bei einigen Tieren konnte eine erhöhte Glucoseausschüttung als Stressreaktion nachgewiesen werden.
Welche Schlussfolgerungen werden aus den Fragebögen gezogen?
Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass viele Tierbesitzer das Stresslevel ihrer Katzen falsch einschätzen. Zudem scheint es Unterschiede im Stressverhalten zwischen weiblichen und männlichen Tieren zu geben.
Wie werden die Laborergebnisse mit den Besitzermeinungen verglichen?
Die Ergebnisse zeigen eine Diskrepanz zwischen den gemessenen Blutzuckerwerten und den subjektiven Einschätzungen der Besitzer zum Stresslevel ihrer Katzen. Dies deutet darauf hin, dass es schwierig sein kann, Stress bei Katzen anhand des Verhaltens allein zu beurteilen.
Welche Empfehlungen zur Stressvermeidung werden gegeben?
Die Arbeit schlägt verschiedene Maßnahmen zur Stressvermeidung vor, beginnend mit der Auswahl des richtigen Transportbehälters und Transportmittels bis hin zum Verhalten im Wartezimmer und Behandlungsraum. Auch der Tierarzt sollte sich an bestimmte Verhaltensregeln halten, um den Stress für die Katze zu minimieren.
- Quote paper
- Miriam Viehmann (Author), 2003, Das Stressverhalten der Katze in der tierärztlichen Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108206