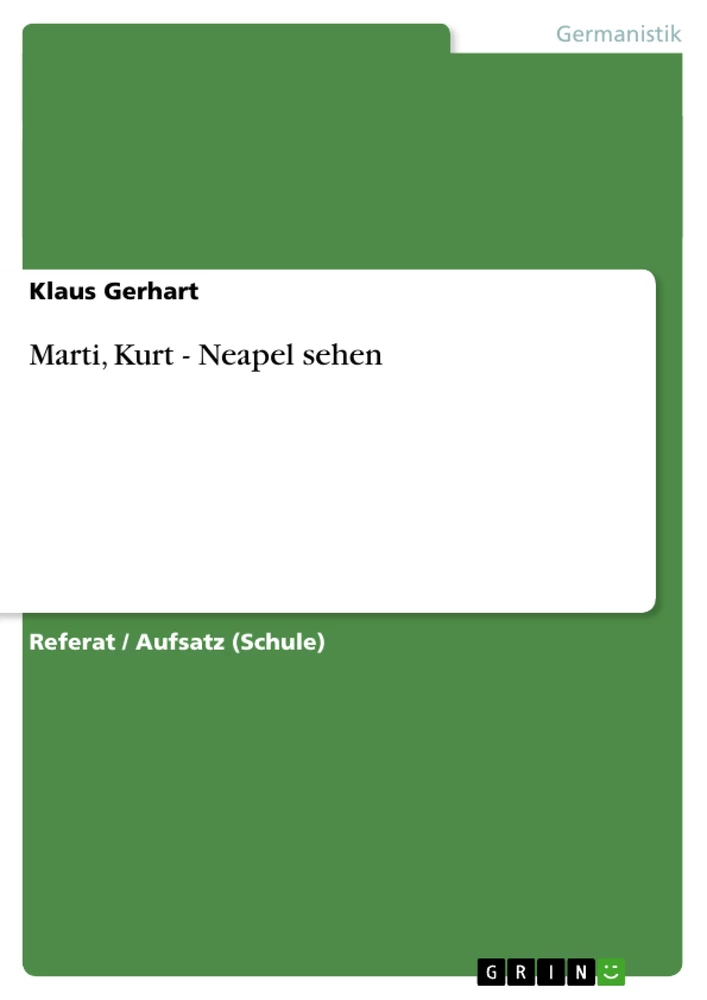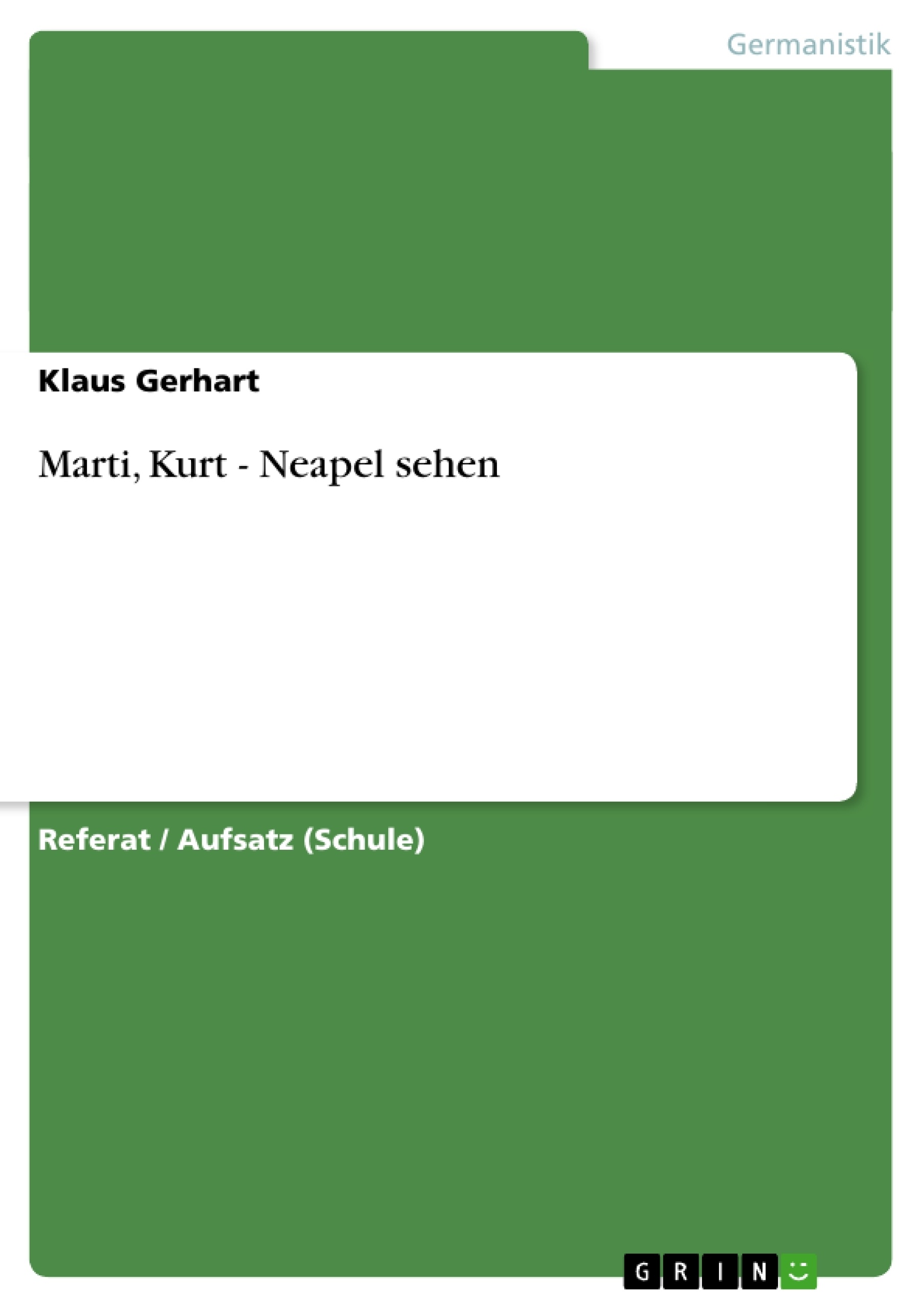Was bedeutet es wirklich, "Neapel sehen und sterben"? Kurt Martis ergreifende Kurzgeschichte entführt uns in die Welt eines alternden Fabrikarbeiters im Westdeutschland der Wirtschaftswunderzeit, dessen Leben zwischen monotoner Akkordarbeit und dem Traum von einem besseren Leben gefangen ist. Nach Jahren schweißtreibender Arbeit zwingt ihn Krankheit, seine geliebte, aber auch verhasste Fabrik aus der Ferne zu betrachten, getrennt durch eine Bretterwand, die mehr verbirgt als nur die Fabrikhalle. Getrieben von einer Mischung aus Nostalgie, Entfremdung und der Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit, lässt er diese Wand Stück für Stück entfernen, um sich seiner ganz persönlichen Vorstellung von "Neapel" hinzugeben. Marti seziert auf eindringliche Weise die widersprüchliche Beziehung des Mannes zu seiner Arbeit, die einerseits Quelle seines Wohlstands ist, andererseits aber auch seine Gesundheit und Lebensqualität untergräbt. Die Geschichte ist ein Spiegelbild der damaligen Zeit, in der der materielle Wohlstand über alles gestellt wurde, und wirft gleichzeitig zeitlose Fragen nach dem Wert der Arbeit, der Bedeutung von Lebensqualität und der individuellen Freiheit auf. Ist es möglich, Erfüllung in einer entfremdenden Arbeitswelt zu finden, oder opfern wir unsere Lebenszeit für einen trügerischen Traum? Martis Erzählung regt zum Nachdenken über unsere eigenen "Neapel" an und darüber, was wir bereit sind, für sie zu opfern. Eine Geschichte über Arbeit, Entfremdung, die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben und die Suche nach dem persönlichen "Neapel", die den Leser noch lange nach der letzten Seite beschäftigt. Ein literarisches Kleinod, das die großen Fragen des Lebens in einer scheinbar einfachen Geschichte verhandelt und dabei die Ambivalenz menschlicher Existenz schonungslos offenbart. Die prägnante Sprache und die symbolträchtige Darstellung machen "Neapel sehen" zu einem unvergesslichen Leseerlebnis, das zum Nachdenken über die eigene Work-Life-Balance und die wahren Werte im Leben anregt. Eine Pflichtlektüre für alle, die sich mit den Themen Arbeit, Identität und der Suche nach dem Sinn des Lebens auseinandersetzen möchten.
Interpretation Kurt Marti „Neapel sehen“
Wachsender Wohlstand und abnehmende Arbeitszeit verändern langsam das Freizeitverhaltender Westdeutschen. Obwohl der Hang zur Häuslichkeit in den 50er Jahren noch dominiert, steigt die Nachfrage nach Ferienreisen ständig. 1960 verreist bereits ein Drittel der westdeutschen Bevölkerung. Viele Bundesbürger träumen von fernen Ländern. An der Spitze der Wunschskala steht ein Besuch Italiens. Mitte der 50er Jahre reisten bereits 4,5 Millionen Deutsche dorthin. „Neapel sehen und sterben“ ein Ausspruch Homers aus der Antike, um die Einmaligkeit dieser Stadt zu umschreiben- aufgegriffen von berühmten Persönlichkeiten vieler Jahrhunderte- ein Ausspruch, elliptische von Kurt Martin verwendet, scheint auf diese Schönheit Italiens hinzuweisen. Ein Ausspruch, der Urlaub, Wärme und Entspannung assoziiert. Doch meint der Autor dies auch so? Diesem und anderen Aspekt/en werde ich versuchen nachzugehen.
Die Kurzgeschichte „Neapel sehen“ wurde in den 60er Jahren verfasst, in eben oben benannter Zeit des Wirtschaftswunders in Westdeutschland. Kurt Marti erlebte diese Zeit intensiv mit. Wenn auch in Bern geboren (1921) und dort als Pfarrer seit 1961 tätig, reiste er damals viel nach Deutschland und verbrachte ebenfalls längere Zeit dort. In der Erzählung des Schweizer Theologen geht es um einen älteren Arbeiter der nach jahrelanger schwerer Tätigkeit in einer Fabrik arbeitsunfähig wird. Von zuhause aus kann er das Leben in seinem Werk nur noch erahnen, obwohl die Sicht darauf nur eine Bretterwand behindert. Diese lässt er stückweise abnehmen und stirbt nach deren vollständigen Entfernung glücklich.
Die widersprüchliche Haltung des Mannes zu seiner Arbeit, sein Hass als Ausdruck seiner Ohnmacht gegenüber des notwendigen Arbeitsprozesses, um seinen Wohlstand und seine Lebensqualität zu erhalten, stehen im Mittelpunkt und somit in der Kritik Kurt Martis. Er möchte uns davor bewahren, stupide Arbeiter zu werden, die schließlich aufgrund der Schwere ihrer Arbeit erkranken oder gar sterben, somit ihren erwirtschafteten Lebensabend nicht mehr genießen bzw. erreichen können. Allerdings zeigt uns der Autor auch, dass die Tätigkeit dem Leben einen Sinn zukommen läst, ohne den das Leben ebenfalls nicht mehr lebenswert ist. Ein Thema also, dass nicht nur die Zeit damals anspricht, sondern heute noch aktueller erscheint.
Ein älterer Mann, unsere Hauptfigur, lebt mit seiner Frau in einigem Wohlstand. An seinem erwirtschafteten Haus befindet sich ein kleines Gärtchen, welches durch einen Bretterzaun die Sicht auf die gegenüberliegende Fabrik versperrt – die Fabrik, in welcher der Mann Akkordarbeit verrichtete (fleißig und unermüdlich), die er deshalb hasst, aber auch braucht. Nun ist er krank und liegt daheim im Bett. Die Frau tritt wenig in Erscheinung, nur als Gesprächspartner oder ausführender Part. Dies gilt ebenfalls für den Arzt und den Nachbarn. Das Paar scheint schon viele Jahre verheiratet und „er“ spricht oft von Hass zu ihr, wenn sie ihm wieder einmal sagt, dass ihm nachts die Hände zuckten. Dabei richtet sich wahrscheinlich dieser Hass nicht gegen seine Frau, sondern schon hier gegen seine Arbeit, die ihm „Akkord“ (Z.12) abverlangte- eine Arbeit im „schnellen Stakkato“ (Z.12). Wichtig war diese Tätigkeit für das Ehepaar, denn wie schon eingangs erwähnt, hieß es in den 50er und 60er Jahren Hohlstand schaffen, um sich Haus und Urlaub, wie zum Beispiel in das beliebte Italien, nach Neapel, leisten zu können.
In hauptsächlich personaler Erzählwiese berichtet uns der Autor über das Geschehen. Nüchtern distanziert ermöglicht uns Marti den Blick auf das Leben des Hauptprotagonisten. Symbolträchtig teilt er hier seine Gedanken in zwei wichtige Sinnabschnitte: dem Teil, in dem uns die Arbeit in der Fabrik unpersönlich nahegebracht wird. Diese Tätigkeit kennzeichnet Maschinen, Akkordarbeit, Hetze und Zahltag. Und dem Teil, in dem sich der Mann die Fabrik als Neapel aufbauen lässt- eine Illusion aus Rauch, Menschenstrom, Autos, Kantine und Büro. Eine Illusion, hervorgerufen durch die Distanz zur Fabrik nach der Arbeitsunfähigkeit. Beide Teile, einsträngig linear gestaltet, umschließen einen Zeitraum von 5 Wochen, so Dass der Autor hauptsächlich eine Zeitraffung angewendet hat, um letztendlich die Akkordarbeit des Mannes kurz beschreibend zu unterstreichen, dem Leser die Schnelligkeit der Arbeit und des Verfalls des Menschen nach ausgebrochener Krankheit zu verdeutlichen. Einzig und allein die Beschreibung der neuen Situation der Erkrankung erlaubt eine Zeitdeckung, um uns kurz das Geschehen nahe zubringen, zu veranschaulichen.
Stellt man sich die Gesamtsituation bildlich vor, so befindet man sich in einem unteren Raum des Hauses, in welchem das Bett des Kranken steht. Von hier aus betrachtet er „sein Gärtchen“ (Z. 20) und den „Abschluss des Gärtchens, die Bretterwand...“ (Z.211). Diese ermöglicht ihm nicht nur mehr Blick nach draußen, zur Fabrik. Symbolträchtig befindet sich der Mann in sogenannter Gefangenschaft, die Krankheit fesselt ihn ans Bett, lässt ihm keinen Handlungsspielraum.
Im Kontrast dazu lebt die Fabrik, seine ehemalige Arbeitsstätte, „die Kantine, die Büros und das sogenannte Fabrikareal“ (Z.44-46). An diesem Leben kann er nun nicht mehr teilnehmen, obwohl es ihm vorher verhasst war. Die Hetze, die Akkordarbeit, das Tempo der Maschinen oder auch nur der Meister, der ihm eine leichtere Arbeit geben wollte „aus verlogener Rücksicht“ (Z.15). Trotzdem war ihm die Arbeit wichtig, nicht nur um seinen Wohlstand zu schaffen, seinen Lebensabend zu sichern, sondern auch nur, um seinen wissen, dass er gebraucht wir. Aktivität, Freunde, Leben und Hetze, Anspannung und Stress gegenüber. Nun lauert die Monotonie der Krankheit, Ruhe, Passivität. Somit idealisiert der Mann seine Fabrik zu seinem Neapel. Diese Vorstellung wird in ihm übermächtig, so dass die Bretterwand, die ihm bisher die Privatsphäre gewahrt hat, die Distanz zum Werk, im Jenes trennende Symbol soll verbindendes werden, die Nähe zum eben herstellen. Dies geschieht Stück für Stück mit Hilfe seiner Frau und des Nachbarn. Endlich ruht zärtlich der Blick des Kranken auf seiner Fabrik. Nach ca. 14 Tagen stirbt der Mann entspannt und mit einem Lächeln. Nun sah er sein Neapel und konnte sterben. Homers Spruch erfüllt sich bei ihm.
Geschickt wählte Kurt Marti parataktische Sätze (Die Frau erschrak. Sie lief zum Nachbarn. Z.33), die in die Alltagssprache eingebettet sind. So wird noch klarer, dass es sich hier um einfache Leute, eben Arbeiter handelt. Weiterhin erscheint das Geschehen noch schneller abzulaufen, je kürzer die Sätze, je einfacher der Satzbau. Der Autor verwendet Anaphern, um zum Beispiel gefühlsverstärkend gebraucht. Desgleichen finden wir Parallelismen, wie „Bretterwand“ – auch ausdrucksverstärkend gebraucht. Auffällig ist die Wortwiederholung von „hasste“, insgesamt 10 mal, welche hier deutlich das Verhältnis des Mannes zur Fabrik verdeutlicht. Stellvertretend für viele Menschen bekommt das Personalpronomen „er“, den Mann bezeichnend, eine überindividuelle Bedeutung.
So gibt Kurt Marti einen Einblich in das Leben, die Psyche eines Arbeiters in den 50er Jahren. Wir können uns durch die besonders symbolsastige Darstellung in den Hauptprotagonisten hineinversetzen, könnten sein Handeln nachvollziehen. Natürlich ist diskussionswürdig, wo der Lebenssinn eines Mannes liegt, wann das Leben sinnlos wird!? Aber diese Frage muss wohl jeder für sich selbst beantworten und diese Entscheidung sollte dann auch eine individuelle sein. Die Kunst bleibt die, den Sinn zu finden und ihn zu verwirklichen. Also kann man sogar sagen, dass Martis Geschichte allgemeingültig für unser Jahrhundert ist. So wählte der Autor bestimmt mit Bedacht eine Kurzgeschichte. Denn so unvermittelt, wie diese beginnt, so offen bleibt auch der Schluss. Zwar stirbt hier die Hauptperson, doch viele Fragen bleiben unbeantwortet.
Häufig gestellte Fragen zu Kurt Martis "Neapel sehen"
Worum geht es in Kurt Martis Kurzgeschichte "Neapel sehen"?
Die Kurzgeschichte handelt von einem älteren Arbeiter, der nach jahrelanger schwerer Arbeit in einer Fabrik arbeitsunfähig wird. Von zu Hause aus kann er das Leben in seinem Werk nur noch erahnen, obwohl die Sicht darauf nur eine Bretterwand behindert. Diese lässt er stückweise abnehmen und stirbt nach deren vollständigen Entfernung glücklich.
Welche Themen behandelt die Geschichte?
Die Geschichte behandelt die widersprüchliche Haltung des Mannes zu seiner Arbeit, seinen Hass als Ausdruck seiner Ohnmacht gegenüber des notwendigen Arbeitsprozesses, um seinen Wohlstand und seine Lebensqualität zu erhalten. Kurt Marti kritisiert, dass Menschen zu stupiden Arbeitern werden, die schließlich aufgrund der Schwere ihrer Arbeit erkranken oder gar sterben. Er zeigt aber auch, dass die Tätigkeit dem Leben einen Sinn verleihen kann.
In welcher Zeit spielt die Geschichte?
Die Geschichte spielt in den 60er Jahren, in der Zeit des Wirtschaftswunders in Westdeutschland.
Welche Rolle spielt die Bretterwand in der Geschichte?
Die Bretterwand symbolisiert die Trennung des Mannes von seiner Arbeit und seinem früheren Leben. Stückweise lässt er sie entfernen, um wieder eine Verbindung zur Fabrik herzustellen, die er nun idealisiert.
Was bedeutet "Neapel sehen" in der Geschichte?
"Neapel sehen" ist eine Metapher für die idealisierte Vorstellung des Mannes von seiner Fabrik und seinem Arbeitsleben. Es symbolisiert seinen Wunsch nach Aktivität, Anerkennung und einem Lebenssinn, den er in der Fabrik gefunden hat.
Wie ist die Erzählperspektive in der Geschichte?
Der Autor erzählt die Geschichte hauptsächlich aus personaler Erzählperspektive, wodurch er den Blick auf das Leben des Hauptprotagonisten ermöglicht.
Welche sprachlichen Mittel verwendet Kurt Marti?
Kurt Marti verwendet parataktische Sätze, Anaphern, Parallelismen und Wortwiederholungen, um die Geschichte eindringlicher und die Gefühle des Mannes deutlicher darzustellen.
Was ist die Bedeutung des Todes des Mannes am Ende der Geschichte?
Der Tod des Mannes, nachdem er seine Fabrik ("sein Neapel") gesehen hat, deutet darauf hin, dass er seinen Lebenssinn gefunden hat und nun in Frieden sterben kann. Es ist eine Erfüllung des Zitats "Neapel sehen und sterben".
Welche Kritik übt Kurt Marti in der Geschichte?
Kurt Marti kritisiert die Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit und die Ausbeutung durch Akkordarbeit, die zu Krankheit und Tod führen kann. Er hinterfragt den Sinn des Lebens und die Bedeutung von Arbeit für den Einzelnen.
Ist die Thematik der Geschichte auch heute noch relevant?
Ja, die Thematik der Geschichte ist auch heute noch relevant, da sie Fragen nach dem Sinn der Arbeit, der Work-Life-Balance und der Bedeutung von Anerkennung und sozialer Interaktion im Arbeitsleben aufwirft.
- Arbeit zitieren
- Klaus Gerhart (Autor:in), 2003, Marti, Kurt - Neapel sehen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108193