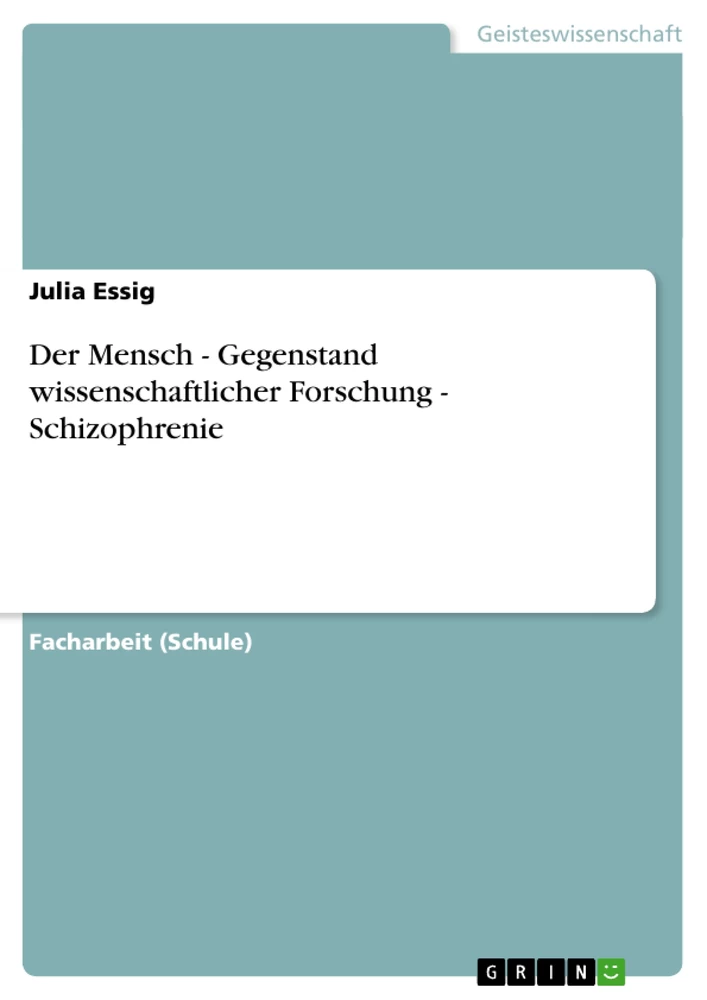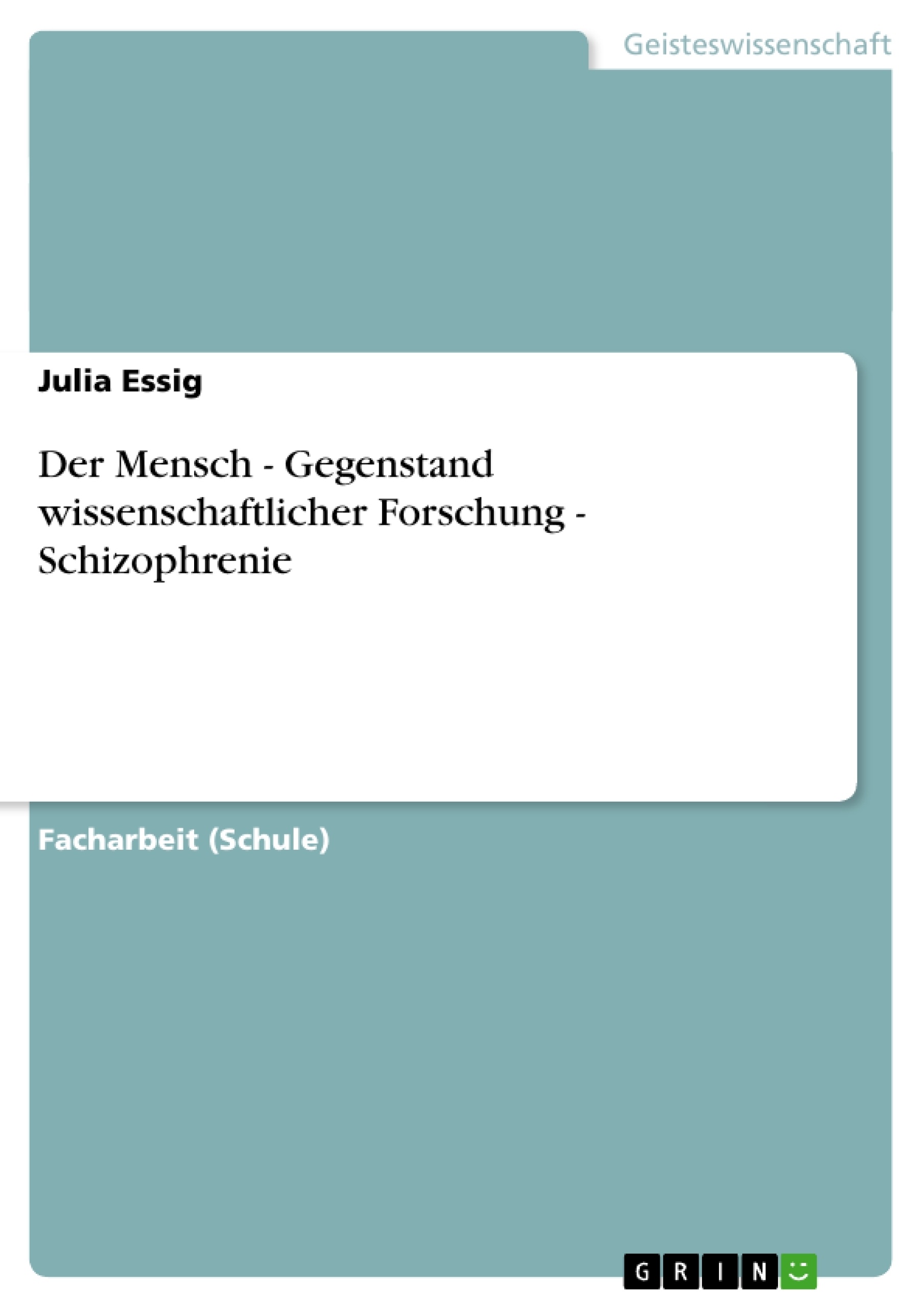Inhaltsverzeichnis
Erfahrungen Schizophrenie- Erkrankter
Vorwort
1. Definition des Krankheitsbildes
1.1 Historische Ansätze
1.2 Aktuelle Ansätze
2. Vorkommen
2.1 Wer ist besonders gefährdet?
2.2 Prozentuale Erkrankungen in USA und Deutschland
3. Ursachen
3.1 Breeder-Hypothese
3.2 Drift-Hypothese
3.3 Fehldiagnosen und Abgrenzungen gegen affektive Psychosen
4. Symptome/Erscheinungsbilder
4.1 Symptome nach Kurt Schneider
4.1.1 Symptome ersten Ranges
4.1.1.1 Ich-Störungen
4.1.1.2 Gedankeneingebung, Gedankenlautwerden
4.1.1.3 Wahnwahrnehmungen
4.1.1.4 Stimmenhören in Form von Rede und Gegenrede
4.1.1.5 Fremdbeeinflussungserlebnisse
4.1.2 Symptome zweiten Ranges
4.1.2.1 Wahneinfall
4.1.2.2 Halluzination
4.1.2.3 Gefühlsverarmung
4.1.2.4 Verstimmungen
4.2 Symptome nach Bleuler
4.2.1 Grundsymptome
4.2.1.1 Störung der Assoziation
4.2.1.2 Störung der Affekte
4.2.1.3 Autismus
4.2.1.4 Ambivalenz
4.2.2 Akzessorische Symptome
4.2.2.1 Halluzinationen
4.2.2.2 Wahn
4.2.2.3 Katatonie-Syndrome
5. Verschiedene Formen der Schizophrenie
5.1 Katagone Form
5.2 Paranoid-Halluzinatorische Form
5.3 Hebephrene Form
5.4 Schizophrenia simplex
5.5 Kinderschizophrenie
6. Behandlungsmöglichkeiten
6.1 Diagnosetest: Das Sprichwort als Parallele
6.2 Die drei Säulen der Therapie
6.2.1 Somatische Therapie
6.2.2 Psychotherapie
6.2.3 Soziotherapie
6.3 Therapiewahl
6.4 Heilungschancen/Prognose
7. Aktuelle Forschung über Schizophrenie
8. Ähnliche Krankheiten
Nachwort
Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
www.suppeninstitut.de/suppentag2002/images/zwilling/zwilli01.gif
Erfahrungen Schizophrenie-Erkrankter:
Aus dem Bericht einer 17jährigen Patientin[1]:
„Meine Krankheit zeigte sich zuerst in Appetitlosigkeit und Ekel vor Serum. Auch blieb die Periode aus. Dann kam so eine Verstocktheit. Ich sprach nicht mehr frei. Ich hatte kein Interesse mehr, war traurig, rammdösig, schreckte auf, wenn man mich ansprach.
Mein Vater (Besitzer eines Restaurationsbetriebes) sagte mir: die Kochprüfung (die am nächsten Tag stattfand) ist doch eine Kleinigkeit, er lachte dabei in einem so seltsam wirkendem Ton, dass ich mir wie ausgelacht vorkam. Die Gäste guckten mich so sonderbar an, als ahnten sie etwas von meinen Selbstmordgedanken. Ich saß neben dem Geldschrank, die Gäste sahen mich an, da kam mir der Gedanke, sollte ich was genommen haben? Ich hatte schon seit fünf Wochen das Gefühl, irgendwas schlechtes gemacht zu haben. Auch die Mutter guckte mich manchmal so durchdringend an, so komisch.
Es war Abends, so gegen halb zehn Uhr (sie hatte Leute gesehen, von denen sie fürchtete, sie würden sie wegschleppen). Ich zog mich dann doch aus. Ich hab dann ganz steif im Bett gelegen und mich nicht gerührt, damit die mich nicht hören. Ich selbst passte aber scharf, ganz genau auf jedes Geräusch auf. Ich hab fest geglaubt, dass die drei sich jetzt zusammenrotten und mich knebeln.
Am Morgen lief ich weg. Als ich über den Platz ging, war die Uhr auf einmal verkehrt, sie war verkehrt stehen geblieben, ich hatte gedacht, sie geht auf die andere Seite herum. In dem Moment denke ich, die Welt geht jetzt unter. Am jüngsten Tag bleibt alles stehen. Ich sah dann auf der Straße viel Militär. Wenn ich in die Nähe der Soldaten kam, fuhr immer einer weg. Aha, dachte ich, die werden doch jetzt wohl nicht Meldung machen? Sie verstehen wohl, wenn einer steckbrieflich verfolgt wird! Immer guckten sie mich an. Es kam mir so richtig vor, als ob die Welt sich um mich dreht.
Dann kam der Nachmittag. Mir kam es so vor, dass die Sonne nicht schien, wenn ich schlechte Gedanken hatte. Sobald ich gute Gedanken hatte, kam die Sonne wieder. Dann dachte ich, die Wagen fahren verkehrt. Wenn ein Wagen vorbeifuhr, hörte ich gar nichts. Ich dachte, da ist bestimmt Gummi drunter. Große Lastwagen schepperten nicht. Sobald ich an ein Auto herankam, schien es mir, als ob ich was ausstrahlen würde, dass das Auto sofort stillhält. (...) Ich hatte alles auf mich bezogen, als wenn das auf mich gemacht wäre. Die Leute schauten mich nicht an, als ob sie sagen wollten, ich wäre zu schlecht, um angesehen zu werden.
Im Polizeirevier hatte ich den Eindruck, dass ich nicht auf der Polizeiwache, sondern dass ich im Jenseits sei. Ein Beamter hat wie der Tod ausgesehen. Ich dachte, der Mann ist schon tot und muss so lange auf der Maschine schreiben, bis er seine Sünden abgebüßt hat. Bei jedem Läuten glaubte ich: Jetzt holen sie wieder einen, dessen Lebenszeit abgelaufen ist (erst später wurde mir klar, dass das Läuten von der Schreibmaschine ausging, dass es den Zeilenrand anzeigte). Da habe ich darauf gewartet, dass sie auch mich abholen. Ein junger Polizeibeamter hielt eine Pistole in der Hand, ich hatte Angst, er wolle mich umbringen. Den Tee, den er mir anbot, trank ich nicht, in der Meinung, er wäre vergiftet. Ich wartete sehnsüchtig darauf, wann der Tod wohl komme... Es war wie auf einer Bühne, und Marionetten sind keine Menschen. Ich dachte, es wären nur Hauthülsen. Die Schreibmaschine kam mir verdreht vor, da standen nicht die Buchstaben darauf, sondern Zeichen, ich glaubte aus dem Jenseits. Als ich ins Bett ging, dachte ich, da liegt schon einer drin, denn die Steppdecke war so holprig. Das Bett fühlte sich so an, als ob Menschen drin lägen. Ich dachte, alle wären verwunschen. Den Vorhang hielt ich für Tante Helene. Unheimlich waren auch die schwarzen Möbel. Der Lampenschirm über dem Bett hat sich immer so bewegt, es sind dauernd Gestalten herumgeschwirrt (...).
Am Morgen bin ich dann aus dem Schlafzimmer gelaufen und habe geschrien: Was bin ich denn, ich bin der Teufel! Ich wollte mein Nachthemd ausziehen und auf die Straße laufen, aber meine Mutter hat mich noch erwischt. (Nach Jaspers, 1965)“
Vorwort
Für die Medizin und die Verhaltenswissenschaften ist Schizophrenie eines der größten Rätsel und Herausforderungen. Die Klärung der Entstehung, Kontrolle und die effektive Behandlung von Schizophrenie warten noch auf eine endgültige Lösung.
Viele Menschen wissen nicht was Schizophrenie ist, wie sie sich auswirkt und wie problematisch diese Krankheit ist. Deshalb werden Menschen mit dieser Krankheit oft nicht ernst genommen, für verrückt erklärt und diskriminiert.
Der Interessenverlust des Patienten für seine Familie wird von Angehörigen und Freunden als äußerst störend und beunruhigend empfunden. Die früher gewohnte Unterstützung durch den Patienten fehlt. Folglich sind Angehörige all zu oft und all zu schnell bereit, sie in eine Anstalt abzuschieben, weil sie die „Verrücktheit“ in ihrer Mitte nicht ertragen können. In dieser Einstellung der Familie spiegelt sich die Einstellung unserer ganzen Gesellschaft wieder.
Auch Experten der Weltpsychiatrischen Vereinigung sind der Ansicht, dass die Diskriminierung psychisch Kranker häufig deren Behandlung behindern. Vorurteile belasten Kranke und deren Angehörige sehr, deshalb müssen sie abgebaut werden.
Viele haben aber auch einfach nur Angst vor psychisch Kranken oder denken sie seien faul.
Ziel meiner Arbeit ist es, Kenntnisse über Schizophrenie zu vermitteln, um den betroffenen Personen genannten Reaktionen zu ersparen.
Anhand der wichtigsten Themenaspekte wird versucht zu erklären, dass Schizophrenie-Kranke keinen Grund haben, sich zu schämen. Von dieser Krankheit kann nahezu jeder betroffen sein.
Nachdem sie meine Arbeit aufmerksam gelesen haben, werden sie einen tieferen Einblick in das Wesen der Schizophrenie haben.
1. Definition des Krankheitsbildes
1.1 Historische Ansätze
Anfangs wurden die Erscheinungsbilder der Schizophrenie als ein progressiver geistiger Abbau beschrieben, um sie von den affektiven Psychosen abzugrenzen.
Eine affektive Psychose ist der Oberbegriff der endogenen Depression. Diese äußert sich unter anderem durch Schlafstörungen, autoaggressive Impulse (Suizidgefahr), hypochondrische Wahnideen oder massives Schulderleben.
Früher wurde Schizophrenie als Dementia praecox bezeichnet. Dieser Begriff leitet sich von dement ab, was übersetzt „ verblödet“ bedeutet.
Inzwischen wurde jedoch erkannt, dass Schizophrenie weder unbedingt fortschreitend ist, noch einen Abbau bis zu einem dementen Zustand bedingt.
Deshalb ist der Begriff „Dementia praecox“ heute eher unüblich, obgleich er noch häufig in medizinischen Lexika zu finden ist.
1.2 Aktuelle Ansätze
Schizophrenie ist, nach heutiger Erkenntnis, eine endogene Psychose.
Der Begriff „Psychose“ ist sehr ungenau. Mit einer Psychose werden in der Psychiatrie allgemeine Formen psychischen Andersseins bezeichnet.
Die Medizin brauchte Jahrhunderte, um diese Zustände als Krankheit anzuerkennen. Bis heute sind die Ursachen für eine Psychose nur unzureichend bekannt.
Als Grundlage für eine Einteilung der Psychosen kann auf die von
Emil Kraepelin (1856-1929) zurückgehende Systematik psychischer Erkrankungen zurückgegriffen werden.
Kurzbiographie[2]
- Geboren am 15.02.1856 in Neustrelitz
- 1874 Medizinstudium in Leipzig und Würzburg
- Noch als Student Assistent an der psychiatrischen Klinik in Würzburg
- 1878 Promotion „Über den Einfluss akuter Krankheiten auf die Entstehung von Geisteskrankheiten
- 1878 Assistent an der Kreis-Innenanstalt München
- 1882 erster Assistenzarzt an der Leipziger Irrenklinik
- Volontärassistent der Nerven-Poliklinik an der Medizinischen Klinik bei Wilhelm Erb sowie im Laboratorium für experimentelle Psychologie
- 1883 Habilitation an der Medizinischen Fakultät
- 1884 Oberarzt an der Heilanstalt Leubus/Schlesien
- 1885 dirigierender Arzt der Irrenabteilung des Allgemeinen Stadtkrankenhauses Dresden
- 1886-1903 ordentlicher Professor an den Psychiatrien der Universitäten von Dorpat, Heidelberg und München
- 1917 Gründung der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München
- 1922 Emeritierung, doch weiterhin zentrale Person im Vorstand der Forschungsanstalt für Psychiatrie
- gestorben am 01.10.1926
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Emil Kraepelin
E. Kraepelin unterscheidet psychische Erkrankungen folgendermaßen:
- Organische, körperlich begründbare, exogene Psychosen und Psychosyndrome, (z.B. Alkoholpsychosen)
- Psychogene oder psychoreaktive Störungen, die seelisch bedingt sind
- Psychische Störungen bei angeborenen oder frühzeitig erworbenen Persönlichkeitsvarianten und Persönlichkeitsdefekten (wie zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen und Intelligenzminderungen)
- Endogene Psychosen, eine Art davon ist Schizophrenie
Endogen heißt wörtlich übersetzt „von innen kommend“. Die Ursache einer endogenen Erkrankung ist also vorrangig im Inneren des Organismus zu suchen, ohne dass die Ursache bisher genau bekannt ist.
Endogene Psychosen sind überwiegend genetisch determiniert. Es besteht kein ursächlicher Zusammenhang mit einer organischen Krankheit.
Bei den endogenen Psychosen unterscheidet zwischen Störungen
- der Wahrnehmung: Halluzinationen und Stimmenhören
- des Denkens: -formale →Gedankenablauf und Logik sind gestört
-inhaltliche →wirken sich als Wahn und
Zwangsidee aus
Im Volksmund wird Schizophrenie als gespaltene Persönlichkeit bezeichnet.
Das wesentliche Kennzeichen von Schizophrenie ist der Zusammenbruch des integrativen Gefüges der Funktionsbereiche der Persönlichkeit.
Das heißt, verschiedene Aspekte der Persönlichkeit des Patienten liegen miteinander im Widerstreit und das Verhalten wird von den Rückmeldungen von seiten der Umwelt nicht gesteuert; es ist davon unabhängig.
Schizophrene sind, besonders in höherem Lebensalter suizidgefährdet. Die Patienten können Depressionen aufweisen. Diese Depressionen haben jedoch einen anderen Charakter als die endogene Depression[3]. Depressiv Schizophrene sind weinerlich, anhänglich und hilflos. Sie sind jedoch, im Gegensatz zu den Cyclothymen[4], aufzuheitern. Ihre Stimmung ist stark umweltabhängig, das heißt ermunternde Worte halten nicht lange vor. Die Stimmung schwankt rasch. Ebenso rasch und nicht vorhersehbar kann ein Suizidimpuls in die Tat umgesetzt werden.
Schizophrenie führt somit zu
- mangelnder Kontaktfähigkeit (auch als Autismus bezeichnet)
- Depersonalitionserlebnissen (Entpersönlichung)
- Spaltung der Persönlichkeit in gegensätzliche, gewöhnlich unvereinbare Persönlichkeitskomponenten
- Suizid-Gefährdung
2. Vorkommen
2.1 Wer ist besonders gefährdet?
Das Auftreten von Schizophrenie hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Wobei einige Menschen anfälliger sind, u.a. bei familiärer Disposition (anlagebedingte Bereitschaft).
Die Erkrankungswahrscheinlichkeit bei Angehörigen ersten Grades liegt bei etwa 10%. Sind beide Elternteile erkrankt, dann steigt das Risiko ihrer Kinder, ebenfalls an Schizophrenie zu erkranken, auf 40%.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Kind im Falle von eineiigen Zwillingen an Schizophrenie erkrankt, beträgt ca. 50% wenn beim ersten Kind auch Schizophrenie diagnostiziert wurde.
Studien an Zwillingen und Adoptivkindern belegen, dass eine genetische Disposition für Schizophrenie besteht.
Männer und Frauen sind gleich oft betroffen. Männer erkranken allerdings früher an Schizophrenie (> 65% vor dem 25. Lebensjahr), Frauen im Durchschnitt 3-4 Jahre später[5].
Bei der Mehrzahl der Patienten tritt die Erkrankung zwischen der Pubertät und dem 45. Lebensjahr auf. Das AHC- Consilium[6] (Med. Wissenschaftlicher Beirat, Diagnosen- Index) beobachtete dagegen, dass mehr als die Hälfte aller Schizophrenie- Erkrankungen zwischen der Pubertät und dem 30. Lebensjahr auftreten.
Schizophrenie kann in jedem Lebensalter auftreten, selten jedoch im ersten Lebensjahrzehnt.
Die volkswirtschaftlichen Kosten der Schizophrenie werden auf jährlich dreieinhalb Milliarden Euro geschätzt.
2.2 Prozentuale Erkrankungen in den USA und Deutschland
Zwei bis drei Millionen der heute lebenden Amerikaner [7] hatten schon einmal Schizophrenie. Schätzungen zu Folge, erkranken circa 2% der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens vorübergehend an Schizophrenie. Diese Zahl erhöht sich in bestimmten sozialen Milieus, zum Beispiel in Ghettos und Großstädten, auf 6%. Das heißt mehr als einer von zwanzig Einwohnern!
Die Zahl der Patienten in den psychiatrischen Krankenhäusern der USA ging in den letzten 15 Jahren um 30% zurück. Zugleich stieg die Zahl der Neuzugänge.
1968 wurden 320 000 Krankheitsfälle diagnostiziert. In den Jahren 1957-1967 stieg in den USA bei hospitalisierten Patienten im Alter unter 15 die Häufigkeit der Diagnose Kinderschizophrenie um 88% . Dieser Anstieg ist wahrscheinlich weniger auf ein vermehrtes Auftreten dieser Störung als auf die Tatsache zurückzuführen, dass sie inzwischen in weiten Kreisen erkannt und diagnostiziert wurde.
In Deutschland entwickelten rund 800 000 Menschen im Laufe ihres Lebens eine schizophrene Störung, deren Behandlung durch Vorurteile erschwert wurde.
3. Ursachen
Die genetische Disposition scheint auf verschiedenen Genen lokalisiert zu sein. Der genaue Genort ist jedoch bislang nicht bekannt.
Bei Untersuchungen wurde herausgefunden, dass Kinder, die später an Schizophrenie erkrankten, bereits im Kindesalter passiv und unkonzentriert waren.
In der Schule fielen sie durch unangepasstes und störendes Verhalten auf.
Häufig zeigten sich in der Familie schwere Beziehungsstörungen oder es fand eine negative Wahrnehmung der eigenen Person statt.
Bei Schizophreniekranken wurde ein Überschuss an Dopamin[8] festgestellt, was die Hypothese einer biochemischen Krankheitsursache bestärkt.
Bei einigen Schizophrenen fand man Veränderungen der Hirnstruktur.
Durch PET- und SPECT[9] Untersuchungen wurden Hypometabolismus (=verringerter Stoffwechsel) und verminderte Durchblutung in Teilen des Frontalhirns nachgewiesen, was zu Störungen der Neurotransmitter führt. Diese chemischen Substanzen wirken an den Synapsen und bewirken eine Erregung der peripheren Nerven
3.1 Breeder-Hypothese (Stress als Ursache)
Nach der Breeder-Hypothese führt die gehäufte Belastung durch Armut, soziale Desintegration (in Form von Kriminalität sowie gestörten Familienverhältnissen etwa durch Kindesmisshandlung und Vernachlässigung) in den sozial schwächeren Schichten zu häufigerem Auftreten von Schizophrenie.[10]
3.2 Drift - Hypothese
Die Drift-Hypothese besagt im Gegensatz zur Breeder-Hypothese, dass es zu einer Konzentrierung von Schizophrenen in den unteren Schichten kommt. Als Ursache dafür wird der gesellschaftliche Abstieg aufgrund verminderter psychischer Belastbarkeit diskutiert.
E.M. Goldberg und S.L. Morrison führten gemeinsam 1973 in London eine Studie durch, in der die soziale Mobilität schizophrener Männer und die ihrer Väter, Onkel, Brüder und Großväter überprüften. Dabei stellten sie fest, dass die Väter sich zwar genauso ähnlich auf die Sozialschicht verteilten wie die gesunde Referenzpopulation insgesamt, dass jedoch die schizophrenen Söhne in der untersten Schicht deutlich überrepräsentiert waren. Danach hatte sich also ein sozialer Abstieg vollzogen, weil ein beträchtlicher Anteil der Schizophrenen (mehr als die Hälfte) nicht in den Unterschichtfamilien geboren oder aufgewachsen war.
Die Londoner Ergebnisse wurden sowohl in Detroit als auch in New York bestätigt.
Die Untersuchungen bestätigen die Hypothese des sozialen Abstiegs. Trotzdem spricht nichts dagegen, dass auch Stressfaktoren eine Rolle spielen können. Allerdings werden Stressfaktoren eher die Rolle zugesprochen den Ausbruch der Schizophrenie auszulösen, als die Krankheit im eigentlichen Sinne zu verursachen. Schließlich wird die überwiegende Mehrzahl der in der Unterschicht geborenen Menschen nicht schizophren.[11]
Kurz kann man über die Drift-Hypothese also sagen: Schizophren-Kranke werden an den „Boden der Gesellschaft“ gespült und sacken ab.
Allerdings ist zu bemerken, dass ich das Wissen über die Breeder- und Drift- Hypothese lediglich aus einer Quelle (s.u.) bezogen habe. Es war mir nicht möglich über dieses Thema andere Aufschriebe zu finden.
3.3 Fehldiagnosen und Abgrenzungen gegen affektive Psychosen
In der Tat können LSD, Amphetamine (Speed, Dope, Crack, Crystal, Ice), Phencyxlidin (PCP, Angel Dust), Kokain und andere, auch künstliche „Disigner“-Drogen kurzzeitige Symptome hervorrufen, die einer echten Schizophrenie so stark ähneln, dass sie zu einer falschen Diagnose führen können. Diese und andere Substanzen wie Brom, Kohlenmonoxid, Alkohol und Diazepam (Valium) erzeugen das, was als eine drogeninduzierte oder pharmakologische Phänokopie einer schizophrenieähnlichen Psychose bezeichnet wird.
Ähnliche Symptome wie die der Schizophrenie findet man auch bei Kopfverletzungen oder Krankheiten wie Gehirntumoren, Epilepsie, Hypoglykämie, Enzephalitis diseminata (Entmarkung der Nerven), was oft auch falscherweise als Multiple Sklerose bezeichnet wird. Bei letzterem spricht man von krankheitsinduzierter oder somatischer Phänokopie.
Die Schizophrenie wird leicht mit einer anderen Gruppe schwerer, endogener Psychosen verwechselt. Hierzu zählen endogene affektive Psychosen z.B. depressive und manische Psychosen, insbesondere wenn sie zum ersten Mal und verbunden mit bizarren Wahnvorstellungen auftritt.
4. Symptome/Erscheinungsbilder
Bei den Symptomen der Schizophrenie wird auf die Kenntnisse von Eugen Bleuler und Kurt Schneider zurückgegriffen.
Schöpfer des Begriffs Schizophrenie (1911) und Ambivalenz (1910)
- 30.04.1857 in Zollikon geboren
- 15.07.1939 in Zürich gestorben
keine genauere Biographie bekannt
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eugen Bleuler[12]:
Kurt Schneider: Über Kurt Schneider ist leider keine Biographie zu finden.
Kurt Schneider unterscheidet hier zwischen Symptomen ersten und zweiten Ranges. E. Bleuler unterscheidet in Grundsymptome und akzessorische Symptome
Bei der Schizophrenie kann Größenwahn auftreten, was aber nicht charakteristisch für diese Erkrankung ist.
4.1 Symptome nach Kurt Schneider
4.1.1 Symptome ersten Ranges
4.1.1.1 Ich-Störungen
Man spricht hier auch von dem Verlust der Mein-Haftigkeit.
Der Schizophrene erlebt Gefühle oder Körperempfindungen als vom eigenen Ich losgelöst. Das Herz, das da schlägt ist nicht sein eigenes, der Gedanke, den er gerade denkt, ist nicht seiner, er ist ihm von außen eingegeben worden.
Auch die eigentliche Persönlichkeitsspaltung gehört in diese Kategorie. Der Patient meint zwar, er wäre eine hochgestellte Persönlichkeit (Napoleon o.ä.), verhält sich aber so, wie er sich immer verhält.
Auf der Station hilft er, das Essen auszutragen, seiner Frau hilft er, das Geschirr zu spülen etc., was Napoleon sicher nie getan hat.
4.1.1.2 Gedankeneingebung, Gedankenlautwerden, Gedankenbeeinflussung
Die Störung der Gedankenwelt hängt eng mit der Ich-Störung zusammen:
Der Patient empfindet seine Gedanken nicht als seine eigenen, sondern glaubt, dass diese durch Manipulationen in seinen Kopf gebracht wurden.
-versuchen Sie erst gar nicht das nachzuvollziehen. Psychotisches Erleben ist nicht nachvollziehbar.
4.1.1.3 Wahnwahrnehmungen
Darunter versteht man eine reale Wahrnehmung, die im Sinne eines Wahns fehlgedeutet wird. Man sieht etwas und ist überzeugt, dass damit eine bestimmte Mitteilung verbunden ist.
- Es regnet jetzt, dabei wollte ich spazieren gehen. Man/ Gott/ die Mächte wollen mir damit andeuten, dass ich lieber noch etwas lernen sollte.
4.1.1.4 Stimmenhören in Form von Rede und Gegenrede
Der Schizophrene hat akustische Halluzinationen . Er hört Stimmen (und kann diese auch meistens bestimmten Personen zuordnen), die sich nicht mit ihm, sondern quasi hinter seinem Rücken über ihn unterhalten oder sein Handeln kommentieren.
Selten sind diese Stimmen nett und freundlich.
4.1.1.5 Fremdbeeinflussungserlebnisse
Der Patient meint, seine Denkstörungen, seine Schwierigkeiten werden von außen, meistens von bestimmten Personen verursacht. Diese Personen bestrahlen ihn, hypnotisieren ihn, oder tun ihm sonst (subtile, komplexe) Gewalt an.
4.1.2 Symptome Zweiten Ranges
4.1.2.1 Wahneinfall
Der Wahneinfall entsteht ohne vorherige Sinneswahrnehmung, quasi aus der Phantasie des Patienten heraus.
Auf einmal weiß der Patient, dass das FBI oder seine Schwiegermutter ihn verfolgt
4.1.2.2 Halluzinationen
Dies sind die Sinneseindrücke ohne reale Wahrnehmung, wobei der Patient von der Richtigkeit der Wahrnehmung überzeugt ist.
4.1.2.3 Gefühlsverarmung
Der Patient zieht sich im Verlauf seiner Krankheitskarriere immer mehr zurück.
Er nimmt an den Vorgängen seiner Umwelt nicht mehr teil.
4.1.2.4 Verstimmungen
Die schizophrene Verstimmung kann sich als gehobene Stimmung, als albernes, rücksichtsloses und läppisches Verhalten äußern oder als Depression, die umweltabhängig und beeinflussbar ist. Sehr oft leidet der Patient unter Angst
–stellen sie sich vor ihre Gedanken würden ihnen auf ein Mal nicht mehr gehorchen
-Eine Schizophrenie kann angenommen werden, wenn
mehrere Symptome ersten Ranges auftreten bzw.
mindestens 1 Symptom ersten Ranges und 2 Symptome zweiten Ranges
4.2 Symptome nach Eugen Bleuler
4.2.1 Grundsymptome, die 4 A’s:
4.2.1.1 Störung der Assoziation
Hierher gehören die formalen Denkstörungen:
- Gedankensperrung
- Zerfahrenheit
Gemeint ist, dass der Patient Gedanken nicht mehr zu Ende denken kann. Er bleibt mitten im Gedanken, quasi auf halber Strecke stecken.
Unter Zerfahrenheit versteht man ein unlogisches und unzusammenhängendes Denken, das aber für den Patient logisch ist.
4.2.2.2 Störung der Affekte
Hierzu gehört die schizophrene Verstimmung und die Affektlabilität (gefühlsmäßige Handlung), das heißt dass die Stimmung des Kranken stark von der Umwelt beeinflusst wird, sich aber auch rasch ändern kann.
4.2.2.3 Autismus
Unter Autismus versteht man den Verlust der Realitätsbeziehungen, eine krankhafte Ich-Versunkenheit. Der Patient nimmt nicht mehr an seiner Umwelt teil.
4.2.2.4 Ambivalenz
Ein Schizophrener kann gleichzeitig lachen und weinen. Er kann gleichzeitig Angst haben und glücklich sein. Der Normalsterbliche hat auch Ambivalenzen
-einerseits möchte man ins Kino gehen, andererseits müsste man noch etwas lernen-
Diese Ambivalenzen werden jedoch bewusst und man versucht, irgendwie einen Kompromiss zu finden.
4.2.2 Akzessorischen Symptome
4.2.2.1 Halluzinationen
Es können akustische Halluzinationen, seltener optische Halluzinationen auftreten. Die optischen Halluzinationen stehen in Verbindung mit dem Wahn.
Geruchs- und Geschmackshalluzinationen kommen im Zusammenhang mit einem Verfolgungswahn vor. Der Patient fühlt sich dann vergiftet.
Taktile Halluzinationen (Berührungsreize) sind beim Schizophrenen ebenfalls nicht selten: Es treten Missempfindungen auf, als ob die inneren Organe aufgefressen würden, als ob der Herzschlag gestört oder der Stuhlgang verhindert werden würde. Häufig sind die Genitalien miteinbezogen.
Körpermissempfindungen werden stets als von außen gemacht empfunden.
4.2.2.2 Wahn
Beim Wahn unterscheidet man in verschiedene Wahntypen. Typisch für die Schizophrenie sind der - Beziehungswahn und der
- Beeinträchtigungswahn.
Beim Beziehungswahn ist der Patient der Meinung, dass alles, was passiert, nur seinetwegen geschieht. Der Schizophrene sieht hinter alltäglichem Geschehen eine verborgene Mitteilung für ihn persönlich.
Beim Beeinträchtigungswahn hingegen meint der Schizophrene `alle Welt will ihn fertig machen`, umbringen oder Schlimmeres. Der Beeinträchtigungswahn ist quasi eine Sonderform des Beziehungswahns. Normale Dinge geschehen seinetwegen, um ihm zu schaden.
Beim Beeinträchtigungswahn können auch Sonderformen auftreten:
- Verfolgungswahn (fühlt sich verfolgt)
- Vergiftungswahn (denkt man wolle ihn vergiften)
Bei einem Wahnkranken ist jedes Diskutieren überflüssig. „Es ist so, ich weiß es und Schluss“
4.2.2.3 Katatonie
Bei der Katatonie handelt es sich um eine Störung der Psychomotorik.
Der Patient kann entweder Hyper-motorisch oder Hypo.motorisch sein.
- Hyper-motorisch: unruhig, impulsiv. Es kann eine Befehlsautomatie auftreten
(nachmachen aller Bewegungen in der Umgebung)
- Hypo-motorisch (siehe 5.1)
- Stupor
- Mutismus
- Negativismus
- Katalepsie
Zusammenfassung der Bleulschen und Schneiderschen Hypothesen:
Menschen, die an Schizophrenie erkranken ziehen sich von der Realität zurück und stumpfen in der Mehrzahl der Fälle emotional ab. Ihr Denken ist merklich gestört, gewöhnlich haben Patienten mit dieser Krankheit Wahnideen, Halluzinationen und Stereotypien. Das Stimmenhören äußert sich, wie oben bereits erwähnt, in Form von Rede und Gegenrede. Die Sprache scheint von unmittelbaren Reizen diktiert zu sein. Sie ergibt für den Zuhörer keinen Sinn. Der Schizophrene ist durch ständig wechseln-de Sinneseingebungen und durch seine innere Realität so abgelenkt, dass er selbst einen einfachen Gedankenablauf nicht zum Ausdruck bringen kann.
5. Verschiedene Formen der Schizophrenie
Jede Form der Schizophrenie stellt einen Symptomkomplex dar.
Darüber hinaus gibt es auch eine Schizophrenie mit unklarer Symnptomatik, wobei akute oder chronische Formen mit Symptomen aller Art auftreten.
5.1 Katatone Form
Eine akute Katatonie hat eine günstige Prognose und kann sich relativ rasch wieder zurückbilden. Es handelt sich um Störungen der Motorik und des Antriebs.
- Von einem Stupor spricht man, wenn der Patient unbeweglich im Bett liegt und zwar die Umwelt sieht und hört, aber nicht auf Reize reagieren kann.
- Unter einem Mutismus versteht man die Unfähigkeit zu sprechen, was psychisch bedingt ist.
- Von einer Katalepsie spricht man, wenn die Patienten Extremitäten in unbequemen Stellungen unnatürlich lange Zeit halten können.
Es gibt schwere Störungen der Willkürbewegungen eines Menschen, wobei jemand zur Beweglosigkeit erstarren, zur Statue werden kann. Oder jemand ist nicht zu bremsen, schlägt wild um sich. In beiden Fällen ist der Mensch äußerst gespannt, verkrampft, innerlich erregt (katatoner Sperrungs- oder Erregungszustand).
Die –heute selten gewordene- extreme Steigerung der Bewegungsstörung kann tödlich enden. Sie ist nur durch hohe Dosen Neuroleptika, Infusionen auf der Intensivstation zu therapieren. Bei dieser Störungen kommt es neben der Handlungsunfähigkeit durch extrem hohen Körpertemperaturen, zu Austrocknung und zu Kreislaufkrisen.
Es gibt aber auch katatone Erregungszustände, in denen die Patienten dauernd Turnübungen machen, Hyperkinesen[13] aufweisen, Grimmassieren oder dauernd einzelne Worte wiederholen.
5.2 Paranoid-Halluzinatorische Form
Treten Wahrnehmungsstörungen, Halluzinationen und Wahnbildungen in den Vordergrund der Handlungen, so ist vor allem die paranoide[14] Abwehr eines Menschen beschrieben. Es ist dem Kranken unmöglich zwischen Wirklichem und Unwirklichem, Gedachtem und Vorhandenem zu unterscheiden. Bei der Diagnose der Halluzination ist der Unterschied zur Illusion zu bedenken.
Bei der Illusion werden reale Reize, sei es ein Strauch, ein Lichtstrahl, ein Geruch, meist angstvoll umgedeutet, das heißt der Strauch kann zum bedrohenden Menschen werden, der Lichtstrahl zu einem sich nähernden Fahrzeug.
Bei der Halluzination sind Außenreize für Andere nicht gegeben, der Patient handelt aber so, als wären sie vorhanden.
Bei den meisten Menschen, die Jahre und Jahrzehnte sich und Andere aus den Fugen bringen, schizophren handeln, ist dieses Handeln zusammen mit ihrem Alltagshandeln zu einer biographischen Einheit verschmolzen und befriedigt (wie die Verinnerlichung einer Berufsrolle). Sie können ihr Leben zumeist auch außerhalb einer Einrichtung, oft in eigener Wohnung, leben.
Die paranoid-halluzinatorische Form tritt später als andere Formen auf, oft als Spätschizophrenie. Die Gesamtpersönlichkeit bleibt lange intakt, allerdings sind die Wahnhaften Erlebnisse schwer zu therapieren.
5.3 Hebephrene Form
Eine Hebephrenie[15] ist eine besondere Verlaufsform der Schizophrenie. Die hebephrene Form tritt bei Jugendlichen zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr bei einer eher ungünstigen Prognose auf. Es handelt sich um eine affekte Verflachung und Enthemmung. Die Patienten lachen und / oder sind laut. Es handelt sich jedoch nicht um echte Emotionen, die irgendwie nachzuvollziehen sind. Die nach außen gestellten Emotionen wirken unecht und hohl. Außerdem wirkt sie sich in Form von Denkstörungen, Zerfahrenheit, Kontaktstörungen und Antriebsverarmung aus, selten in Wahn oder Sinnestäuschungen.
5.4 Schizophrenia simplex
Diese Form verläuft primär chronisch und hat daher auch eine eher schlechte Prognose.
Wie bei allen chronischen Erkrankungen sind die Symptome nicht sehr auffallend: Die Patienten werden einfach immer komischer. Sie verlieren zunehmend den Kontakt nach außen und lassen sich verkommen.
Die, für die Schizophrenie typischen Symptome entwickeln sich langsam und führen zu ausgeprägten Residualzuständen (residual=zurückbleibend).
5.5 Kinderschizophrenie
Dieser Typ der Schizophrenie entwickelt sich auf der Grundlage eines biologischen Defizits, das beim Kind zu einer Unfähigkeit führt, in gewöhnlicher Weise auf andere Menschen und auf Umweltreize einzugehen. Daher wird die Schizophrenie im Kindesalter auch oft als frühkindlicher Autismus bezeichnet. Autistische Kinder zeigen zwanghaft stereotypes Verhalten, können nicht gleichzeitig Reize aus mehr als einem Wahrnehmungsbereich verarbeiten und sind nicht in der Lage, verbal gegebenen Anweisungen die entsprechenden Handlungen umzusetzen. Sie stellen den reinsten Fall eines in sich geschlossenen psychischen Systems dar.
6. Behandlungsmöglichkeiten
Durch eine fachgerechte Therapie sind Schizophrenien nicht heilbar, wie die Zuckerkrankheit nicht heilbar ist. Viele Kranke werden von alleine wieder gesund.
Ihre Symptome sind gut zu beeinflussen. Oft sind sie ganz zu beseitigen. Durch konsequente Behandlung und Rückfallprophylaxe lassen sich schwere Episoden mildern. Die sozialen Folgen können abgefedert und bei aktiver Mitarbeit der Kranken häufig überwunden werden. Entscheidend ist die Verbindung von Pharmakotherapie, Psychotherapie und Soziotherapie.
Das Behandeln von Schizophrenen ist nicht leicht. Die Behandlung ist eine komplexe Angelegenheit, die Wissen, Erfahrung, Geduld und Engagement verlangt. Ideologien helfen hier wenig. Die Behandlung lebt von der Zusammenarbeit und der Auseinandersetzung mit den Kranken.
Bei Erstmanifestation werden die Patienten meist stationär behandelt.
In extremen Fällen mit starker Erregung und Realitätsverkennung werden die Patienten -auch gegen ihren Willen- in eine geschlossene psychiatrische Station eingewiesen.
6.1 Diagnosetest: Das Sprichwort als Parallele
Ende der 30er Jahre experimentierte John Benjamin mit einer Sprichwörtersammlung, die heute zum klassischen Hilfsmittel wurde, um Patienten mit Verdacht auf Schizophrenie zu testen. Lässt man z.B. Patienten das Sprichwort: „Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse“ interpretieren, dann antwortet einer: „Wenn niemand aufpasst, tun die Mäuse Dinge, die sie nicht täten, wenn die Katze da wäre“ oder „Wenn keine Katze da ist, spielen die Mäuse herum und machen vielleicht Dummheiten“.
Die Patienten interpretieren die Sprichwörter wörtlich und konkret. Problematisch an dieser Art der Diagnose ist jedoch, dass die Menschen mit hirnorganischen Schäden oder mit leichtem Schwachsinn Sprichwörter ebenso interpretieren. Die Sprichwörterinterpretation, die nach Benjamins Erfahrung eindeutig auf Schizophrenie schließen lässt, ist bizarr und in erster Linie auf die persönliche Phantasiewelt des Patienten bezogen.
6.2 Die drei großen Säulen der Therapie von Psychosen sind
die somatische Therapie (vor allem Pharmakotherapie) (siehe 6.2.1),
die Psychotherapie (siehe 6.2.2 ) und
die Soziotherapie (siehe 6.2.3. )
6.2.1 Somatische Therapie
Diese drei Therapie-Formen sind Grundlage der Behandlung aller Psychoseformen. Die ursprüngliche Einteilung der Psychosen (endogen, exogen und psychogen) wirkt sich auf die verwendeten therapeutischen Verfahren aus.
In der akuten Phase einer Schizophrenie steht die Behandlung mit Medikamenten im Vordergrund (Pharmakotherapie).
Es kommen Neuroleptika und andere Medikamente mit sedierender (beruhigender) oder antidepressiver Wirkung zum Einsatz.
Trotz guter Erfolge mit der Psychopharmakotherapie gilt:
„Soviel Medikamente wie nötig, so wenig wie möglich.“
Medikamente sind zwar wichtig, aber nicht alles. Es gilt, die Einstellung der Bevölkerung zu ändern, denn neben Wissen ist vor allem Toleranz nötig.
Bei stationärer Behandlung wird, wie bereits erwähnt, unter anderem mit Psychopharmakotherapie und Neuroleptika gearbeitet.
Neuroleptika ist eine Bezeichnung für psychotrope Substanzen, die zur Behandlung von Angst- und Erregungszuständen (bestimmten Psychosen wie z.B. der Schizophrenie) eingesetzt werden. Neuroleptika blockieren Dopaminrezeptoren und wirken dadurch dämpfend auf das ZNS[16]. Sie werden bei Erregungszuständen, Ängsten, Wahnideen, Halluzinationen und Verwirrungszuständen eingesetzt, nicht nur bei Schizophrenie.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schlaf-/Beruhigungsmitteln bleiben bei Einnahme von Neuroleptika Intellekt und Bewusstsein voll erhalten.[17]
Bei katatonen Zuständen muss, wenn die Pharmakotherapie nicht nach den ersten Tagen angeschlagen hat, eine Elektrokrampfbehandlung erfolgen, um eine akute Lebensgefährdung zu vermeiden.
6.2.2 Psychotherapie
In der Akutphase einer Schizophrenie ist -ebenso wie auch im weiteren Verlauf der Krankheit- eine allgemein stützende, psychotherapeutische Begleitung durch den behandelnden Arzt erforderlich.
Lange wurde behauptet, dass für Schizophrene eine Psychotherapie schädlich sei. Dieses Vorurteil entstand im Zusammenhang mit der Gleichstellung von Psychotherapie und Psychoanalyse. Letztere ist für Kranke belastend. Sie erfordert ein ausreichendes Maß an Stabilität und ist deshalb empfindsamen und verletzlichen Kranken nicht zumutbar. Aber Psychotherapie ist nicht nur Psychoanalyse.
Zur Psychotherapie gehört einfühlsame Zuwendung, Unterstützung und Führung, zuhören und beraten, üben und lernen.
Schizophrene haben außer ihren Symptomen vielfältige Lebensprobleme, bei deren Bewältigung sie solcher psychotherapeutischer Hilfe und Führung bedürfen. In der Behandlung Schizophrener muss die Psychotherapie sachlich und flexibel gestaltet werden. Sie muss Rücksicht auf den jeweiligen Gesundheitszustand eines Kranken nehmen. In stabilen Zeiten ist eine konfliktorientierte Arbeit durchaus nötig und notwendig. Gerade junge Menschen, die an einer Schizophrenie erkrankt sind, bedürfen der Unterstützung bei ihrer Entwicklung. Einsicht in ihr seelisches Dasein trägt zur Selbsthilfe bei (siehe 6.4). Psychotherapie kann ihnen bei der täglichen Konfrontation zwischen innerer Welt und äußerer Realität beistehen.
Sie hilft ihnen bei der Ich-Findung, bei der Abgrenzung von anderen Menschen und deren persönlichen Wertsystemen.
6.2.3 Sozioatherapie
Ein besonderes Problem stellen die Schwankungen psychischer Erkrankungen dar. Wenn keine vollständige Genesung erreicht werden kann, bedarf es umfassender Betreuungsangebote. Dazu gehören –neben der Behandlung- Pflege und Rehabilitation, beschütztes Wohnen, Betätigung und Arbeit sowie Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Das Angebot einer Nachsorge und die Möglichkeit der Hilfe in Krisen ist entscheidend. Diese Hilfe muss bei Bedarf auch dann zur Verfügung stehen, wenn ein Kranker nicht mehr von sich aus die Praxis seines Arztes oder die Bereitschaftsstätte aufsucht. Zugleich muss der Betroffene die Freiheit behalten, von der Hilfe keinen Gebrauch zu machen oder sie abzulehnen.
Ausnahmen sind Situationen, in denen das Unterbringungs- oder Betreuungsrecht Hilfeleistung auch gegen den Willen der Kranken gestattet.
6.3 Therapiewahl
Um ihnen zu demonstrieren wie schwer es ist mit Schizophrenen umzugehen und die richtige Therapieform zu finden, schildere ich ihnen nun ein Gespräch zwischen einem Schizophrenen, seiner Frau und einem Psychologen.
Psychologe:
„Ich habe nicht für den Patienten zu entscheiden, was für ihn gut ist, sondern die Vorteile und Nachteile einer möglichen Therapie mit ihm zu besprechen. Dabei sollte ich mit meiner Meinung und den Gründen dafür nicht hinter dem Berg halten. Weder die Erwartung, dass der Patient meine Meinung letztlich doch übernimmt, noch die Erwartung dass in jedem Fall der Patient schon weiß, was für sie richtig ist, führt zu einem sinnvollen Gespräch.
Da schizophrenes Handeln auf ein Problem der Entwicklung weist, ist für die Begleitung längere Zeit erforderlich. Als Beispiel folgt ein längeres Gespräch, um kenntlich zu machen, dass es Zeit und Einfühlung braucht, um zu Wegen zu finden. Es sind vier Gesprächspartner: zwei Mitarbeiter, ein Patient, eine Angehörige.
Ein Patient kommt in Begleitung seiner Frau.
M1: Was führt sie zu uns? Was erwarten sie, was wir für sie tun können?
Ang.: So kann es nicht weitergehen, er muss in Behandlung.
Pat.: Ich bringe alle um, keiner bleibt am Leben, keiner. Sie sind Russe.
M2: Nein, ich heiße Roßfeld.
Pat.: Roßfeld, Pferdeschlacht, Krieg, Roß, Russ, keiner bleibt am Leben.
Ang.: Die Nachrichten der letzten Tage haben meinen Mann wieder völlig aus dem Häuschen gebracht. Er schläft nicht mehr, ständig laufen alle Radios und Fernseher in der Wohnung, unterschiedliche Sender und Kanäle, damit er ja nichts versäumt. Es gibt keine ruhige Minute. Bitte helfen sie uns.
Pat.: Ich nehme keine Tabletten, ich bringe alle um, keiner bleibt am Leben, ich lasse das nicht zu.
M1: Im Moment sind sie bei uns ganz sicher. Ich nehme große Angst und Hilflosigkeit wahr, wie kommt es dazu?
Es entsteht ein gespanntes Schweigen. Die Atmosphäre ist bedrohend.
M2: Ich hole mal etwas zu trinken, wenn über so schwere Themen gesprochen wird, kann ein Getränk entspannen.
M1: Wenn wir hier sitzen und über alles zu sprechen versuchen, werden sie noch ängstlicher und gespannter.
Pat.: Nickt
Ang.: Es kommt leicht zu solchen Ausbrüchen, wenn irgendwo auf der Welt eine kriegerische Krise ausbricht oder wenn ein Gedenktag in der deutschen Geschichte ist, zum Beispiel 8. Mai oder 20. Juli oder 3. Oktober. Ich hab schon zu meinem Mann gesagt, er soll sich nicht mehr darum kümmern, aber er ist nun mal ein politischer Mensch.
M1: Was ist es heute?
Pat.: Sie werden uns niemals besiegen, niemals. Ich bringe sie alle um.
M1: Ich frage sie, welche Nachricht sie heute so beunruhigt, oder ist ein Gedenktag, von dem ich nichts weiß?
Ang.: Es hat mit Sarajewo und den Russen und den Amerikanern zu tun. Immer sind es die Russen und Amerikaner.
M1: Wie alt waren sie, als der zweite Weltkrieg zu Ende ging?
Pat.: Fünf Jahre.
M1: Und wo haben sie gelebt?
Pat.: In Hessen auf dem Land, der Mann, der mein Vater gewesen sein soll, war auch da. Auch die Frau, die nicht meine Mutter war.
M1: Leben ihre Eltern noch?
Pat.: Frau Lehmann lebt in Fürth.
M1: Das ist ihre Mutter? Und ihr Vater?
Pat.: Ist gestorben. Ich bringe sie alle um.
Ang.: So ist das immer. Ich habe Angst, dass er wirklich mal was macht, auch gegen mich.
Pat.: Du weißt, dass ich dir nie etwas tue.
M1: Ihrer Frau gegenüber können sie ihre Aggressionen halten, geht es auch den Anderen gegenüber?
Pat.: Ich bringe sie alle um, keiner bleibt am Leben. Ihnen tue ich auch nichts, ich bringe sie alle um.
M2: Ich suche immernoch einen Gedanklichen Zusammenhang zwischen den Russen und den Amerikanern, Sarajevo und ihrer Angst und Mordswut. Und ich möchte sie fragen, wo sie sich sicher fühlen können.
Pat.: Ich will nicht ins Krankenhaus. Und ich will keine Tabletten.
Ang.: Aber zu Hause kannst du auch nicht bleiben.
M2: Was sollen wir da tun? Sehen sie irgendeinen Ansatz, dass sich zu Hause etwas ändern lässt, so dass sie und ihre Frau etwas angstfreier und entspannter leben könnten? Sie könnten ja am Tage in die Tagesklinik kommen.
Pat.: Alles Russen, alles Amerikaner, Sie müssen doch auch auf unsere Würde achten.
M1: Darum bemühen wir uns. Wann ist ihre Würde von den Russen oder Amerikanern verletzt worden?
Pat.: Ich bringe alle um, alle. Keiner bleibt am Leben.
M2: Fühlen sie sich denn hier sicher? Ich merke, dass unsere Fragen nach ihrer Biografie sie im Moment beunruhigen. Sie möchten mit Würde behandelt werden und sie brauchen momentan Schutz.
Pat.: Alle sollen mich in Ruhe lassen.
M1: Dann ist es vielleicht doch besser, sie gehen für eine kurze Weile ins Krankenhaus und schirmen sich ab.
Pat.: Aber nicht länger als eine Woche, und zu seiner Frau Du sollst mich jeden Tag besuchen.
Dies ist, bei aller in dem Gespräch enthaltenen Gefahr und Dynamik, ein harmloses Gespräch. Häufiger passiert es, dass in dieser Weise bedrohte und drohende Menschen in die Klinik eingewiesen werden. Die Zwangssituation setzt in größter Erregung ein, steigert sich dann noch mal, so dass es üblich ist, sofort Neuroleptika zu verabreichen, da die Menschen, die so in Erregung sind es nicht anders aushalten können oder wollen.
Die Aufnahme der Beziehungen kann nur von der Gewalt ausgehen. Sie darf nicht verharmlost werden. Gerade dies wird meist vermieden. Bei Verdrängung der Gewalt, bei dem Versuch zu schnellen Fügens, kann sich die ganze Gewaltsamkeit der schizophrenen Lösungs- und Angstabwehrmethode gegen sich und Andere richten (Psychoterror oder physische Lebensbedrohung). Die Kontaktaufnahme ist Gebot. Sie ist noch nicht Therapie. Der Beginn einer Therapie setzt eine freiwillige Beziehung voraus. Nicht jeder Mensch, der zu schizophrenem Handeln neigt, wird gewaltsam, oft lassen sich die spannungsgeladenen Situationen durch andere, auch innere Konstruktionen lösen.
Jeder oder Jede leben ihre eigene Schizophrenie.“[18]
6.4 Heilungschancen / Prognose
Offensichtlich handelt es sich bei Schizophrenie um ein Drehtür-Phänomen.
Der Einzelaufenthalt im Krankenhaus ist zwar kürzer, dafür sind aber häufiger Behandlungen von Rückfällen nötig. Beim Schizophrenen beträgt die Wahrscheinlichkeit der Wiedereinlieferung in den ersten zwei Jahren nach der ersten Krankheitsepisode mehr als 60%[19].
Die Prognose fällt wegen der verschiedenen Formen unterschiedlich aus.
Die Katatone Form hat eine günstige Prognose, die Paranoid-Halluzinatorische Form hingegen ist schwer zu therapieren. Die Hebephrene Form sowie Schizophrenia simplex haben eine schlechte Prognose.
7. Aktuelle Forschung über Schizophrenie
Beim gegenwärtigen Stand der Forschung werden zwei Haupthindernisse durch die Forscher herausgestellt, die bis heute nicht vollständig gelöst werden konnten:
1. Die inadäquate Einstellung zu den Schizophrenen
2. Uneinigkeit in der Auffassung des wissenschaftlichen Tatbestandes.
Der Schizophrenie wird weder von der Wissenschaft noch von der Legislative oder den staatlichen Organen die Beachtung geschenkt, die ihr zustünde.
Wichtige offene Fragen:
Ist Schizophrenie eine isolierte Krankheit?
Ist Schizophrenie das Ergebnis/ die Folge verschiedener Krankheitsfaktoren?
Wie wichtig sind genetische Faktoren?
Wie erfolgt die genetische Übertragung der Schizophrenie?
Es gibt noch mehrere grundsätzlichen Fragen, die einer Klärung bedürfen bevor ein entscheidender Fortschritt im Verständnis und in der Therapie der Schizophrenie erzielt werden kann.
Deutsche Wissenschaftler haben am 14.06.2000 eine Offensive gegen die Schizophrenie gestartet. Bundesweit liefen 30 Forschungsprojekte an, um dem psychischen Leiden besser zu begegnen. Besonderes Augenmerk legen die Forscher auf die Früherkennung. Durchschnittlich dauert es fünf Jahre, bis die Krankheit nach ersten, meist unbemerkten Anzeichen, behandelt werde. Deswegen sollen in Köln, Düsseldorf, Bonn und München Früherkennungszentren auf- und ausgebaut werden.
Zudem soll Hausärzten ein Fragebogen bereitgestellt werden, um die Risikogruppe besser zu erkennen und früher behandeln zu können.
Konzentrationsmängel, Depressivität und Leistungsschwund können erste unspezifische Anzeichen sein. Zwei Drittel der Patienten erkranken mehrmals. Die genaue Ursache dieser Krankheit ist immer noch unklar. Stress gilt als Auslöser. Kognitive Verhaltenstherapie kann helfen, Stress- und Alltagsbewältigung einzuüben. Fortschritte bei der Klärung der Ursache erwarten Wissenschaftler von der Genforschung.
8. Ähnliche Krankheiten
- Multiple Persönlichkeit:
Die extremste Form der Bewusstseins-Spaltung ist die multiple Persönlichkeit.
Der Patient entwickelt zwei (oder mehr) unterschiedliche Persönlichkeiten, die abwechselnd und für variable Zeitperioden die bewusste Kontrolle der Persönlichkeit übernehmen. Jeder Teil der multiplen Persönlichkeit stützt sich auf Bestände von Motiven, die mit den Motiven der anderen Teile im Konflikt stehen. Gewöhnlich, wenn auch nicht immer, weiß eine Teilpersönlichkeit nichts von der anderen.
Häufig wird die multiple Persönlichkeit mit der gespaltenen Persönlichkeit der Schizophrenie verwechselt.
Bei der Schizophrenie ist der Betroffene von der „Realität abgespalten “. Bei der multiplen Persönlichkeit hingegen bleibt der bewusste Teil der Persönlichkeit mit der Realität in Kontakt, reagiert darauf allerdings neurotisch[20].
Die Symptome der multiplen Persönlichkeit sind manische Depressionen und Unterschiede in Handschrift, Syntax, Stimme, Akzent, Gesichtsausdruck und Körperhaltung auf.
- Schizoide Persönlichkeit
Sie leiden unter der Tatsache, dass sie keine natürlichen sozialen Kontakt aufbauen können. Sie sind einerseits überempfindlich, geben sich auf der anderen Seite aber schroff und abweisend. Jähzorn ist ein klassisches Element der Schizoiden Persönlichkeit.
Durch die fehlende Anpassung ergeben sich mannigfaltige Probleme in der Partnerschaft, im Freundeskreis und im Beruf.
Nachwort
Sie sehen, vieles rund um die Schizophrenie ist noch nicht geklärt. Ich hoffe, ihnen jedoch einen Ein- und Überblick in die Schizophrenie gegeben zu haben.
Vor allem wünsche ich mir, dass sie Schizophrene nun etwas besser verstehen können und jenen einige Unannehmlichkeiten erspart bleiben können!
Für den Fall dass sie jemanden kennen, der Schizophrenie hat, oder sie vielleicht selber davon betroffen sind, finden sie im Anschluss noch einige Internetadressen und Telefonnummern von Kliniken, die sich mit Schizophrenie auseinandersetzen.
www.evk-ge.de/innernet/kliniken_psychiatrie.html
www.uke.uni-hamburg.de/kliniken/psychiatrie/kernklinik/index.de.html
www.zi-mannheim.de/kliniken/klipp.htm
http://www.zsp-werra-meissner.de/info/leistungsuebersicht.htm
Psychiatrische Tagesklinik Andernach: Tel:: 02632/407343
Psychiatrische Tagesklinik Mayen: Tel.: 02651/900793
Psychiatrische Tagesklinik Koblenz: Tel.: 0261/16449
Literaturverzeichnis:
Dr. med P. Rommelfanger: Amtsarztfragen für die Heilpraktikerprüfung : Psychiatrie
Karl Heinz Herzog
2.Auflage
Ardea Verlag
Dr. med P. Rommelfanger: Amtsarztfragen für diePsychotherapeutenprüfung:
Band 1
Karl Heinz Herzog
Ardea Verlag, 1996
Dr. med. P. Rommelfanger: Amtsarztfragen für die Psychotherapeutenprüfung: Band 2
Karl Heinz Herzog
Ardea Verlag, 1997
Roland Becker, Ralf Mulot, Manfred Wolf: Fachlexikon der sozialen Arbeit
4. Auflage 1997
Herausgegeben vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge
Eigenverlag
Klaus Dörner, Ursula Plog: Irren ist menschlich
Lehrbuch der Psychiatrie/ Psychotherapie
2. Auflage
Psychiatrie-Verlag, 1996
Zimbardo Ruch: Lehrbuch der Psychologie
(eine Einführung für Studenten der Psychologie, Medizin und Pädagogik)
W.F. Angermeier, J.C. Brengelmann, Th.J.Thiekötter
Dritte, neu bearbeitete Auflage
Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New York, 1978
Christoph Zink: Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch
Mit klinischen Syndromen und Nomina Anatomica
256., neu bearbeitete Auflage
Walter de Gruyter; Berlin, New York, 1990
Swen Barnow, Harald J. Freyberger, Wolfgang Fischer:
Von Angst bis Zwang
Ein ABC der physikalischen Störungen
Formen, Ursachen und Behandlung
1. Auflage 2000
Internetadressen:
www.ahc-consilium.at/daten/schizophrenie.htm
www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/psk/9179.html
www-kpp.med.uni-rostock.de/?pg=2&sub=4
www.psychiatrie.de/diagnose/schizo.htm
www.psychiatrie-aktuell.de/disease/detail.jhtml;jsessionid=FZTZYUHGIGYXQCUCEQWCCZQKQISCGIMO?itemname=schizophrenia&s=4
www.psychotherapie.de/report/2000/06/00061401.htm
www.suppeninstitut.de/suppentag2002/images/zwilling/zwilli01.gif
www.uni-hamburg.de/Projekte/plex/Plex/Lemmata/S-Lemma/Schizoph.htm
www.uni-leipzig.de/psy/kraep.html
http://www.psychotherapie.de/report/2000/04/00040602.htm
Verwendete Werke in den einzelnen Punkten:
1. Lehrbuch der Psychologie
Pschyrembel
www.uni-leipzig.de/psy/kraep.html
Fachlexikon der sozialen Arbeit
2. Pschyrembel
www.ahc-consilium.at/daten/schizophrenie.htm
Lehrbuch der Psychologie
http://www.psychiatrie-aktuell.de/disease/detail.jhtml;jsessionid=FZTZYUHGIGYXQCUCEQWCCZQKQISCGIMO?itemname=schizophrenia&s=4
3. Pschyrembel
www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/psk/9179.html
www.ahc-consilium.at/daten/schizophrenie.htm
4. Lehrbuch der Psychologie
www.sgipt.org/hm/gesch/bleuler.htm
Psychiatrie
Pschyrembel
5. Psychiatrie
Lehrbuch der Psychologie
6. http://www-kpp.med.uni-rostock.de/?pg=2&sub=4
http://www.psychotherapie.de/report/2000/04/00040602.htm
http://www.psychiatriegespraech.de/sb/schizophrenie/schizo_ther.htm
7. Lehrbuch der Psychologie
8. Truddi Chase, Roman: Aufschrei
[...]
[1] Zimbardo Ruch, Lehrbuch der Psychologie, 3.Auflage 1978, S.381
[2] www.uni-leipzig.de/psy/kraep.html
[3] Melancholie, Schwermut, Schlafstörungen; familiär gehäuft auftretend
[4] Cyclotymie: endogene Depression, äußert sich in Manie (gehobene Stimmung), Melancholie oder endogener Depression (herabgestimmt sein)
[5] Gaebel und Falkai 1996
[6] www.ahc-consilium.at/daten/schizophrenie.htm
[7] Zimbardo Ruch: Lehrbuch der Psychologie S.278
[8] wichtige Transmittersubstanz im Gehirn (Transmitter: Überträgersubstanz) Vermutung: Dopaminmangel/-überschuss führt zu psychischen Erkrankungen (à Schizophrenie), Pschyrembel
[9] Moderne Methode der Gehirnuntersuchung
[10] www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/psk/9179.html
[11] www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/psk/9179.html
[12] www.sgipt.org/hm/gesch/bleuler.htm
[13] pathologische Steigerung der Motorik mit zum Teil unwillkürlich ablaufenden Bewegungen.
[14] Charakterstörung beruht nicht auf Wahn sondern auf Veränderung der Persönlichkeit (Eifersucht, Verfolgung, Beziehung)
[15] (Hebe = Jugend; phren, phrenos = Geist) Jugendirresein
[16] Zentralnervensystem
[17] Psychologie-Fachgebärdenlexikon: Neuroleptika
[18] irren ist menschlich S.157
[19] Zimbardo Ruch, Lehrbuch der Psychologie S.379
Häufig gestellte Fragen
Was ist Schizophrenie laut diesem Text?
Schizophrenie ist eine endogene Psychose, die durch den Zusammenbruch des integrativen Gefüges der Persönlichkeit gekennzeichnet ist. Dies führt zu mangelnder Kontaktfähigkeit, Depersonalitionserlebnissen, Spaltung der Persönlichkeit und Suizidgefährdung.
Wer ist besonders gefährdet, an Schizophrenie zu erkranken?
Menschen mit familiärer Disposition sind anfälliger. Die Erkrankungswahrscheinlichkeit bei Angehörigen ersten Grades liegt bei etwa 10%. Sind beide Elternteile erkrankt, dann steigt das Risiko auf 40%. Männer und Frauen sind gleich oft betroffen, wobei Männer tendenziell früher erkranken.
Was sind die Ursachen von Schizophrenie?
Die Ursachen sind vielfältig. Eine genetische Disposition scheint auf verschiedenen Genen lokalisiert zu sein. Biochemische Ursachen, wie ein Überschuss an Dopamin, und Veränderungen der Hirnstruktur werden ebenfalls diskutiert. Die Breeder-Hypothese (Stress als Ursache) und die Drift-Hypothese (sozialer Abstieg) werden ebenfalls erwähnt.
Was sind die Symptome von Schizophrenie nach Kurt Schneider?
Schneider unterscheidet zwischen Symptomen ersten und zweiten Ranges. Symptome ersten Ranges sind Ich-Störungen, Gedankeneingebung/Gedankenlautwerden, Wahnwahrnehmungen, Stimmenhören und Fremdbeeinflussungserlebnisse. Symptome zweiten Ranges sind Wahneinfall, Halluzinationen, Gefühlsverarmung und Verstimmungen.
Was sind die Symptome von Schizophrenie nach Eugen Bleuler?
Bleuler unterscheidet in Grundsymptome (die 4 A's) und akzessorische Symptome. Die Grundsymptome sind Störung der Assoziation, Störung der Affekte, Autismus und Ambivalenz. Akzessorische Symptome sind Halluzinationen, Wahn und Katatonie.
Welche verschiedenen Formen der Schizophrenie werden in diesem Text beschrieben?
Es werden die katatone Form, die paranoid-halluzinatorische Form, die hebephrene Form, Schizophrenia simplex und Kinderschizophrenie beschrieben.
Welche Behandlungsmöglichkeiten für Schizophrenie gibt es?
Die Behandlung basiert auf drei Säulen: somatische Therapie (Pharmakotherapie), Psychotherapie und Soziotherapie. Die Kombination dieser Therapien ist entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung.
Was sind die Heilungschancen bzw. die Prognose bei Schizophrenie?
Schizophrenie ist nicht heilbar, aber die Symptome sind gut zu beeinflussen. Oft sind sie ganz zu beseitigen. Die Prognose ist von der Form der Schizophrenie abhängig. Die katatone Form hat eine günstige Prognose, während die hebephrene Form und Schizophrenia simplex eine schlechte Prognose haben.
Was sind ähnliche Krankheiten wie Schizophrenie?
Multiple Persönlichkeit und schizoide Persönlichkeit werden als ähnliche Krankheiten genannt.
Wo finde ich weiterführende Informationen und Hilfe?
Im Text sind mehrere Internetadressen und Telefonnummern von Kliniken angegeben, die sich mit Schizophrenie auseinandersetzen. (z. B. www.evk-ge.de/innernet/kliniken_psychiatrie.html)
- Quote paper
- Julia Essig (Author), 2003, Der Mensch - Gegenstand wissenschaftlicher Forschung - Schizophrenie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108097