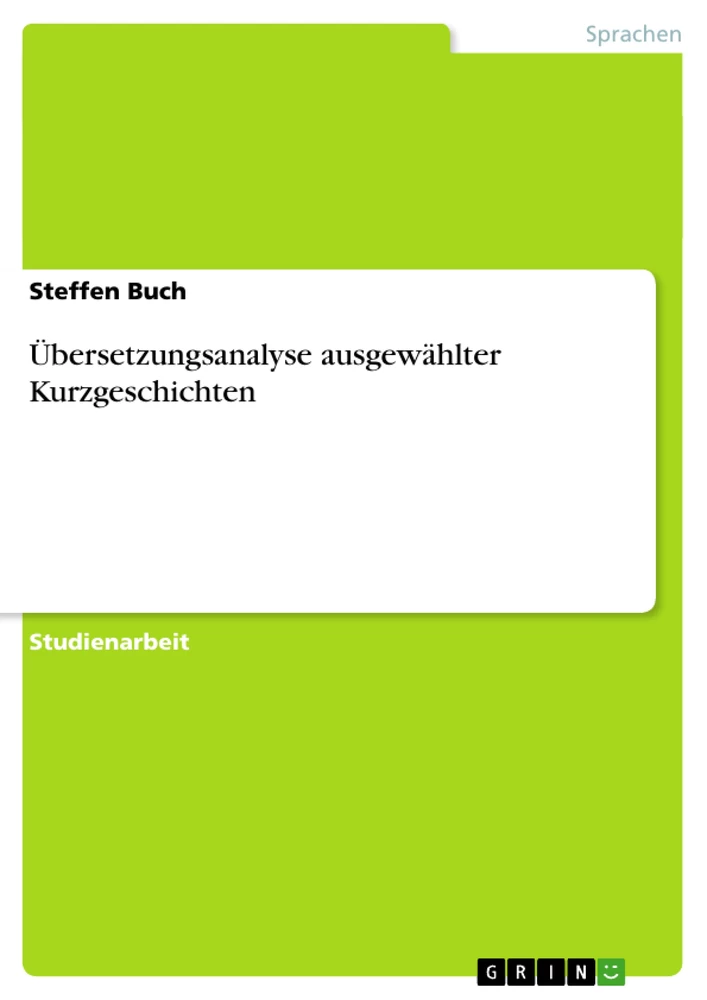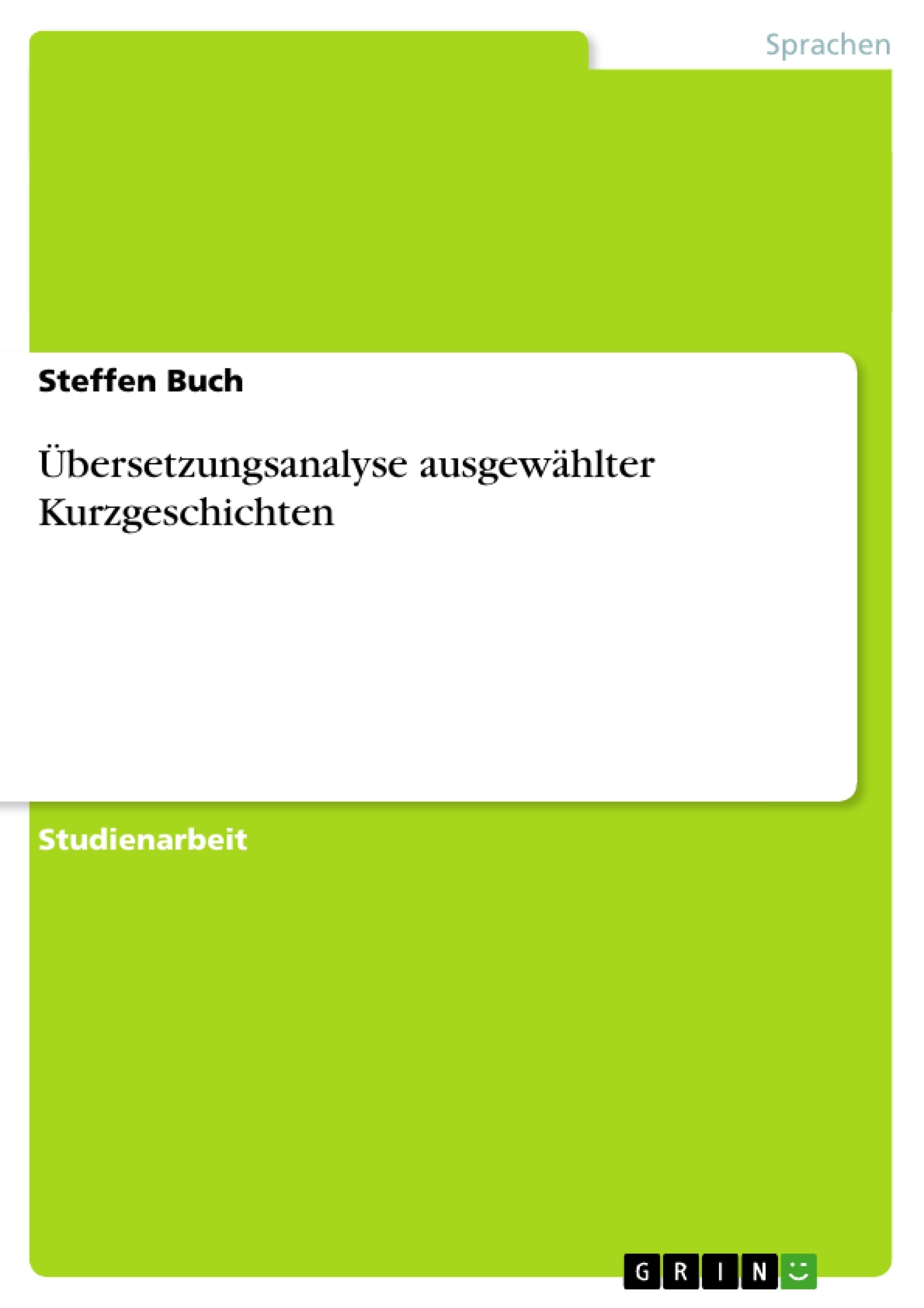Was macht eine Übersetzung zu einer wahren Kunstform? Tauchen Sie ein in eine faszinierende Analyse ausgewählter spanischer Kurzgeschichten und ihrer deutschen Übersetzungen, die weit mehr als nur einen bloßen Sprachwechsel offenbart. Diese tiefgründige Untersuchung, angesiedelt an der Schnittstelle von Literaturwissenschaft und Übersetzungswissenschaft, seziert die komplexen Herausforderungen, denen sich Übersetzer stellen müssen, um nicht nur den semantischen Kern, sondern auch die subtilen Nuancen, kulturellen Kontexte und stilistischen Feinheiten der Originaltexte in die Zielsprache zu übertragen. Anhand von Werken so bedeutender Autoren wie Ciro Alegría, Enrique Anderson Imbert und Miguel Hernández werden Translationsprobleme wie Kultureme, idiomatische Wendungen und die oft trügerische Äquivalenz von Worten und Konzepten beleuchtet. Es wird erkundet, wie Übersetzungsrichtlinien und Erzählkonventionen die Interpretation und letztendliche Gestaltung des Zieltextes beeinflussen, und wie der Übersetzer zwischen AT-orientierter und ZT-orientierter Translation navigiert, um die beabsichtigte Wirkung auf den Leser zu erzielen. Die Analyse geht über die reine linguistische Betrachtung hinaus und dringt zu den philosophischen Fragen der Übersetzbarkeit vor, wobei Humboldts These von der Unmöglichkeit perfekter Entsprechung und die subjektive Interpretation des Übersetzers im Vordergrund stehen. Die Leser erwartet eine kritische Auseinandersetzung mit den Begriffen Invarianz, Äquivalenz und Adäquatheit, sowie eine detaillierte Übersetzungskritik, die aufzeigt, wie kulturelle Unterschiede und Sprachenpaarspezifika die Translation beeinflussen. Diese Studie ist ein Muss für alle, die sich für Literatur, Sprachwissenschaft, interkulturelle Kommunikation und die Kunst der Textanalyse interessieren und die tiefer in die Welt der spanischen Literatur und ihre deutsche Übersetzung eintauchen möchten. Entdecken Sie, wie eine gelungene Übersetzung zur Brücke zwischen Kulturen wird und ein neues Verständnis für die Vielschichtigkeit sprachlicher und kultureller Identität ermöglicht. Eine Reise durch die Translationswissenschaft, die den Leser mit einem neuen Blick auf die Literaturübersetzung und die Rolle des Übersetzers als Vermittler zwischen Welten zurücklässt.
Inhaltsverzeichnis:
I. Einleitung
II. Übersetzungswissenschaft
i. Übersetzung und Translation
ii. Begriffe der Translationswissenschaft
iii. Translationsprobleme
iv. Übersetzungsrichtlinien
v. Übersetzungskritik
III. Analyse translationsproblematischer Stellen in ausgewählten Kurzgeschichten
i. Ciro Alegría – Leyenda de Tungurbao
ii. Enrique Anderson Imbert – Siesta
iii. Francisco Ayala – Mímesis, némesis
iv. Francisco Ayala – Otro pájaro azul
v. Camilo José Cela – Las parejas que bogan en el estanque del Retiro
vi. Rubén Darío – La resurrección de la rosa
vii. Jorge Dávila Vázquez – Logroño
viii. Miguel Hernández – Chiquilla, popular
IV. Abschlussbemerkung
Literaturverzeichnis
I) Einleitung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit acht Kurzgeschichten in spanischer Sprache und ihrem jeweiligen deutschen Translat. Die Tatsache, dass die Translationen von nur einer Person getätigt wurden, lässt die Vermutung aufkommen, dass das Ergebnis dieser Arbeit ein Profil der translatorischen Kompetenz der Übersetzerin sein könnte. Allerdings ist diese Arbeit eher daran interessiert translationsproblematische Textstellen zu analysieren und Gründe für dessen vorliegende deutsche Übersetzungen zu benennen. Die Tatsache, dass hier nicht die gesamten acht Kurzgeschichten in voller Länge diskutiert werden können, und dadurch bedingt die besondere Konzentration auf problematische Passagen, sprechen gegen ein Übersetzerprofil als Ergebnis dieser Arbeit.
Zur Auswahl der Textstellen, die hier besprochen werden, lässt sich sagen, dass sie nach der Lektüre des Ausgangstextes1 als schwierig zu übersetzen eingeschätzt wurden. Diese Auffälligkeit wurde durch den Vergleich mit den entsprechenden Passagen des Zieltextes bestätigt. Nach der Analyse der syntaktischen und semantischen Merkmale des Ausgangstextes folgte eine kritische Betrachtung der Struktur des Translats. Die daraus entstandene Diskussion ist Kernstück dieser Arbeit. Der exemplarische Charakter der Einzeluntersuchungen ist gewollt, wobei die Einbettung der Textstelle in ihren jeweiligen Kontext in der Diskussion berücksichtigt ist. Die Einzelanalysen folgen keiner festgelegten Reihenfolge von Untersuchungsaspekten. Statt dessen verwendet jede einzelne Analyse nur diejenigen Aspekte, die für sie von Interesse sind und zwar in der Reihenfolge, in der sie am wichtigsten erscheinen.
II) Übersetzungswissenschaft
i) Übersetzung und Translation
„Translation ist ein „Prozess, der mit der Aufnahme des AS-Textes beginnt und mit der Wiedergabe des ZS-Textes endet und dessen wichtigsten Bestandteil der Kodierungswechsel, d.h. die Umschlüsselung eines gegebenen Textes aus dem Kode AS in den Kode ZS“.“ (Otto Kade, zitiert nach Knauer, S.8)
„Wir verstehen daher unter Übersetzen die Translation eines fixierten und demzufolge permanent dargebotenen bzw. beliebig oft wiederholbaren Textes der Ausgangssprache in einen jederzeit kontrollierbaren und wiederholt korrigierbaren Text der Zielsprache.“
(Otto Kade, zitiert nach Snell-Hornby, S.37)
Die moderne Übersetzungswissenschaft ist ein Teilbereich der Translationswissenschaft, welche sich außerdem auch mit der Dolmetschwissenschaft beschäftigt. Übersetzung und Dolmetschen funktionieren in weiten Teilen analog. Letzteres ist für diese Arbeit jedoch nicht von Belang und wird deswegen nicht weiter behandelt.
Der Prozess der Übersetzung beginnt mit der Vorlage eines Textes, dessen Translation in Auftrag gegeben wird. Dieser Text wird daraufhin analysiert, um zu einer Klärung des Inhalts, des Stiles und dessen Mitteln und seiner Wirkung zu gelangen. Im letzten Schritt werden die in der Textanalyse erlangten Erkenntnisse dazu benutzt den Text in einer anderssprachlichen Schriftform wiederzugeben.
Der Begriff der Übersetzung ist ambivalent, denn er bezeichnet sowohl den Prozess der Umkodierung eines Textes als auch dessen Ergebnis, den ZT. Um die unterschiedlichen Aspekte der Übersetzung zu betonen, empfiehlt sich die Verwendung der Begriffe Translation und Translat, respektive. Der Begriff der Übersetzung wird dadurch allerdings nicht überflüssig und kann auch im Zusammenhang mit Translation und Translat verwendet werden.
Um eine Textanalyse durchführen zu können, benötigt der Übersetzer ein der Textsorte und Textfunktion entsprechendes fachspezifisches Wissen, um den Inhalt des AT verstehen und treffend in die ZS übertragen zu können. So muss er zum Beispiel bei der Translation einer Bedienungsanleitung, die Nutzung des beschriebenen Objektes verstehen, um eine möglichst unmissverständliche zielsprachliche Anleitung erstellen zu können. Auch die Textfunktion des ZT muss äquivalent zu der des AT stehen. (Zum Begriff der Äquivalenz, siehe Kap. II.ii)
Bei der Translation von literarischen Texten benötigt der Übersetzer zumeist weniger fachterminologisches dafür um so mehr kulturelles und landeskundliches Wissen. Um sein Fachwissen translatorisch anwenden zu können, muss er selbstverständlich Lexik und Grammatik der AS und der ZS beherrschen. Darüber hinaus muss er aber auch die semantischen, pragmatischen und stilistischen Besonderheiten der jeweiligen Sprache erkennen, bewerten und umsetzen können.
ii) Begriffe der Translationswissenschaft
Ausgangs- und Zieltext können sich, obwohl sie den selben Textinhalt in der selben Textfunktion vermitteln, in ihrer Satzstruktur, ihrer Wortwahl, ihren stilistischen Mitteln usw. unterscheiden. Dabei könnte man in Anlehnung an Noam Chomsky von einer gleichbleibenden Tiefenstruktur (bezogen auf Textinhalt und – Funktion) und zwei unterschiedlichen Oberflächenstrukturen (AT und ZT) sprechen. Allerdings bezeichnet Chomsky mit diesen Begriffen Zusammenhänge sprachlicher Ausprägung(en) in nur einer Sprache.
Bei der Translation von literarischen Texten sind nicht immer alle Oberflächenstrukturen gleichwertig, da sie verschiedene Assoziationen hervorrufen können und somit unterschiedliche Textwirkungen erzielen.
Die translationswissenschaftliche Diskussion verwendet, zur Beschreibung der Relationen zwischen AT und ZT die Trias Invarianz, Äquivalenz, Adäquatheit.
- Invarianz bezeichnet die Tatsache des Gleichbleibens dessen, was nicht verändert werden soll. Das was nicht verändert werden soll, wird als Invariante bezeichnet.
- Äquivalenz bezeichnet die Erhaltung der Textfunktion unter Berücksichtigung unterschiedlicher kultureller Konventionen. Das Translat soll dieselbe Information vermitteln und damit dieselbe Wirkung erreichen.
- Adäquatheit betont den Zweck der Translation eines Textes. Die phänotypische Ausprägung des Translats (die Oberflächenstruktur) wird durch den Zweck bestimmt. Adäquatheit fordert außerdem, dass Übersetzungen zeitgerecht und zielgruppengerecht sind
Der Aspekt der Zweckbedingtheit (Skopos) lässt sich durch die Gegenüberstellung der AT-orientierten mit der ZT-orientierten Translation deutlich machen. Allgemein ist eine AT-orientierte Translation bestrebt den Leser möglichst nah an Inhalt und Form des AT heranzuführen. Das kann dazu führen, dass sich der Leser mit ihm unbekannten oder fremden Metaphern, Vergleichen und anderen stilistischen Formen auseinandersetzen muss, die in der Regel den Muttersprachlern der AS allgemein verständlich sind. Diese Form der Übersetzung hat einen edukativen Charakter und ihren Zweck könnte man mit einer zusätzlichen Informationsvermittlung beschreiben. Sie eignet sich besonders für Leser, die auch über Kenntnisse der AS verfügen. Dagegen versucht die ZT-orientierte Translation stärker den Textinhalt an die ZS anzupassen und sie so an den Leser heranzutragen, der über keine Kenntnisse der AS verfügt.
iii) Translationsprobleme
Translationsprobleme entstehen auf verschiedenen Ebenen. Humboldt argumentiert zum Thema der allgemein-theoretischen Übersetzbarkeit von Texten, dass „kein Wort Einer (sic) Sprache vollkommen einem in einer anderen Sprache gleich ist“2. Somit ist es nicht möglich, den wahren Sinn eines Textes durch eine Übersetzung einzufangen und auch der Übersetzer kann nur seine eigene Interpretation, seine subjektive Wahrnehmung des Originaltextes im Translat übermitteln.
Zur Zeit geht man von einer prinzipiellen Übersetzbarkeit aus, welche allerdings auch Probleme klar benennt.
So können als Ursache von Übersetzungsschwierigkeiten Kulturunterschiede feststellen, die sich durch sogenannte Kultureme (Textsortenkonventionen, Körpersprache Situationsverhalten, etc) darstellen.3
Besonders die lexikalischen Systeme zweier Sprachen entsprechen sich oftmals kaum. Deshalb scheint der Vorschlag der Transposition angemessen zu sein, an Stelle von Wörtern Bündelungen semantischer Merkmale zu übersetzen.4
Analog zur Transposition beschäftigt sich die Sprachenpaarspezifik mit den strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Sprachen zur Lösung von Übersetzungsproblemen. Eine Annäherung an eine Lösung solcher Probleme könnte durch eine kontrastive, Korrespondenz- und Präferenzregeln der jeweiligen Sprachen beachtende, Grammatik leisten.5
Der Vorwurf, eine Übersetzung käme auch immer einer Interpretation und somit einer Bearbeitung gleich, muss an dieser Stelle recht gegeben werden. Einen Text zu übersetzen, bedeutet, ihn zu verstehen, d.h. ihn mit einem dem Übersetzer zur Verfügung stehenden Wissensinventar zu analysieren und ihn daraufhin in die ZS umzukodieren. Es kann keine objektive Übersetzung geben, sondern nur eine alle Aspekte des Textes gut durchdenkende.
iv) Übersetzungsrichtlinien
Die translatorische Betrachtung syntaktischer Strukturen verwendet den Begriff der Korrespondenzregeln, um auf die (zumeist grammatikalischen) Zusammenhänge zwischen AS und ZS zu verweisen. Diese sind gleichfalls in dem Begriff der Sprachkompetenz impliziert. Die zweite Sorte syntaktischer Verwendungsregeln sind die Präferenzregeln. Diese Regeln geben Präferenzen für bestimmte Textsorten und Textfunktionen an. Sie geben somit, über die Ebene der Korrespondenzregeln hinaus, Weisungen wie ein Text der AS in der ZS ausgedrückt werden kann. Auch hier ist der wichtigste Aspekt, der der Zielgerichtetheit und der Zweckbedingtheit der Translation.
Diese Untersuchung verwendet den Begriff der Erzählkonventionen, um auf Translationsprobleme, die durch Kultureme oder unterschiedliche syntaktische Regeln bedingt sind, hinzuweisen. Bislang liegen weder eine kontrastive spanisch-deutsche Grammatik, noch umfassende repräsentative Untersuchungsergebnisse der spanisch-deutschen Translation vor. Es ist allerdings hinreichend bekannt, dass das Deutsche und das Spanische unterschiedliche sprachliche Konventionen – nicht nur grammatischer, sondern auch stilistischer Art – pflegen. Der Begriff der Erzählkonventionen ist bewusst sehr umfassend und wenig differenziert gehalten, um auf die Fülle der Missverständlichkeiten und Translationsprobleme kultureller und sprachlicher Unterschiede zu verweisen.
v) Translationskritik
Um zu einer gerechten Translationskritik zu gelangen, muss man sich aus prozessorientierter Sicht des Skopos und des Übersetzungsauftrages bewusst werden. Die Fragen warum und wie ein Translat seine Form erhält, können durch solch eine Betrachtung geklärt werden.
Wichtiger jedoch ist der produktorientierte Ansatz, der die Aspekte der semantischen Äquivalenz, der lexikalischen Adäquatheit und der grammatischen Korrektheit beleuchtet. Dieser Ansatz ist entscheidend nicht nur für die Erhaltung der Textfunktion, sondern auch für die möglichst nahe Entsprechung des ZT im Vergleich mit dem AT.
Als Instrument der Translationskritik führt eine Aspektmatrix, die beliebig erweiterbar ist, verschiedene Aspekte an, auf die in der Komparation von ZT mit AT zurückgegriffen werden kann.
Eine solche Matrix kann die Umsetzung von Informationszustand und Informationsvermittlung, Texttyp, Kulturemen, Konnotationen, Verfremdungen, Lautmalerei, Erzählperspektive, Idiomatik, und Sprachebene beleuchten.6
III) Analyse translationsproblematischer Stellen in ausgewählten Kurzgeschichten
i) Ciro Alegría– Leyenda de Tungurbao
Leyenda de Tungurbao
Die Sage vom Tungurbao im Amazonasurwald
Bereits der Titel eröffnet dem spanischsprachigen Leser, dass es sich bei der Erzählung um eine im indianischen Genre angelegte Geschichte handelt. Bei dem Namen Tungurbao handelt es sich um einen für den deutschsprachigen Leser unbekannten Namen. Der deutschsprachige Leser assoziiert durch den Klang des Namens den Bezug zu einem indianischen Kulturraum. Dadurch ist die Überschrift wörtlich ins Deutsche übertragbar. Das Übersetzungsergebnis wäre somit Die Legende von Tungurbao .
Anstelle des Wortes Legende setzt das Translat das Wort Sage . Bei der Übersetzung des spanischen leyenda ins Deutsche handelt es sich um eine Diversifikation mit den möglichen Übersetzungen Legende und Sage . Beide Begriffe sind synonym in Bezug auf ihre Definition als auf historischen Tatsachen basierende Erzählung mit allerdings nicht verifizierbaren Zudichtungen. In der pragmatischen Verwendung dieser Begriffe, bezieht sich Legende auf jüngere Erzählungen, Sage eher auf weiter zurückliegende Helden- und Göttermythen .
Des weiteren fügt der ZT dem Namen Tungurbao den Zusatz im Amazonasurwald bei, um die Assoziation eines indianischen Kulturraumes zu bestätigen. Aus Gründen des adäquaten Übersetzens ist diesem Zusatz zuzustimmen, da dieser dem deutschsprachigen Leser einen eindeutigen Hinweis auf die Zuordnung von Tungurbao als in den indianischen Raum gehörig gibt.
De Tungurbao allerdings mit vom Tungurbao zu übersetzen erscheint mir unbegründet, da der AT auch keinen bestimmten Artikel verwendet. Der Kontext der Erzählung gibt keinen Grund an, hier einen bestimmten Artikel einzusetzen. Es sei angemerkt, dass diese Stelle als Einzige den Zusatz des bestimmten Artikels trägt.
Veo el cerro Lluribe, apenas columbro su frente de roca perdida entre las nubes, y sé que también nos diría de Tungurbao.
Ich sehe den Lluribe-Gipfel und kann kaum seine wolkenverhangene Stirn erkennen, aber ich weiß, daßauch er von Tungurbao erzählen könnte.
Die Übersetzung übernimmt die Aufzählungsstruktur des AT außer der Anknüpfung des letzen Hauptsatzes durch aber an Stelle von und . Obwohl diese Änderung durchaus den Erzählkonventionen der deutschen Sprache entspricht, ließe sich y auch ausgangssprachlich orientiert durch und übersetzen.
Eine deutlichere Übersetzungsschwierigkeit findet man in dem Begriff frente de roca . Eine Übersetzung als Felsspitze wäre hier wörtlich gehalten und würde zudem nicht die metaphorischere Bedeutung einer Stirn aus Felsen beinhalten. Die metaphorische Übersetzung ruft zudem die Vorstellung einer beseelten Natur auf, und passt sich somit der Fähigkeit des Berges zur Wahrnehmung an.
También la luna, dueña de la claridad que pelea con la sombra.
Auch der Mond, der über das Licht gebietet und mit dem Schatten kämpft.
Diesem Satz fehlt ein Vollverb, aber da er analog zu dem vorangehenden Satz steht, stellt dies für die Übersetzung keine Schwierigkeit dar. Um ausdrücklich auf den analogen Satzaufbau zu verweisen, sollte también hier mit so auch übersetzt werden. Problematisch und unübertragbar sind der geschlechtliche Unterschied zwischen la luna und der Mond und daran geknüpfte Konzepte. Lässt man diese konzeptuellen Unterschiede beiseite, lässt sich die Satzstruktur wörtlich fortsetzen: Herr des Lichtes, der mit dem Schatten kämpft.
Oyendo contar de Tungurbao, cuando las gentes hablan por gusto, preguntando de propósito, quedándome en la ignorancia de mucho y conociendo hasta pasmarme o llorar, yo he logrado juntar hartas historias de Tungurbao.
Wenn ich von Tungurbao erzählen höre, wenn die Leute von sich aus reden, stelle ich gezielte Fragen. Vieles bleibt mir verborgen, aber vieles erfahre ich, was mich erstarren läßt oder zum Weinen bringt – und so habe ich eine Menge von Geschichten von Tungurbao zusammengetragen.
Die Gerundien des AT (preguntando , quedándome , conociendo ) indizieren hier die Mittel mit denen der Erzähler die Geschichten von Tungurbao zusammengetragen hat. Eine Übersetzung der Gerundien sollte deshalb von dadurch, dass eingeleitet werden, um den Sinnzusammenhang zu erhalten. Dadurch kann auch der Aufzählungsstil der Satzstruktur beibehalten werden.
Der ZT versucht durch eine Zergliederung in zwei Sätze dem Satz eine den deutschen Konventionen eher entsprechende Form zu geben, allerdings löst dies den logischen Zusammenhang der Teilsätze auf. Sind die Bedeutungen der Gliedsätze im AT eng aneinandergeknüpft, zerreißt der ZT diese Einheit und bildet zwei Bedeutungsblöcke.
Außerdem wird im zweiten Satz durch das Ersetzen des y mit aber das stilistische Mittel der Betonung des Gegensatzes zwischen quedándome en la ignorancia und conociendo aufgelöst. Dies kann jedoch durch eine direkte Übersetzung des y mit und vermieden werden.
Miren el sendero de oro que une la luna al Marañon.
Schaut die Silberspur an, die den Mond mit dem Marañon verbindet.
Betrachtet man diese Übersetzung, so scheint es, dass das Licht des Mondes im Spanischen als golden empfunden wird und im Deutschen als silberfarben. Jedoch selbst wenn dem so ist, muss man nicht notwendigerweise neben dem sprachlichen auch den kulturellen Unterschied übertragen. Eine AT-orientierte Übersetzung erlaubt im ZT von einem goldenen Pfad zu sprechen, ohne dass der deutschsprachige Leser davon verwirrt würde. Eine Transformation in die Silberspur ist somit nicht notwendig.
ii) Enrique Anderson Imbert– Siesta dfghfljhökhjfgkhjl
En eso veo que de dos casas contiguas salen und muchacho y una muchacha.
Nun sehe ich, daßaus zwei aneinander-gebauten Häusern ein Jüngling und ein Mädchen herauskommen.
Im AT knüpft en e s o an un horno des vorangegangenen Satzes an und bildet somit einen direkten Satzanschluss. Im ZT haben wir den Zusammenhang zwischen den beiden Sätzen verloren. Da dieser Satzanschluss übersetzbar und außerdem für die Textwirkung entscheidend ist, sollte er somit auch durchgeführt werden und durch in diesem (Ofen ) erhalten werden.7 Dos casas contiguas bezeichnen zwei direkt nebeneinander gebaute Häuser. Bei der Wahl eines treffenden deutschen Adjektivs zur Bezeichnung von contigua , scheint mir das Wort aneinandergrenzend angemessener als aneinandergebaut . Ersteres betont stärker den Aspekt der Nachbarschaft, letzteres den architektonischen Aspekt des miteinander-verbaut-Seins.
Der spanische Text verwendet das Wortpaar muchacho – muchacha zur Bezeichnung des jungen Paares. Dem Deutschen fehlt ein entsprechendes Wortpaar, das neben dem Inhaltlichem auch orthographisch eine solche Analogie beinhaltet. Die Übersetzung mit Jüngling und Mädchen scheint mir deshalb optimal.
No siquiera han mirado a su alrededor. No hay alrededor:
Sie haben sich nicht einmal umgeschaut. Es gibt keine Umgebung für sie.
Bei der Übersetzung dieser Stelle ist es entscheidend alrededor in beiden Sätzen mit dem selben Wort zu übersetzen. Der Autor benutzt hier ein stilistisches Mittel, das zu erhalten der Übersetzers versuchen sollte. Der ZT wahrt zwar die inhaltliche Invarianz, aber ignoriert die formale Invarianz. Sie haben nicht einmal auf ihre Umgebung geachtet. Für sie gibt es keine Umgebung , wäre womöglich eine treffendere Übersetzung.
Están en la vía pública, pero en el tórrido Tucumán, en una siesta de verano, la vía pública es un rincón íntimo y solitario.
Sie stehen auf der öffentlichen Straße, aber an diesem glühendheißen Nachmittag in Tucumán ist die öffentliche Straße ein traulicher einsamer Winkel.
Die Satzstruktur des AT besteht aus zwei durch pero beigeordneten Hauptsätzen, deren letzterer des weiteren zwei adverbiale Bestimmungen – eine des Ortes und eine der Zeit enthält. Das Translat hat dabei die adverbialen Bestimmungen ineinander verschränkt – eine Option, die der deutschen Sprache möglich ist. Allerdings gibt der AT durch seine Untergliederung in separat stehende Satzteile einen etwas ruppigeren Stil wieder. Der ZT mutet dagegen sehr sanft an.
Schwierig ist die Übersetzung von vía pública . Eine wörtliche Übersetzung wie z.B. öffentliche Straße ist sehr ausgangssprachlich orientiert und entspricht im Deutschen dem Konzept einer “calle, plaza, camino u otro sitio por donde transita o circula el público”8 nicht so sehr. Im Deutschen gebräuchlichere Begriffe, die zu verwenden deshalb empfehlenswert wären, sind Gehweg oder auch Bürgersteig . Allerdings – und dies spricht gegen die Verwendung zuletzt benannter Begriffe – baut der spanische Text auf den Gegensatz zwischen vía pública mit rincón íntimo y solitario als stilistischem Mittel. Die Entscheidung für ein Übersetzungsergebnis hängt wieder einmal nicht nur von der inhaltlichen sondern auch von der formalen Invarianz ab.
iii) Francisco Ayala– Mímesis, némesis
Mímesis, némesis
Nachahmung und Vergeltung
Eine Richtlinie bei der Übersetzung ins Deutsche schreibt vor im Translat möglichst keine Fremdworte zu benutzen. Mimesis und Nemesis sind im Deutschen eher ungebräuchlich als im Spanischen. Nachahmung und Vergeltung stehen als ihre deutschen Entsprechungen. Aber hier ist es eine durchaus zulässige Übersetzung sie zu verwenden, denn die orthographische Ähnlichkeit als auch der Klang der beiden Begriffe scheinen doch auch hier eine Rolle zu spielen. Die entgültige Entscheidung muss zwischen der begriffsklärenden deutlicheren Übersetzung und einer stärker melopoetisch-orientierten Übersetzung wie Mimesis, Nemesis getroffen werden. Auch muss die Frage gestellt werden, inwiefern es wichtig sein könnte das Komma im Translat zu erhalten. Aus inhaltlicher Sicht macht es keinen Unterschied es als Komma oder als und zu übersetzen. Aus melopoetischer Sicht allerdings, scheint es mir sinnvoller das Komma dem und vorzuziehen.
iv) Francisco Ayala– Otro pájaro azul
casi gritaste corriendo hacia la ventana, llamándome a la ventana.
Du liefst zum Fenster und schriest beinahe, um mich herbeizurufen
Bei der spanisch-deutschen Übersetzung besteht die Herausforderung deutsche Entsprechungen für spanische Gerundien zu finden, da sie im Deutschen kaum mehr benutzt werden. Die Übersetzungsschwierigkeit entsteht daraus, dass sie mehrere Funktionen übernehmen können (wie z.B. Unterordnung kausaler, konditionaler, konsekutiver, temporaler und modaler Nebensätze und Beiordnung von zeitgleichen Handlungen) und somit je nach Syntax adäquate Übersetzungslösungen gefunden werden müssen.
In obigem Beispiel leiten beide Gerundien einen Temporalsatz ein: als/während du zum Fenster liefst und als/während du mich zum Fenster riefst . Zudem sind beide Temporalsätze einander beigeordnet und hängen von casi gritaste ab. Eine Übersetzung, die sich an der spanischen Syntax orientiert, könnte so aussehen: Beinahe schriest du, während du zum Fenster liefst und mich zum Fenster riefst . Die Option den zweiten Temporalsatz durch Auslassung der adverbialen Bestimmung des Ortes und Wahl des Verbs herbeirufen zu verkürzen, ist zu empfehlen.
Das vorliegende Translat ist an dieser Stelle nur darin zu kritisieren, dass es den zweiten Temporalsatz final versteht, was im Ausgangstext nicht intendiert ist. Allerdings entspricht die finale Übersetzung deutschen Konventionen und ist somit eine adäquate zieltextorientierte Variante.
“Esos pobres petirrojos se obstinan en cantar – había observado yo – . Por más que llueva y haga un viento frío, ellos cantan: reclaman la primavera prometida.
“Diese lieben Rotbrüstchen singen beharrlich weiter”, hatte ich bemerkt, “ auch wenn es noch so regnet und stürmt; sie singen einfach weiter und singen den versprochenen Frühling herbei“
Der ZT löst sich von der spanischen Syntax und verbindet den Konzessivsatz auch wenn es noch so regnet und stürmt mit dem ersten Satz. Allerdings weicht er damit die Verbindung der Konzession mit dem im AT dazugehörenden Hauptsatz auf. Es kann kaum von einer Missachtung der Invarianzregel die Rede sein, jedoch sind die logischen Bezüge in ihrer Übersetzung etwas verschoben und nicht mehr die selben wie im Ausgangstext.
Die Konzessivkonjunktion por más que gefolgt von Verben im Subjunktiv, drückt eine Hypothese, eine noch nicht erfüllte Aktion aus. Um die Hypothese deutlicher auszudrücken bietet sich die Übersetzung selbst wenn anstelle von auch wenn an.
Auch wenn sich haga un viento frío mit es stürmt adäquat übersetzen lässt, so ist es nicht weniger adäquat sondern zudem noch ausgangstextorientiert durch ein kalter Wind aufkommt zu übersetzen, um die besondere Bildhaftigkeit des AT zu erhalten.
Die Übersetzung von petirrojos mit dem niederdeutschen Rotbrüstchen anstelle des hochdeutschen Rotkehlchen , könnte darin begründet liegen, dass die Verfasserin des ZT aus der Schweiz stammt und dort vielleicht der niederdeutsche Begriff als Standardform gilt.
Der letzte Satz des Ausgangstextes reclaman la primavera prometida enthält eine stärkere aktive Forderung als das vorliegende Übersetzungsergebnis singen den versprochenen Frühling herbei . Ein Translat, das eines der folgenden Verben verwendet, würde stärker den Aspekt des Herbeiwünschens ausdrücken: verlangen , fordern , locken , begehren .
Y fue entonces cuando viste tú agitarse allá al fondo, grande, azul, en lo alto de una rama, a ese pájaro de belleza única, y me atrajiste a compartir tu admiración, tu júbilo.
Da erblicktest du in der Ferne etwas Großes, Blaues sich auf einem Ast hoch oben bewegen, den einzigartig schönen Vogel, und riefst mich herbei damit ich in deine Begeisterung, deinen Jubel mit einstimme.
Der Hauptsatz Y fue entonces des Ausgangstexts wird mit dem Demonstrativpronomen Da übersetzt. Bedenkt man die unterschiedlichen Erzählkonventionen der Ausgangs- und der Zielsprache, ist es ein adäquates und äquivalentes Translat. Dadurch, dass der Hauptsatz jedoch nicht in die Zielsprache übertragen wird, muss für die Übersetzung des nachfolgenden Nebensatzes eine angemessene Form gefunden werden. Dabei gibt es für den Übersetzer einige Möglichkeiten, die einzelnen Satzpartikel so anzuordnen, dass dabei der im Ausgangstext bestehende Sinnzusammenhang erhalten bleibt. Jedoch wäre es angemessen, die Stakkato-hafte Struktur der adverbialen Bestimmungen zu übernehmen, da in ihrer narrativen Struktur keine Beliebigkeit, sondern gewollte Struktur vorliegt: Aus dem Infinitiv agitarse , dem noch kein ihn näher bezeichnendes Substantiv vorausgegangen ist, erfährt der Leser, dass hier ein bisher unbezeichnetes Objekt eingeführt wird. Die folgenden adverbialen Bestimmungen folgen einer logischen Folge von Hindeutungen vom allgemeinen zum ganz spezifischen. Von allá über al fondo bis hin zu en lo alto de una rama wird der mögliche Aufenthaltsort dieses Etwas, das daraufhin benannt wird, konkretisiert.
Als problematisch erscheint mir die Übersetzung des Wortes agitarse . Es mit sich bewegen zu übersetzen, scheint im Deutschen das einzig mögliche zu sein, wobei allerdings agitarse ein weitaus größeres Bedeutungsspektrum enthält.
Möglicherweise führt nachfolgende Übersetzung zu einer adäquaten Textwirkung: Und es war dann, dass du dort im Hintergrund, groß, blau, auf einem hohen Ast, diesen Vogel von einzigartiger Schönheit sich bewegen sahst, und du riefst mich herbei deine Bewunderung, deinen Jubel zu teilen.
v) Camilo José Cela– Las parejas que bogan en el estanque del Retiro
No te distraigas, no vayamos a volcar.
Paßauf, sonst kentert (noch) das Boot.
Der ZT wendet mit Paßauf eine äquivalente und idiomatische Form an, um den Imperativ in ein heutiges Deutsch zu übertragen. Möchte man sich stärker an der Sprache der Zeit, in der diese Erzählung geschrieben wurde (späte 50er, frühe 60er Jahre) orientieren, so könnte man diesen Befehl in einer der spanischen Syntax näheren Form ausdrücken: Sei nicht so unachtsam oder besser Lenk dich nicht ab .
Da dieser Satz gleich dreimal im Text vorkommt, erscheint es mir wichtig, dass der Übersetzer die ausgangssprachliche Satzstruktur zu erhalten versucht, indem er auch den zweiten Imperativ als solchen übersetzt (z.B. lass uns nicht kentern oder auch bring uns nicht zum Kentern ) und zudem den zielsprachlichen Satz unverändert an allen drei Stellen benutzt.
Las parejas que bogan, amorosas y tiernas y pegajosillas, en el estanque del Retiro, son de varia edad, de distinto pelaje, incluso de inclinaciones diferentes.
Die Pärchen, die zärtlich verliebt aneinander geschmiegt auf dem Weiher des Retiro-Parks umherrudern, sind sehr unterschiedlich im Alter, im Aussehen, sogar in ihren Wünschen.
Die Übersetzungsmöglichkeiten sind hier stark beschränkt, da die im Ausgangstext vorliegenden Satzverschränkungen im Deutschen kaum nachempfunden werden können. So gehören Die Pärchen, die ... auf dem Weiher des Retiro-Parks umherrudern unmittelbar zueinander. Die Parenthese amorosas y tiernas y pegajosillas lässt sich im Deutschen kaum an einer anderen Stelle in den Satz einfügen und deshalb müssen diese Adjektive adverbial übersetzt werden.
Lo único que las unifica es el amor. Quizás, también la manera de expresar su amor.
Gemeinsam ist ihnen nur ihre Verliebtheit. Vielleicht auch die Art, sie in Worte zu fassen.
An dieser Stelle zeigt sich wie sich eine idiomatischere Übersetzung zu weit von dem Inhalt des Ausgangstextes entfernen kann. Das Translat vermittelt eher die Botschaft, dass die beiden Partner jeder für sich verliebt ist und dies der gemeinsame Nenner ist. Der intendierte Aspekt des durch Liebe Verbundenseins, der Vereinigung geht bei dieser Übersetzung verloren.
Im zweiten Satz zeigt sich ein Übersetzungsproblem darin, dass der Ausdruck expresar su amor viel umfassender ist als sie in Worte zu fassen . Es handelt sich sozusagen um eine Eins-zu-Teil-Übersetzung, die gegen die Textintention und damit gegen die Maxime der Invarianz wiederstößt.
Dahingegen ist es durchaus angemessen amor hier mit Verliebtheit und nicht mit Liebe zu übersetzen, da der Text eben auf die Wankelmütigkeit und Wechselhaftigkeit junger Leute abzielt.
Micaela está llena de pecas y no tiene demasiada salud.
Micaela hat Sommersprossen und ist nicht ganz gesund.
Die Aussage des beigeordneten Hauptsatzes scheint mir in der Übersetzung nicht korrekt wiedergegeben zu sein. Scheint No tiene demasiada salud entweder eine vorsichtige Bemerkung über eine kränkelnde Person oder eine Anspielung auf hypochondrisches Verhalten zu sein, so verleitet ist nicht ganz gesund zu einer Assoziation mit Geisteskrankheit oder Zurückgebliebenheit. Diese Konnotation sollte möglichst vermieden werden, da sie nicht intendiert ist.
vi) Rubén Darío– La resurrección de la rosa
Amiga Pasajera:
Freundin auf einen Augenblick!
Im Grunde ist dieser Text in seiner Komplexität seiner Bedeutungsmöglichkeiten so gut wie gar nicht ins Deutsche übertragbar. Eine Übersetzung wie reisende Freundin enthält nicht die Konnotationen von Flüchtigkeit und Vergänglichkeit, der Freundin auf einen Augenblick wiederum mangelt es an der Assoziation der Reisenden. Es ist nicht einmal klarzustellen, ob der Ausgangstext hierbei die eine oder die andere inhaltliche Variante bevorzugt. Auch ist es für die Textwirkung und den Kontext eigentlich nicht wichtig, in welche Richtung man diese Anrede übersetzt. Vielleicht jedoch enthält eine Übersetzung, wie Freundin Mitreisende , oder ein daraus abgeleitetes Verehrte Mitreisende , eine adäquate Textwirkung.
¡Imagínese usted si la vería como un tesoro, si la cuidaría con afecto, si sería para él adorable y valiosa la tierna y querida flor!
Stellen sie sich vor, was für einen Schatz er in ihr sah, mit wie viel Hingabe er die Kostbarkeit pflegte, wie er die zarte geliebte Blume verehrte!
In den drei durch si eingeleiteten Satzteilen sind zwei Aspekte von entscheidender Wichtigkeit. Erstens stehen die Verben im Konditional als Ausdruck dafür, dass die Rose von der hier die Rede ist, eigentlich nicht existiert. Im vorangehenden Satz ist die Rede davon, dass die Rose dem Herzen eines Mannes entsprossen sei. Da dies eher eine Metapher als pure Wirklichkeit sein kann, verwendet der AT das Konditional, um auf diese nicht wirkliche Existenz zu verweisen. Auch im Deutschen kann diesem Ausdruck entsprochen werden und durch Verwendung des Konditionals ausgedrückt werden.
Des weiteren ist es wichtig den inhaltlichen Ausdruck der Teilsätze zu erhalten. In der vorliegenden deutschen Übersetzung liegen allerdings einige Mängel vor. Der im ersten Teilsatz enthaltene Vergleich la vería como un tesoro erlebt durch die Übersetzung als was für einen Schatz er in ihr sah eine Bedeutungsveränderung. Der AT bietet lediglich einen Vergleich. Der ZT, dagegen, lässt die Assoziation zu, dass der Mann einen tatsächlichen, vielleicht sogar finanziellen Wert in der Blume sehe.
Im zweiten Teilsatz enthält der ZT zwei Besonderheiten. Indem sie anstelle des Personalpronomens das Substantiv die Kostbarkeit verwendet, hat die Übersetzerin einen Zusatz eingeführt, der zwar begründbar, aber nicht notwendig, geschweige denn angedacht ist. Des weiteren beinhaltet ihre Version des Satzes eine stärkere Betonung der Intensität der Hingabe als, wie es der AT intendiert, der Aktion des Pflegens.
Auch im dritten Teilsatz, liegt ein Fall von unterschiedlicher Bedeutungsintensität vor. Der ausgangstextliche Aspekt der zarten und geliebten Blume, die für ihn bezaubernd und kostbar wäre , wird seiner sanften Anspielung beraubt und wird dem Leser im ZT als Verehrung präsentiert. Obwohl zwischen diesen Varianten ein enger Bedeutungszusammenhang existiert, sollte der ZT versuchen, die Sanftmut and Vorsicht, die die erste Variante im Gegensatz zur Zweiten beinhaltet, auszudrücken.
vii) Jorge Dávila Vázquez– Logroño
Tres toques de la campana de la iglesia mayor, y todo aquel estupendo espejismo a veces lograba escaparse unos segundos del mundo de la fantasía [...].
Drei Glockenschläge der Hauptkirche – und schon entstieg vielleicht die schillernde Märchenwelt für einige Sekunden dem Reich der Phantasie [...].
Die Grundstimmung des ZT enthält eine Vagheit bezüglich der Existenz von Logroño. Diese Vagheit ist im AT nicht enthalten. Dafür arbeitet der AT mit einer gewissen Ironie, die durch die Verwendung des auf das Irreale verweisenden espejismo , in Kombination mit dem die reale Erscheinung bestätigende a veces lograba escaparse entsteht. Die Umsetzung dieser Ironie sehe ich in der vorliegenden Übersetzung nicht adäquat/angemessen vollzogen. An Stelle einer Übersetzung bietet der ZT hier eine lächerliche Variation des im AT vorliegenden Sinnzusammenhangs. Es mag in diesem Kontext möglich sein todo aquel estupendo espejismo durch schillernde Märchenwelt auszudrücken, allerdings erscheint mir diese deutsche Wendung hier zu verspielt, naiv und nicht einmal als Erscheinung, Fata Morgana oder sonstiger Halluzination rational erklärbar. Das spanische estupendo espejismo , dagegen, drückt zwar aus, dass es sich um ein Trugbild handelt, ist aber als solches feststellbar und erklärbar. Die Übersetzung von a veces mit vielleicht führt im ZT zu Verwirrung, da der Text nicht von einer möglichen Erscheinung Logroños spricht, sondern von tatsächlichen Begebenheiten.
Parece que cuando el presunto rompedor del hechizo descubría que el bejuco, la cuerda, la veta de los que se había aferrado en forma accidental, provocaban un sonido apocalípticamente fuerte - lo necesario como para echar por tierra una magia antigua y poderosa -, se apoderaba de él tan espantoso terror, que huía inmediatamente, ...
Es scheint allerdings möglich, den Zauber zu brechen, wenn ein zufälliger Reisender beim anfassen einer Liane, einer Ranke oder Schlingpflanze ungewollt ein so lautes unheimlich abgründiges hohles Dröhnen auslöst, dass der mächtige uralte Bann zunichte wird. Aber dann wird der Reisende von Entsetzen ergriffen und flieht augenblicklich, ...
Hier liegt der ZT in einer freieren Translation vor, die, bedingt durch eben diese Freiheit, einige Mängel aufweist. Es ist durchaus möglich einen spanischen Satz von solcher Länge im Deutschen in zwei Sätze aufzuteilen. Dabei sollten allerdings die Bezüge der Satzteile zueinander erhalten bleiben. Die vorliegende Übersetzung widersetzt sich hier nicht nur den Regeln der syntaktischen Vorgabe sondern variiert auch auf der Invarianz– Ebene. So wird dem presunto rompedor del hechizo ein zufälliger Reisender gleichgesetzt. Die Beschreibung des apokalyptischen Geräusches wird seines wesentlichsten Bestandteiles, des lo necesario como para echar por tiera una magia antigua y poderosa beraubt. Der Bann, mit den zwei der Parenthese als brauchbar entnommen Adjektiven mächtig und uralt versehen, wird im ZT gebrochen, wobei im AT nur von einem möglichen Ablauf des Bannbruches die Rede ist, worauf die Verwendung des Konditionals und des Wortes presunto verweisen.
Ha pasado esto ya tantas veces, finalizaba la tía en tono de queja, que cada vez que alquien ve a Logroño es más fantasmal, más desvaída, y pronto nadie verá la ciudad encantada.
“Das hat sich schon einige Male ereignet”, schloßdie Tante mit klagender Stimme, “daßLogroño bei jedem Auftauchen gespenstischer und verschwommener wirkt, und bald wird wohl niemand mehr die verwunschene Stadt sehen können.
Die Syntax erfährt bei der Übersetzung eine kleine, aber sinnverändernde Umstrukturierung. Dadurch, dass die Konsekutivkonjunktion tantas veces ... que im ZT nicht als solche in der von Form von so oft, dass , sondern mit dem die Konsekutivfunktion nicht beinhaltenden einige Male übersetzt wird, entsteht ein Problem in der logischen Anknüpfung der Folgebedingung. Das langsame Verblassen Logroños ist im AT durch die Häufigkeit seines Erscheinens bedingt. Im ZT ist eben diese Häufigkeit nur noch als Randbemerkung zu verstehen. Der betonte Bestandteil der Information ist hier der verschwommene Zustand Logroños beim Auftauchen. Unterstützt wird diese Textwirkung auch durch die Übersetzung von cada vez que alguien ve a Logroño durch bei jedem Auftauchen . Hier wird die Perspektive, die im AT durch alguien ve personenbezogen ist, als von einem subjektiven Erleben unabhängig präsentiert.
viii) Miguel Hernández– Chiquilla, popular
Le pregunto a la pobre chiquilla pobre, de sonrisa anochecida por una mella y su madre, aunque más por el estío y la penumbra de cortinas de mi casa, quién es su padre.
Als ich das nette arme Mädchen frage, wer sein Vater sei, verfinstert sich sein Lächeln durch eine Zahnlücke und durch seine Mutter, aber noch mehr durch das sommerliche Halbdunkel hinter den Vorhängen in meinem Haus.
Der ZT hat eine Umsetzung der ausgangstextlichen Satzstruktur gewählt, die in einer konventionellen deutschen Syntax resultiert. Ein Grund für diese Translation, liegt in der nicht eins-zu-eins übernehmbaren Form des de sonrisa anochecida ... . Bei dieser Wendung handelt es sich um eine Form des Genitivs, der im Spanischen eine Qualität oder eine Materie angibt und dadurch eine nähere Bestimmung bildet. Um eine deutsche Ausdrucksform für diesen Umstand zu finden, muss man sich entweder eines relativischen Satzanschlusses (...das Mädchen, dessen Lächeln ... )oder der hier vorliegenden Syntaxumstellung bedienen.
Das Adjektiv pobre enthält einige Bedeutungen, bei denen man überlegen muss, wie man sie in dieser Doppelerscheinung dem Kontext angemessen übersetzen kann. So bezeichnet [ chiquilla ] pobre das arme [ Mädchen ]. Bei der Bedeutungsfindung des pobre [ chiquilla pobre ] muss man überlegen, welche Möglichkeit dem Kontext am ehesten entspricht. Die Bedeutung nett ist dabei durchaus möglich, wenn auch weniger wahrscheinlich als klein .
Die Verwendung des Begriffes sommerliches Halbdunkel ist etwas befremdlich, da sich der Leser erst einmal diesen Ausdruck begreiflich machen muss. Der AT, dagegen, leitet den Leser beim Textverstehen stärker an, indem er ihm erst das Bild des Sommers (estío ) präsentiert, das er danach relativiert und auf die, von den Gardinen hervorgerufenen, Verdunkelung des Raumes fokussiert. In der vorliegenden Übersetzung bringt die Betonung des hinter den Vorhängen den Leser ins Stocken. Weder enthält der AT diese Bestärkung, noch enthält sie im ZT eine zusätzliche kontextklärende Information. Im AT ist die Bedeutung des hinter implizit durch die Genitive de cortinas und de mi casa eindeutig geklärt.
Allerdings findet der ZT, trotz der benannten Schwierigkeiten, eine plausible deutsche Syntax, um den Inhalt möglichst invariant zu halten.
Y me responde, enseñando su lengua como una vergüenza larga, los ojos atropellados, sobre la voz caída:
Als Antwort streckt es seine Zunge in voller schamloser Länge heraus und antwortet mit rollenden Augen.
Die ausgangstextliche Syntax bestehet aus einem Hauptsatz (Y me responde ... sobre la voz caída ), einem über ein Gerundium angeschlossenen infiniten Nebensatz (enseñando su lengua como una vergüenza larga ) und einem weiteren Einschub (los ojos atropellados ). Bei der Übersetzung sollte darauf geachtet werden, dass diese syntaktischen Einheiten auf semantischer Ebene invariant bleiben.
Es erscheint mir idiomatischer, ojos atropellados besser mit verdrehten Augen als mit rollenden Augen zu übersetzen. Dadurch wird der implizierte sexuell-assoziative Aspekt im Deutschen beibehalten. Auch kann man den Ausdruck vergüenza larga mit seiner sexuellen Konnotation verstehen. Um diese Assoziation auch in der ZS hervorzurufen, sollte eine andere Möglichkeit der Übersetzung angestrebt werden. Auch glaube ich, dass die voz caída durchaus von erotischer Spannung umgeben ist, allerdings kann ich der vorliegenden Übersetzung nur beipflichten, die für eben benannten Ausdruck keine Entsprechung angibt.
In Bezug auf die Umsetzung der Satzstruktur lässt sich feststellen, dass die getroffene Lösung als angemessen einzustufen ist.
Creo que uno, hombre rico, que tiene una fábrica de telas donde mi madre dice que trabajaré, en seguida que sea grande.
“Ich glaube, es ist ein – ein reicher Mann, der eine Textilfabrik hat, und dort, sagt meine Mutter, werde ich einmal arbeiten, wenn ich großbin.”
Man kann hombre rico im AT sowohl als Anrede des Gesprächspartners, als auch – in Form einer Apposition – als Beschreibung der thematisierten Vaterfigur verstehen. Der Text spielt durchaus mit dieser Ambivalenz der Aussage des Mädchens; die Möglichkeit, dass der Gesprächspartner des Mädchens auch durchaus sein Vater sein kann wird hier dadurch angedeutet, dass nicht nur der Vater des Mädchens ein reicher Mann ist (uno ... que tiene una fábrica ), sondern eben auch der Anwesende (hombre rico ). Der ZT klärt allerdings diese Doppeldeutigkeit auf. Die Bedeutung ist hier klar auf den nicht anwesenden, nicht bekannten Vater gelegt. Indem man sich stärker an die ausgangstextliche Syntax hält, kann man hier die Ambivalenz der Aussage beibehalten: Ich glaube, es ist einer, reicher Mann, der eine Textilfabrik hat .
Die Übersetzung des relativisch angeschlossenen Satzes als beigeordneten Hauptsatz ist eine angemessene mögliche Form, die auf der Erzählkonvention des Deutschen aufbaut, die die Verschachtelung mehrerer bei- oder untergeordneter Sätze eher ablehnt als das Spanische. Im Vergleich zu dem deutschem wenn ich großbin – das eher von einem irgendwann als von einem spezifischen Zeitpunkt spricht –, erscheint mir die Bedeutung des en seguida que sea grande prompter und dadurch verpflichtender, als existiere eine Vereinbarung, die keine andere Zukunft für das Mädchen zulässt.
Y un dedo suyo, con la uña pastada constantemente por el rebaño tierno de su dentadura, indaga y delata miseria jugando nervioso en ¡cuántos! rotos y remiendos de su bata, breve por necesidad.
Ein schwarzer Fingernagel fährt erst unausgesetzt über die zarte Reihe der Milchzähne und bohrt dann nervös spielend in den – ach, wie vielen! – Rissen und Flicken seines aus Not zu kurzen Schürzenkleidchens, Elend verratend.
Bei der Betrachtung der Satzstrukturen des AT und des ZT lassen sich geringe Analogien und dafür umso mehr Unterschiede feststellen, die zumeist auf Kosten der Informationsvermittlung gehen. Die im ausgangssprachlichen Hauptsatz vermittelte Informationen (y un dedo suyo [...] indaga y delata miseria ) lassen sich im ZT nicht deutlich auffinden. Der ZT nimmt die Verbaufzählung indaga y delata auseinander. Obwohl beide Verben sich auf miseria beziehen, arrangiert der ZT die Bezüge neu. Der Neubezug des ersten Verbs, nun auf Rissen und Flecken , ist nachvollziehbar, aber nicht notwendig für das Textverständnis. Im Falle des zweiten Verbs behält der ZT den Bezug zwischen delata und miseria , präsentiert diesen dann aber als Gerundiumskonstruktion.
Der ZT trifft keine Unterscheidung zwischen Finger und Fingernagel, sondern lässt die ganze Handlung vom Fingernagel vollzogen werden. Der Zusatz, dass der Fingernagel schwarz sei, lässt sich dadurch begründen, dass somit das Elend und die Not (und somit der Schmutz, der damit verknüpft sein kann) ausgedrückt werden soll. Allerdings findet sich dafür im AT kein Hinweis. Dieser Zusatz ist somit nicht invariant, sondern interpretierend.
Der AT gibt durch die Verwendung des Präsens und des Partizip Perfekt an, dass zwei Handlungszeiten vorliegen. Das Präsens beschreibt die Handlungsebene, in der das Mädchen nervös mit einem Finger die Risse und Flicken ihres Kleidchens betastet. Das Partizip pastada indiziert Vorzeitigkeit dazu. Die Zustandsbeschreibung des Fingernagels, der - wie es die Metapher pastada constantamente por el rebaño tierno de su dentadura beschreibt - abgeknabbert zu sein scheint, liegt somit in einer vorangegangenen Erzählzeit, die außerhalb der Erzählzeit der gesamten Geschichte liegt. Der ZT interpretiert diese beiden Handlungszeiten als direkt aufeinander folgend, obwohl der AT keine Andeutung dafür bietet. Deswegen wird die Abfolge der Handlungen durch erst und dann kenntlich gemacht.
Allerdings interpretiert der ZT oben angeführte Metapher nicht in ihrem eigentlichen Sinne. Nicht nur, dass der Nagel, der ständig von der sanften Herde ihres Gebisses abgeweidet wurde in nicht einmal einer ähnlichen Metapher vermittelt wird, auch wird dieses Bild in seiner Botschaft verzerrt: wird im AT der Nagel von den Zähnen angeknabbert, so fährt er im ZT nur noch über die Zahnreihen.
IV) Abschlussbemerkung
Diese Analyse zeigt exemplarisch auf, wie wichtig es ist, einzelne Textstellen im Textzusammenhang zu betrachten. Ohne die kontextuelle Umgebung kann man sich nicht über die Eindeutigkeit (oder gewollte Mehrdeutigkeit) der Textaussage klar werden. Es wäre es unmöglich, eine Eindeutigkeit (oder auch Mehrdeutigkeit) für das zu übersetzende Invariante zu finden.
Ist es oftmals möglich, wenn auch fast nie unproblematisch, sich von der syntaktischen Gliederung des AT zu lösen, so sieht es auf der semantischen Ebene durchaus problembehafteter aus. In der spanisch-deutschen Übersetzung ist der Anteil der Eins-zu-eins übersetzbaren Begriffe sehr gering. Dies ist ein relativ kleines Problem, wenn es sich um die Translation einzelner Worte oder einfachster – Subjekt-Prädikat-Objekt – Sätze handelt.
Möglichst alle Aspekte des AT in den ZT zu übertragen, gestaltet sich um so schwieriger je komplexer die AT-Syntax, je größer die Anzahl der zu übersetzenden Worte und daraus folgernd die klanglichen oder orthografischen Gegensätze und Ähnlichkeiten zwischen eben diesen. Hierbei sei besonders auf die Wichtigkeit der Wortfeldanalyse verwiesen, die eben solche semantischen Zusammenhänge und gegenseitigen Bewirkungen aufdeckt, die zu einem großen Anteil die Textwirkung ausmachen.
Zum Schluss bleibt die Erkenntnis bestehen, dass eine „wahre“ Übersetzung im Grunde nicht möglich ist. Es lassen sich nie alle Aspekte und die gesamte Wirkung eines Textes einfangen und in einen anderssprachlichen Text bannen. Die Translation ist prinzipiell schwierig, aber potenziell möglich.
Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
Brandenberger, Erna (Hg): Cuentos brevísimos. Spanische Kürzestgeschichten. München: Deutscher Taschen Verlag, 2000 (4. Auflage), S. 8/9 (Ciro Alegría – Leyenda de Tungurbao), S. 12/13 (Enrique Anderson Imbert – Siesta), S. 24/25 (Francisco Ayala – Mímesis, némesis), S. 24/25 (Francisco Ayala – Otro pájaro azul), S. 38/39 (Camilo José Cela – Las parejas que bogan en el estanque del Retiro), S. 52/53 (Rubén Darío – La resurrección de la rosa), S. 54/55 (Jorge Dávila Vázquez – Logroño), S. 70/71 (Miguel Hernández – Chiquilla, popular)
Definitionswörterbücher:
Bünting, Karl-Dieter (Hg): Deutsches Wörterbuch. Chur: Isis Verlag, 1996
Real Academía Española: Diccionario de la lengua española. Madrid: Editorial Espasa Calpe, 2000 (20. Auflage)
Äquivalenzwörterbuch:
PONS: Großwörterbuch für Universität und Experten Spanisch. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 2001
Grammatik:
González Hermoso, A. (u.a.): Gramática de español lengua extranjera. Madrid: Edelsa: 2000 (7. Auflage)
Sekundärliteratur:
Knauer, Gabriele: Grundkurs Übersetzungswissenschaft Französisch. Stuttgart: Ernst Klett Verlag: 1998
Snell-Hornby, Mary (u.a.): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg-Verlag: 1998
[...]
1 Im folgenden, verwende ich die Abkürzungen AS und ZS für die Begriffe Ausgangssprache bzw. Zielsprache. Analog dazu bezeichnen AT und ZT Ausgangstext und Zieltext. Vergleiche dazu: Snell-Hornby, Mary (u.a.): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg-Verlag: 1998, S. 105
2 Snell-Hornby, Mary (u.a.), S.94
3 Knauer, Gabriele: Grundkurs Übersetzungswissenschaft Französisch. Stuttgart: Ernst Klett Verlag: 1998, S.15
4 Snell-Hornby, Mary (u.a.), S.49
5 Snell-Hornby, Mary (u.a.), S.67
6 Knauer, Gabriele, S.132
7 Ich betone hier die Wichtigkeit diesen Aspekt zu übersetzen, da es die besondere Motivation des Pärchens sich der Mittagshitze auszuliefern, um beieinander sein zu können, betont.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Analyse ausgewählter Kurzgeschichten?
Diese Arbeit analysiert translationsproblematische Textstellen in acht spanischen Kurzgeschichten und deren deutschen Übersetzungen, um Gründe für die vorliegenden Übersetzungen zu identifizieren. Der Fokus liegt auf spezifischen Passagen, die als schwierig zu übersetzen eingestuft wurden, anstatt ein umfassendes Übersetzerprofil zu erstellen.
Wie wurden die zu analysierenden Textstellen ausgewählt?
Die Auswahl der Textstellen erfolgte nach der ersten Lektüre der Originaltexte. Passagen, die als potentiell schwierig zu übersetzen eingeschätzt wurden, wurden mit ihren entsprechenden Übersetzungen verglichen. Nach Analyse der syntaktischen und semantischen Merkmale des Ausgangstextes folgte eine kritische Betrachtung der Übersetzung.
Welche translationswissenschaftlichen Begriffe werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die Begriffe Invarianz, Äquivalenz und Adäquatheit, um die Beziehungen zwischen Ausgangstext (AT) und Zieltext (ZT) zu beschreiben. Invarianz bezieht sich auf das Gleichbleiben dessen, was nicht verändert werden soll, Äquivalenz auf die Erhaltung der Textfunktion unter Berücksichtigung kultureller Konventionen, und Adäquatheit betont den Zweck der Translation.
Was sind typische Translationsprobleme?
Translationsprobleme entstehen durch Kulturunterschiede (Kultureme), lexikalische Inkongruenzen und sprachpaarspezifische Unterschiede. Die Arbeit betont, dass eine Übersetzung immer eine Interpretation ist und dass es keine objektive Übersetzung geben kann, sondern nur eine, die alle Aspekte des Textes berücksichtigt.
Welche Übersetzungsrichtlinien werden diskutiert?
Die Arbeit verwendet den Begriff der Korrespondenzregeln (grammatikalische Zusammenhänge zwischen AS und ZS) und Präferenzregeln (Weisungen für Textsorten und Textfunktionen) um translatorische Aspekte zu beleuchten. Außerdem wird der Begriff der Erzählkonventionen genutzt, um auf Probleme hinzuweisen, die durch kulturelle und sprachliche Unterschiede bedingt sind.
Wie sieht eine gerechte Translationskritik aus?
Eine gerechte Translationskritik berücksichtigt den Skopos (Zweck) und den Übersetzungsauftrag (prozessorientiert) sowie die semantische Äquivalenz, lexikalische Adäquatheit und grammatische Korrektheit (produktorientiert). Eine Aspektmatrix kann als Instrument verwendet werden, um verschiedene Aspekte des AT-ZT-Vergleichs zu beleuchten.
Welche Kurzgeschichten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert folgende Kurzgeschichten: Ciro Alegría – Leyenda de Tungurbao, Enrique Anderson Imbert – Siesta, Francisco Ayala – Mímesis, némesis, Francisco Ayala – Otro pájaro azul, Camilo José Cela – Las parejas que bogan en el estanque del Retiro, Rubén Darío – La resurrección de la rosa, Jorge Dávila Vázquez – Logroño, Miguel Hernández – Chiquilla, popular.
Was ist das Fazit der Analyse?
Die Analyse zeigt, dass eine kontextuelle Betrachtung einzelner Textstellen entscheidend ist, um die Eindeutigkeit (oder gewollte Mehrdeutigkeit) der Textaussage zu verstehen. Eine "wahre" Übersetzung ist nicht möglich, da sich nie alle Aspekte und die gesamte Wirkung eines Textes einfangen lassen. Die Translation ist prinzipiell schwierig, aber potenziell möglich.
Welche Literatur wird verwendet?
Es werden sowohl Primärliteratur (die analysierten Kurzgeschichten), Definitionswörterbücher, ein Äquivalenzwörterbuch (PONS) und eine Grammatik (González Hermoso) als auch Sekundärliteratur (Knauer, Snell-Hornby) verwendet.
- Quote paper
- Steffen Buch (Author), 2001, Übersetzungsanalyse ausgewählter Kurzgeschichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107765