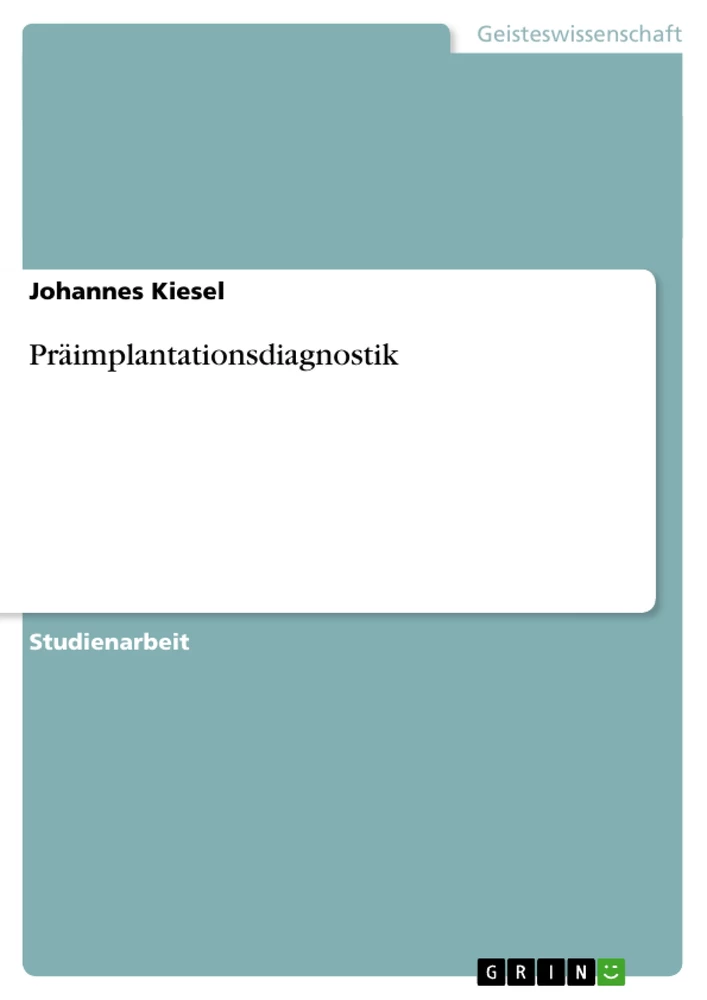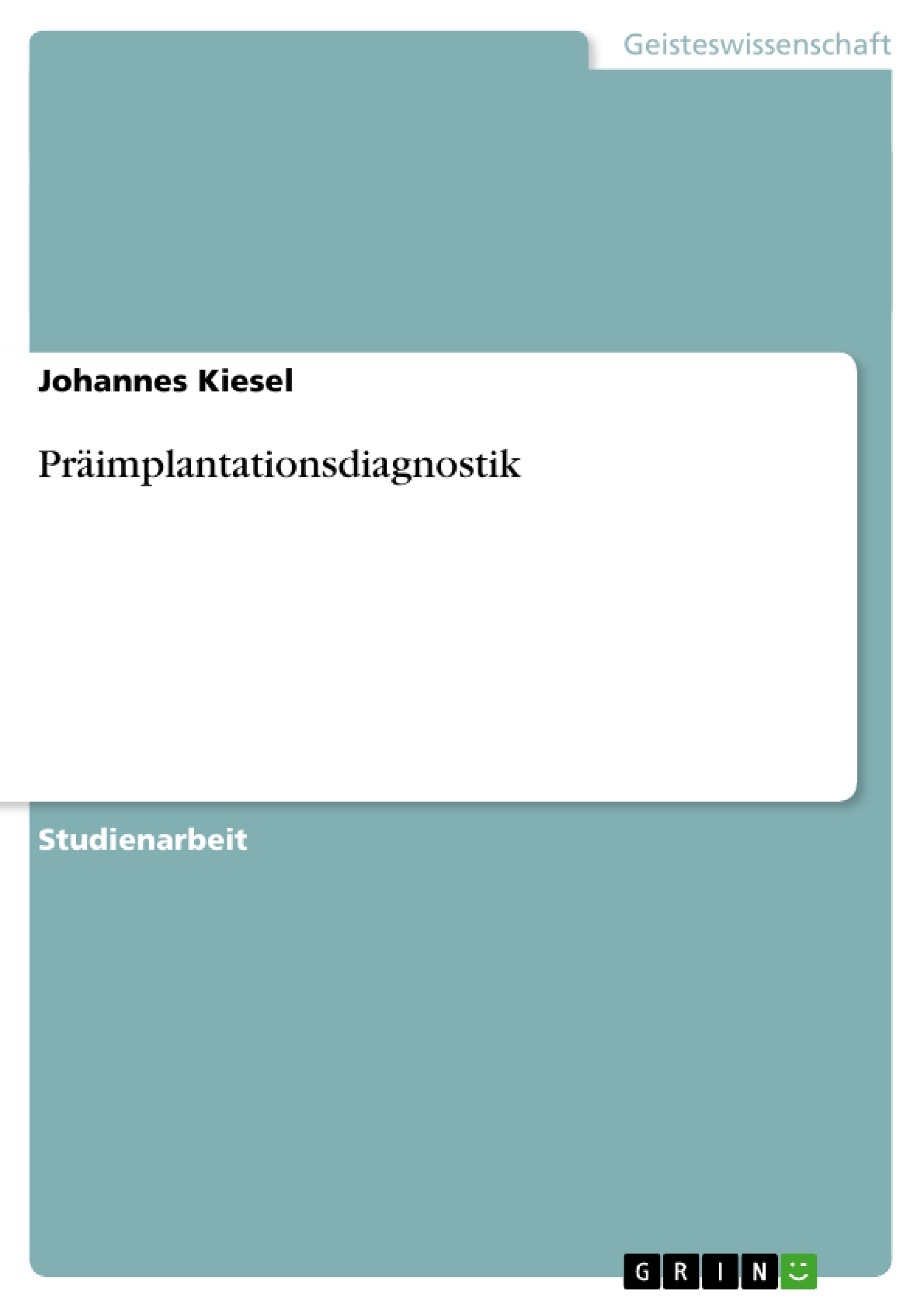Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Methode der PID und ihre Problematik
III. Die PID aus verschiedenen Blickwinkeln
1. Die PID aus juristischer Sicht
2. Die PID aus ethischer Sicht
3. Die PID aus Sicht der Religionen
4. Soziologische Betrachtung
5. Die PID und Behinderte in der Gesellschaft
6. Historische Betrachtung
7. Daten Fakten und Erfahrungen durchgeführter PIDs
IV. Fazit
I. Einleitung
J. D. Watson hat Anfang der 50er Jahre die DNS-Struktur in der Zelle entdeckt. Auf ihr ist die Erbinformation gespeichert, der Bauplan eines Lebewesens festgeschrieben. Seitdem hat ihre Erforschung eine rasante Entwicklung genommen. Im Zuge des Human Genom Projekts wurde die gesamte menschliche DNS entschlüsselt. Pflanzen können genetisch verändert und somit ihre Eigenschaften beeinflusst werden. Britischen Wissenschaftler ist es sogar gelungen, ein Schaf zu klonen; es entstand das berühmte Klonschaf Dolly.
Es liegt nahe, diese Technologie auch beim Menschen anzuwenden. Was kann man sich daraus erhoffen? Schwere Krankheiten wie Krebs, Alzheimer oder Parkinson könnte man besiegen oder menschliche Organe zur Transplantation in der Petrischale züchten.
Der Weg bis dahin ist aber noch weit, ein enormer Forschungsbedarf noch vorhanden. Ob sich die gewünschten Erfolge realisieren lassen ist nicht garantiert. Die Forschung an menschlichem Leben ist sehr umstritten. Besonders die Untersuchung, Veränderung und Vernichtung von embry- onalen Stammzellen steht in der Kritik. Sie ist in Deutschland verboten. Dem Wunsch, das Leben zu verbessern, es krankheitsfrei und glücklicher zu machen und eventuell die menschlichen Eigenschaften zu verbessern stehen Ängste vor Menschenzüchtung, einem Menschen nach Maß, der Anmaßung Gott zu spielen und einem Ende der Freiheit gegenüber. Diese Vorstellungen spalten die Gesellschaft quer durch alle Lebensbereiche. Die einen träumen von einem weiteren großen Schritt der Evolution, in dem sich der Mensch selbst zielgerichtet und schell verbessert, während die anderen vor einer unkontrollierbaren Großtechnologie warnen und wohl Huxleys „Schöne Neue Welt“ vor Augen haben.
Die Präimplantationsdiagnostik (PID) wird im Unterschied zu den oben genannten Verfahren bereits angewendet. Sie ist sehr umstritten, weil embryonale Stammzellen zu Diagnosezwecken vernichtet werden. In Deutschland ist sie verboten. In England, Belgien, den USA und Australien ist sie erlaubt und erste Erfahrungen liegen vor.
II. Methode der PID und ihre Problematik
Mit der PID werden Embryonen auf genetisch bedingte Erbkrankheiten untersucht. Die Voraussetzung für ihre Durchführung ist die In-Vitro- Fertilisation (künstliche Befruchtung), da die PID nur in der Petrischale , also nicht im Mutterleib, angewendet werden kann. Dem Embryo werden gewöhnlich am dritten Tag nach der Befruchtung 1 - 2 Zellen entnommen. Der Embryo befindet sich dabei im 4-8-Zellstadium. Es wird davon ausgegangen, dass sich in diesem Stadium noch jede Zelle zu einem Embryo und damit vollständigen Menschen entwickeln kann. Diese Zellen nennt man totipotent, ihre Entnahme heißt Blastomerbiopsie.
Bei mehr als 8 Zellen (5. bis 6. Befruchtungstag) ist der Embryo im Blastozystenstadium. Die entnommenen Zellen sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht mehr totipotent. Diese Methode wäre in Deutschland nicht durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Ob diese Methode tatsächlich anwendbar ist, ist nicht vollständig geklärt.
Die entnommen Zellen werden im Labor auf genetische Fehler untersucht. Dazu stehen zwei Diagnoseverfahren zur Verfügung: Zum einen gibt es die molekulargenetische Diagnostik mit Hilfe der Polymerase Kettenreaktion (PCR) und zum anderen die Chromosomendiagnostik mit der Flourescence in situ hybridisation (FISH).
Mit der PID kann man das Geschlecht des Embryos feststellen, sowie Chromosomentranslokationen, also falsch zusammengesetzte Chromosomen, finden. Besonders wichtig ist die Möglichkeit, Krankheiten zu identifizieren, die auf einzelne Gendefekte zurückzuführen sind. Momentan lassen sich auf diese Weise das Down-Syndrom, die Bluterkrankheit, Mukoviszidose, Chorea Huntington, zystische Fibrose und Thalassämien erkennen.
Da die Durchführung der Untersuchung bei diesen Methoden nur wenige Stunden dauert, kann ein gesund diagnostizierter Embryo in den Uterus der Frau transferiert werden.
Im folgenden betrachte ich mit Präimplantationsdiagnostik (PID) die Entnahme und verbrauchende Untersuchung totipotenter Embryozellen. Die Untersuchung nicht-totipotenter Embryonenzellen ist in den meisten Bundesländern verboten, es gelten jedoch Ausnahmeregelungen.
Dem öffentlichen Diskurs um die PID kann man folgende Fragestellungen entnehmen:
1. Darf an embryonalen Frühformen eine verbrauchende Mani- pulation durchgeführt werden? Verbrauchend heißt hier Tötung von Embryonen.
2. Wie rechtfertigt sich die Selektion eines genetisch unauffälligen Embryos zur Einpflanzung in den Uterus?
3. Bedeutet die Entscheidung für ein „gesundes“ Kind eine Diskriminierung von behinderten Menschen?
4. Gibt es einen Dammbruch, wenn die durch den § 1 des Grund- gesetzes geschützte Menschenwürde von den Eigenschaften des menschlichen Lebewesens abhängig gemacht wird? Solche Eigen- schaften sind z.B. Alter, Entwicklungsstadium oder die Fähigkeit zur Selbstachtung. Mit Dammbruch ist das vollständige Wegfallen eines Tabus gemeint, hier der Schutz der Menschenwürde, wenn Ausnahmen gewährt werden.
5. Besteht die Dammbruchgefahr, dass die PID nicht nur dazu verwendet wird, schwere Erbkrankheiten zu vermeiden, sondern auch nach anderen Kriterien selektiert wird? Gibt es dann einen „Menschen nach Maß“ mit allen gesellschaftlichen Folgen?
Auf all diese Fragen haben Bundespräsident Johannes Rau und andere bedeutende Persönlichkeiten geantwortet. Oft wird dabei jedoch nicht klar, ob es sich um ein juristisches, ethisches, religiöses, zweckrationales oder wirtschaftliches Argument handelt und wer eigentlich angesprochen wird. Jeder oder nur Juristen, Ärzte, Gläubige einer bestimmten Konfession oder Betroffene?
Deshalb möchte ich die fünf oben genannten Fragestellungen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und deren Argumentation darstellen. Angesprochen ist der einzelne Mensch, welche Funktion er auch immer in der Gesellschaft hat.
III. Die PID aus verschiedenen Blickwinkeln
1. Die PID aus juristischer Sicht:
Die Aufgabe des Rechts ist in erster Linie Rechtsfrieden zu schaffen. Darüber hinaus sind im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ethische Grundwerte unserer Gesellschaft verankert. Derzeit stellt sich die rechtliche Situation für die PID wie folgt dar:
Nach dem Embryonenschutzgesetz EschG vom 13. Dezember 1990 ist eine befruchtete Eizelle bereits ein Embryo und ebenso jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle (§ 8 (1) EschG). Nach § 2 (1) EschG darf ein Embryo und somit auch eine den Embryo entnommene totipotente Zelle nicht für eine genetische Untersuchung verwendet werden. Die PID ist damit in Deutschland verboten.
Da der Beginn des menschlichen Lebens vom Bundesverfassungsgericht auf die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle gelegt wurde, ist diese und auch alle folgenden Entwicklungsstadien nach §1 des Grundgesetzes geschützt. Nach §1 GG ist die Würde des Menschen unantastbar. Die PID steht also im Widerspruch mit §1 GG, dem wichtigsten Pfeiler unserer Verfassung.
Gesteht man dem Embryo erst ab einer bestimmten Zeit nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle Menschenwürde zu, könnte die PID rechtlich legitimiert werden. Gründet die Würdigkeit eines Menschen auf die Fähigkeit zur Freiheit sittlicher Entscheidung1 bzw. auf die Fähigkeit zur Selbstachtung2, hätte der Embryo im 4-8 Zellstadium diese nicht. Die PID wäre dann nach §1 GG möglich. Der §1 GG bietet menschlichem Leben absoluten Schutz. Durch kein anderes Gesetz darf dieser beschränkt werden.
Der §2 (1) GG beinhaltet das Recht eines jeden auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Allerdings nur, wenn er nicht die Rechte anderer verletzt. Die Eltern, die gerne die PID anwenden würden, kollidieren nach momentanem Recht mit den Rechten des Embryos. Der Embryo wird neben dem EschG und dem §1 GG auch von §2 (2) GG geschützt. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit des §2 (2) GG kann durch ein Gesetz eingeschränkt werden. Um Embryonen zu töten, müsste ihnen allerdings der Status der Person abgesprochen werden. Befürworter der PID weisen jedoch darauf hin, dass die gängige Praxis in Deutschland anders aussieht: Der §218a StGB regelt unter welchen Um-ständen ein Schwangerschaftsabbruch straffrei ist. Absatz (1) gestattet die Abtreibung durch einen Arzt, wenn die Schwangere abtreiben will und sich nach §219 Abs. 2 Satz 2 StGB hat beraten lassen (Beratungsschein). Außerdem dürfen seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen sein. In §218a (2) StGB ist die Straflosigkeit der Abtreibung garantiert, wenn ein Arzt einer Frau, die abtreiben will, attestiert, dass durch das Austragen und Versorgen des Kindes eine schwerwiegende Beeinträchtigung ihres körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes zu befürchten ist und die Gefahr nicht auf andere Weise abgewendet werden kann. Diese Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs werden in Deutschland häufig genutzt. Die Straffreiheit der Abtreibung heißt nicht, dass sie erlaubt ist. Sie verstößt nach wie vor gegen §1 GG und §2 GG. In der Praxis existiert dieser absolute Lebensschutz aber nicht mehr. Der §218 StGB wurde eingeführt aus der Erkenntnis, dass Schwangere und werdendes Kind eine Einheit bilden, das heißt, der Embryo nicht gegen den Willen der Mutter geschützt werden kann. Befürworter der PID betonen, dass der absolute Lebensschutz durch die Anwendung des §218 StGB unterwandert ist und deshalb das Verwerfen der Embryonen im 8-Zellstadium ebenfalls gestattet sein müsste. Vielleicht ist dies eine verbreitete Auffassung in Teilen unserer Gesellschaft, juristisch ist diese Forderung jedoch nicht haltbar: Dem Schwangerschaftsabbruch muss nach §218a StGB eine Notlage der Schwangeren vorausgehen. Das Lebensrecht des Embryos steht dann gegen das Wohlbefinden der Mutter. Hier hat der Gesetzgeber die Straffreiheit bei der Entscheidung gegen das Lebensrecht des Kindes gegeben. Bei einem Paar, das genetisch durch eine Erbkrankheit belastet ist und sich ein Kind wünscht, ist diese Notlage juristisch nicht gegeben.
2. Die PID aus ethischer Sicht
Die Ethik soll Autonomie und Glück im Leben des einzelnen gewährleisten. Der voll entwickelte Mensch ist sowohl moralisches Objekt wie Subjekt in der Ethik. Er muss seine moralischen Entscheidungen treffen und dabei bedenken, dass auch andere davon betroffen sind. Menschen, die nicht fähig sind zu handeln oder nicht einmal ihre Wünsche mitteilen können, müssen in der Ethik besonders geachtet werden. Ihnen werden sogenannte
„wohlverstandene Interessen“ zugeschrieben, von denen man nach allgemeiner Lebenserfahrung annimmt, dass sie im Wunsche der jeweiligen Person sind. Das sind z.B. Alte oder Kranke, die nicht mehr selbst entscheiden können, geistig Behinderte oder Babys und Kleinkinder.
Eine Ethik gründet sich immer auf bestimmte menschliche Qualitäten. Diese stellen die Bedingung für Moralität dar. „Deshalb impliziert die Rede von der Würde des Menschen im ethischen Sinne stets, dass der Mensch Interessen ausbilden, in gewissen Umfang frei (also nach Argumenten) entscheiden kann und der Lebensplanung fähig ist (wie bescheiden auch immer). Die Würde eines Menschen achtet man, indem man diese menschlichen Fähigkeiten in ihren konkreten wie potentiellen Ausprägungen respektiert und ihn insbesondere nicht zu bestimmten Zwecken ins- trumentalisiert;“3
Die Ethik macht Aussagen darüber, wie sich Personen moralisch richtig verhalten, aber nur sich selbst und anderen Personen gegenüber. Der Embryo müsste also wenigstes einige Eigenschaften von Personen besitzen, die ethisches Handeln rechtfertigen. Um den Embryo zu schützen muss eine moralische Ununterscheidbarkeit von einer Person und einem Embryo ge- funden werden.
Aus philosophischer Sicht werden in der Diskussion vier prinzipielle Argumente gebraucht: Die Spezieszugehörigkeit, das Identitäts-, Potentialitäts- und Kontinuitätsargument
Die Argumentation um die Spezieszugehörigkeit besagt, dass der Embryo den gleichen Schutz wie eine Person genießt, weil er auch zur Spezies Mensch gehört. Aus ethischer Sicht hilft das nicht weiter, auch wenn man nachweisen kann, dass mit der befruchteten Eizelle das menschliche Leben beginnt. Eine moralische Gleichstellung der befruchteten Eizelle mit menschlichem Leben in anderen Entwicklungsstadien kann damit nicht begründet werden.
Eng damit verknüpft ist das Identitätsargument: Mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ist die genetische Identität des werdenden Menschen eindeutig festgelegt. Jede menschliche Zelle enthält die Erbinformation eines bestimmten Menschen. Doch daraus leiten wir keine ethischen Regeln für den Umgang mit Körperzellen ab. Für diagnostische Zwecke wie zum Beispiel Blutuntersuchungen nehmen wir ihr Absterben in Kauf. Es ist also eher die Potentialität, die den besonderen Umgang mit embryonalen Stammzellen erfordert.
Das Potentialitätsargument stellt die Möglichkeit der menschlichen Entwicklung aus der befruchteten Eizelle in den Vordergrund: Die moralisch relevanten Eigenschaften der Person sind in der befruchteten Eizelle schon enthalten und müssen nur noch entwickelt werden. Die befruchtete Eizelle besitzt die personalen Eigenschaften also potentiell. Um dieses zu entkräften hat Reinhard Merkel4 im Gedankenexperiment einem Embryo im 4-Zell- Stadium eine Zelle entfernt und sogleich wieder zugefügt. Nach dem Identitäts- und Potentialitätsargument hat er einen natürlichen Klon geschaffen und diesen dann durch das Zurückführen in den Zellverband wieder getötet. Nach Merkel liegt aber der gleiche Zustand wie vorher vor. Josef Wisser, Oberarzt der Klinik für Geburtshilfe am Universitätsspital Zürich, bezweifelt diese Argumentation: “Die Tatsache, dass zunächst, wie bei der Bildung eineiiger Zwillinge, zwei Individuen entstehen, spricht nicht gegen das Identitätsargument. Beide Individuen haben das gleiche genetische Programm (...). Der zweite Teil des Experiments, die sogenannte „Wiedergutmachung“ ist bislang im biologischen Experiment noch nicht als möglich erwiesen. Der biologisch wahrscheinlichste Ausgang ist das Absterben des Einzellers nach diesen Manipulationen oder, nachdem die Eihülle, die sogenannte zona pellucida, zweimal verletzt worden ist, das Auftreten eineiiger Zwillinge.“5 Die Argumentation Merkels entkräftet das Identitätsargument also nicht.
Gegen das Potentialitätsargument spricht das Auftreten von Emergenz. Die reduktionistische Sichtweise, den Menschen mit seinen Erbanlagen gleichzusetzen, ist gleichbedeutend mit der Aussage, Biologie und Chemie sind ja letztlich auch nur Physik. Durch Zunahme an Komplexität treten eben neue Phänomene und Eigenschaften auf (Emergenz), die die Einzelteile des Ganzen oder zeitlich zurückliegende Entwicklungsstadien nicht besitzen. Die befruchtete Eizelle hat mit dem fertigen Menschen nur den genetischen Code gemeinsam. Ob in diesem schon alle späteren Eigenschaften der Person stecken, ist fraglich.
Ein besonders gewichtiges Gegenargument ist die biologische Tatsache, dass die Entscheidung, ob eine befruchtete Eizelle zum Menschen heran- wachsen kann, dadurch getroffen wird, ob eine Einnistung stattfindet oder nicht. In dieser Phase haben die Zellen ihre Eigenschaft totipotent zu sein schon verloren. Im Mutterleib geschieht also schon eine Selektion. Hubert Markl, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, legt dies ausführlich dar: „Die eigentliche „biologische Entscheidung“ zur Menschwerdung fällt daher tatsächlich keineswegs mit der Befruchtung, sondern erst mit der Einnistung des Keimes im Uterus. Dies wird besonders deutlich daran, dass die spontan frühabortierten Embryonen besonders häufig von genetischen Anomalien betroffen sind. Wer sich zum Beispiel schon einmal gefragt hat, warum eigentlich fast nur die Trisomie 21 als krankheitsbedingende Einzel- chromosomenvermehrungsanomalie beim Menschen vorkommt, und darin gar ein zwar schweres, aber gezielt gottgewolltes Schicksal erkennen will, sollte vielleicht doch zur Kenntnis nehmen, dass die meisten anderen Tri- somien von Einzelchromosomen durchaus auch vorkommen, aber eben dann genauso gottgewollt, oder vielleicht doch zufällig entstanden und rechtzeitig natürlich ausgelesen, spontan im Mutterleib absterben.“6
Daraus abzuleiten, der Mensch müsse wie die Natur handeln und Embry- onen nach bestimmten Kriterien selektieren, wäre ein naturalistischer Fehlschluss.
Wenn nun aber der Mensch Subjekt und Objekt moralischer Handlungen ist, weil er Interessen ausbilden und frei entscheiden kann, die Keimzelle jedoch nicht, dann stellt sich die Frage, ab welchem Entwicklungsstadium der werdende Mensch moralische Würde haben soll. Hier kommt das Konti- nuitätsargument in Spiel. Der Entwicklungsweg von der Eizelle bis zum fertigen Menschen ist kontinuierlich und deshalb eine zeitliche Grenze, ab der der Mensch moralische Würde genießt, willkürlich. „Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass jede Unterscheidung willkürlich in dem Sinne ist, dass sie uns nicht von der Natur aufgezwungen wird, sondern aus freien Stücken erfolgt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie willkürlich im Sinne von „grundlos“ sein muss (...). Die Entwicklung durch Zellteilung ist ja selbst ein diskreter Vorgang und die Einteilung in verschiedene Stadien folgt gerade allgemein anerkannten Gründen.“7
Die beiden ersten ethischen Fragen aus Kapitel II können mit Hilfe der Ethik alleine also nicht beantwortet werden. Die dritte Frage, ob die Anwendung der PID das Leben Behinderter beeinträchtigt, soll weiter unten diskutiert werden. Die oben genannten Argumentationen reichen nicht aus um der Frühform menschlichen Lebens und insbesondere der befruchteten Eizelle ethische Werte allgemein anerkannt zuzusprechen. Das soll aber nicht heißen, dass sie keine hätte, sondern nur, dass die Mittel der Ethik dazu nicht geeignet sind. Dort, wo ethische Wertzuweisungen scheitern, können Gläubige vielleicht aus den Grundwerten ihres Glaubens Begründungen für die moralische Würde des Embryos finden und damit die ethischen Fragen der PID für sich beantworten. Die ganze öffentliche Diskussion in Deutschland und der westlichen Welt geschieht ja vor dem abendländischen Hintergrund des Christentums und deshalb finde ich die Standpunkte der anderen großen Glaubensgemeinschaften besonders interessant.
3. Die PID aus Sicht der Religionen
Die christlichen Kirchen
„Gemeinsame Grundüberzeugung der christlichen Kirchen ist, dass der Embryo von Anfang an ein Recht auf Lebensschutz hat. Ein Embryo ist keine Sache, deshalb auch nicht als Material für Untersuchungen und Experimente nach Belieben verwertbar; er ist menschliches Lebewesen.“8
Im Detail unterscheiden sich die Haltungen der christlichen Kirchen, insbesondere der protestantischen Kirchen im angelsächsischen Ausland, gewaltig:
„Die katholische Kirche lehrt einen absoluten Lebensschutz für den Embryo, die römisch katholische Kirche anerkennt den Embryo ab seiner
Zeugung als Mensch und Person Indem der Embryo getötet (oder zumindest in seine körperliche Unversehrtheit eingegriffen) wird, um Forschung betreiben zu können, wird er außerdem nicht als Zweck, sondern nur als bloßes Mittel behandelt. Dies gilt nach katholischer Auffassung auch für den verwaisten todgeweihten Embryo.“9
Für die katholische Kirche sind also Schwangerschaftsabbruch, In-Vitro- Fertilisation und PID nicht akzeptabel. „Maßgebend für das konkrete Handeln des einzelnen Christen und des Forschers ist seine persönliche Gewis- sensentscheidung, die freilich die kirchlichen Lehraussagen beachten muss.“10 Der katholische Christ muss sich an die Weisungen seiner Kirche halten.
Der selbe Standpunkt wird von den evangelischen Kirchen in Deutschland vertreten. Der Rat der evangelischen Kirchen Deutschlands (EKD) sagt: „Der Schutz menschlicher Embryonen darf nicht eingeschränkt werden.“ (22. Mai 2001). Die Forschung an embryonalen Stammzellen und die PID werden abgelehnt. Allerdings hat der Christ in der evangelischen Kirche die Möglichkeit nach eigenem Gewissen sein Urteil zu fällen und zu handeln.
Protestantische Kirchen aus dem angelsächsischen Raum vertreten oft einen anderen Standpunkt. Die Presbyterianische Kirche von Schottland hat sich für die Gewinnung von embryonalen Stammzellen aus überzähligen Embryonen und für die PID ausgesprochen. „ Dabei ist der jeweilige Sach- verhalt genau zu überprüfen. Bei Ausnahmen von einem absoluten Embry- onenschutz sind sehr strenge Maßstäbe anzulegen. Abgelehnt wird ein Her- stellen von Forschungsembryonen. Kriterien, Verfahren und Kontrollen müssen genau überprüfbar festgestellt und geregelt sein. Eine Analogie wird bei dieser Argumentation zur Konfliktlage beim Schwangerschaftsabbruch gezogen “11
Die jüdische Glaubensgemeinschaft
In der jüdischen Religionsgemeinschaft ist der Zeitpunkt des Lebensbeginns nicht eindeutig festgelegt. Frühestens ab dem vierten Schwangerschaftsmonat und spätestens bei der Geburt genießt nach den Gelehrtenmeinungen der werdende Mensch Schutz. Die Stammzellforschung und die PID sind somit nach jüdischem Glauben erlaubt. Da die Gesetzgebung in Israel von den Religionsgesetzen beeinflusst ist, ist dort Stammzellforschung und die PID erlaubt.
Der Islam
Im Islam ist der Zeitpunkt der Beseelung am 40. Tag, bei manchen Moslems erst am 120. Tag. Bis dahin ist Forschung an Embryonen und die PID zugelassen.
Der Buddhismus
Der Dalai Lama sagt, der Buddhismus betrachte diese Fragestellung als neutral. Was immer das auch heißen mag. Die Deutsche Buddhistische Union (DBU) hat einen Standpunkt zur Gentechnik verfasst. „Die Mitgliederversammlung der Deutschen Buddhistischen Union erklärt ihre Ablehnung der sogenannten verbrauchenden Embryonenforschung, insbesondere der PID sowie des therapeutischen Klonens. Die DBU spricht sich entschieden gegen alle Bestrebungen aus, den Menschen durch Maßnahmen der gezielten Züchtung und genetischen Selektion, des reproduktiven Klonens oder der Keimbahntherapie biotechnisch optimieren zu wollen.“12
Die DBU versucht ihre Haltung aus den buddhistischen Grundsätzen zu erklären. „Der Pfad des Buddha hat die Überwindung des Leidens aller empfindenden Wesen zum Ziel. Dieser Weg der Befreiung vom Leiden ist ein Weg der Befreiung des menschlichen Geistes und damit ein Weg der Entfaltung dessen, was den Menschen vor allem anderen auszeichnet: Weisheit und Mitgefühl Die (Gentechnik) scheint derzeit in breitem Maße vom Wunsch getragen zu sein, den Menschen mit Hilfe technischer Mittel von jeglichem Leiden und aller Vergänglichkeit und Unvollkommenheit zu befreien, ihn zum perfekten und unsterblichen Übermenschen zu machen.“13 Der Leser hat nun bestimmt wieder Huxley’s „Schöne Neue Welt“ im Kopf. In diesem Roman wird eben dieser Zustand geschildert, eine Welt ohne Leid, zwar nicht mit unsterblichen Menschen, aber einem angenehmen, geplanten Tod ohne Schmerzen. Alle materiellen Wünsche werden befriedigt, ansonsten gilt ein Spaßprinzip. Wenn jemand doch von negativen Gedanken jeglicher Art geplagt ist, nimmt er einfach eine Tablette Soma, eine perfekte Droge.
„Im Buddhismus gibt es drei Grundformen des Leidens: Das Leiden des Schmerzes ist das, was wir gewöhnlich als körperliches oder psychisches Leiden bezeichnen, zum Beispiel Kopfschmerzen.“14 Gegen dieses Leiden kann man Medizin nehmen, sich warm anziehen oder versuchen ihm auszuweichen. Dann gibt es das Leiden des Wandels, der Vergänglichkeit. Das „Anhaften“ an Dinge und Menschen, die vergänglich sind, verursacht Leiden. Zum Beispiel ein Auto, an dem wir sehr hängen, wird unaufhaltsam älter und wird irgendwann verrosten und zerfallen. „Die dritte Form des Leidens ist Grundlage für die anderen beiden, was durch unsere eigenen verunreinigten geistigen und physischen Bedingungen illustriert wird. Es wird als Leiden der allbestimmenden Verursachung von Wiedergeburt bezeichnet, weil alle Wesen, die im Kreislauf der Geburten wandern, von ihm betroffen sind; Es ist der Grund nicht nur für gegenwärtiges Leiden, sondern auch für zukünftiges. Es gibt keine Möglichkeit, dieser Form des Leidens zu entgehen, es sei denn, dass das Kontinuum der Wiedergeburten aufgelöst wird.“15 Ziel des Buddhisten ist es, sich von allen Arten des Leidens zu befreien und das ständige wiedergeboren Werden zu beenden. Jedoch darf das nicht auf Kosten anderer geschehen, weil es sonst wieder Leid für einen selbst und für andere in diesem oder in zukünftigen Leben verursachen würde.
„Der Weg des herstellbaren und einklagbaren Glücks ist darüber hinaus mit zahlreichen inakzeptablen wie unvorhersehbaren Opfern und Risiken gepflastert und geht soweit, schwere Schäden, Leiden oder gar den Tod menschlicher oder tierischer Versuchs- und Gebrauchsobjekte als notwendig und unvermeidlich zu betrachten. Buddha lehrte jedoch, dass wirkliches Glück und menschliche Erfüllung nur möglich werden, wo unser Denken, Sprechen und Handeln frei ist von jeglichem Impuls, lebende Wesen zu töten oder zu verletzen.“16
Die großen Weltreligionen haben also ganz gegensätzliche Auffassungen zur PID. Leider konnte ich nur beim Buddhismus eine Begründung aus der Lehre finden. Die Standpunkte der Glaubensgemeinschaften können uns leider keine allgemein anerkannte Argumentation für oder gegen die PID bieten. Zusammenfassend kann man sagen, dass die weltanschauliche Betrachtungsweise der PID , also ethisch und aus dem Glauben, keine Anhaltspunkte für oder gegen die PID liefern. Es bleibt jedem selbst überlassen, zu welcher Anschauung er tendiert.
Im Gegensatz zu den vorangegangen, weltanschaulichen Gesichtspunkten möchte ich nun Standpunkte beleuchten, die ich real nenne, weil sie sich auf soziologische Betrachtungsweisen und damit auf wissenschaftliche Fakten berufen, sich auf Statistiken aus Ländern, die die PID erlauben, stützen oder historisch belegt sind.
4. Soziologische Betrachtung
Elisabeth Beck-Gernsheim legt in ihrem Beitrag dar, warum immer mehr Frauen die Pränataldiagnostik nutzen.17 Frauen wollen die Sicherheit, dass ihr Kind gesund wird. Sie blenden einen negativen Ausgang des Tests meist aus. Als zweiten Grund nennen sie Mitleid mit dem Kind, wenn es behindert sein
sollte. Sie wollen ihm diese leidvolle Existenz ersparen. Ein Argument, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist folgendes: „Immer mehr Frauen werden durch Veränderungen in Bildung, Beruf, Familienzyklus, Rechtssystem usw. aus der Familienbildung zumindest teilweise heraus- gelöst; können immer weniger Versorgung über den Mann erwarten; werden
- in freilich oft widersprüchlicher Form - auf Selbstständigkeit und Selbstversorgung verwiesen.“18 Der Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird bei Befragungen von jungen Mädchen und Frauen fast immer genannt. Doch dazu fehlen nach Beck-Gernsheim Kinderkrippen, Kindergärten und Ganztagsschulen. Ob dieses Problem damit gelöst werden kann, sei dahingestellt. Tatsache ist jedoch, dass „Kinderhaben heute das Strukturrisiko der weiblichen Erwerbsbiographie (ein soziales, kein biologisches, wohlgemerkt), ja eine Behinderung, an den Maßstäben der Marktgesellschaft gemessen, ist.“19 Frauen wollen also vor allem die Pränataldiagnostik um ausschließen zu können, ein behindertes Kind zu bekommen. Dieses würde sie wieder in die traditionelle Frauenrolle drängen oder als Alleinerziehende aus dem Beruf in die Abhängigkeit von Sozialsystemen treiben. Man kann sich so gut vorstellen, warum Frauen wohl auch die PID nutzen würden.
5. Die PID und Behinderte in der Gesellschaft
Oft wird von Gegnern der PID behauptet, die Einführung der PID würde in der Gesellschaft die Überzeugung verfestigen, Behinderte seien „lebensunwertes Leben“. In einem Teil des Kasseler Dokuments äußern sich sechs Verbände der Behindertenhilfe und Selbsthilfe. Hier zeigt sich eine Furcht vor einer Verschlechterung der Stellung von Behinderten in der Gesellschaft und einem Angriff auf die Individualität eines jeden Menschen. Manche befürchten sogar folgende Entwicklung:
1. Mit der Einführung der PID verfestigt sich die Überzeugung, dass Behinderte lebensunwertes Leben seien.
2. Gesellschaftlicher Druck, wie die Meinung von Bekannten und Freunden oder die staatliche Unterstützung, bringen immer mehr Paare dazu, die PID zu nutzen.
3. Die PID wird für Risikopersonen gesetzlich vorgeschrieben.
4. Zusätzlich zu Embryonen mit Gendefekten sollen Behinderte jeden Alters getötet werden.
Dem ist entgegenzuhalten, dass die Technik der PID nicht die Wertung, behindertes Leben sei wertlos oder lebensunwert, impliziert. Außerdem gäbe es trotz Anwendung der PID viele behinderte Menschen aus verschiedensten Gründen. Sicher fallen Behinderte mehr auf, wenn es weniger gibt. Aber dass deshalb die staatlichen Hilfen eingestellt werden oder Ablehnung aus dem gesellschaftlichen Umfeld resultiert, ist nicht zwangsläufig der Fall. Müssen Eltern deshalb ein behindertes Kind bekommen und dürfen die PID nicht nutzen, weil andere ein ähnliches schweres Schicksal haben? Auch wenn das Leben als Behinderter lebenswert ist und Behinderte oft Menschen sind, die aufgrund eigenen Erlebens höhere menschliche Werte besitzen als Nichtbehinderte, rechtfertigt das nicht, die PID für genetisch belastete Eltern zu verbieten und zu riskieren, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein behindertes Kind bekommen. Ob die PID der Einstieg in ein Euthanasieprogramm sein könnte, wird bei der folgenden historischen Betrachtung behandelt.
6. Historische Betrachtung
Michael Naumann zeigt in seinem Beitrag20 „Der Staat und die Heiligkeit des Lebens“, wie es in der Weimarer Republik und vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus zur Vorstellung von einer „Massenhygiene“ gekommen ist, die schließlich in der Euthanasie endete. Gibt es Anzeichen, dass wir uns in einer ähnlichen Entwicklung befinden?
In der Weimarer Republik wurden Themen wie Fortpflanzungsmedizin, Eugenik, gesundheitsfördernder Massensport und Euthanasie offen diskutiert
- „allesamt getrieben vom Glauben einer wissenschaftlichen Determination des Lebens, genauer: vom Glauben an die gesellschaftliche Leistungskraft von Wissenschaft schlechthin.“21 Der nationalsozialistische Theoretiker von Erb- und Rassenpflege Arthur Gütt sagte: “Überall entstehen Seuchengesetze, durch die dem Staat das Recht gegeben wurde, in das persönliche Leben des einzelnen einzugreifen. Die Berechtigung zu diesem Vorgehen erhielt der Staat dadurch, dass diese Beeinträchtigung der Freiheit einzelner einer um so größeren Zahl des Gesamtvolkes Leben rettete.“ Er führt also (...). Durch planmäßige Auslese, durch Förderung der erbgesunden Familien und durch Ausschaltung der kranken Erblinien aus der Fortpflanzung ist uns ein Mittel zur Ertüchtigung und Gesundung zwar nicht für die heute Lebenden, wohl aber für das Deutschland der Zukunft gegeben.“22 Es wurden in der Zeit des 3. Reichs planmäßig 250 000 psychisch Kranke und Behinderte ermordet. Der Vulgärutilitarismus Gütts, der den Nutzen des ganzen Volkes über das Lebensrecht des Einzelnen stellte, reichte wohl alleine nicht aus, um einen großen Teil der (christlichen)
Gesellschaft davon zu überzeugen. Was kam also noch dazu? Michael Naumann nennt drei Gründe:
Erstens den Wegfall eines „religiös oder philosophisch-transzendental fundierten Respekts vor dem Gebot einer gottgegebenen Lebensheiligkeit (des einzelnen)“.23 Das Zweite ist für ihn die „medizinwissenschaftliche Rationalisierung des menschlichen Körpers“.24 Drittens den „epochalen Technikglauben an die medizinwissenschaftliche Machbarkeit eines eugenischen Hygieneprogramms. Was möglich wurde, wurde legal.“25
Besteht heute die Gefahr, dass ähnliches wieder passieren könnte? Das Lebensrecht des einzelnen geborenen Menschen ist derzeit durch das Grundgesetz und der herrschenden Auffassung der Bevölkerung gut geschützt. In der PID-Debatte geht es nicht darum, lebenden Menschen das Lebensrecht zu entziehen. Eine Entwicklung wie im obigen Kapitel (Aufzählung 1-4) sehe ich nicht. Die medizinwissenschaftliche Rationalisierung des menschlichen Körpers ist durch die molekulare Medizin sehr weit fortgeschritten und insofern eine Gefahr, wenn sie mit dem dritten Argument Naumanns, den Glauben an die Machbarkeit, zusammenfällt. Doch neuere wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass die Gene längst nicht alles vorgeben. Siehe zum Beispiel den Geo-Artikel zur Einsamkeit, Geo 10/2002 ab Seite 20. Um zu untersuchen, ob Einsamkeit ein genetisch bedingter Wesenszug ist, hat John Cacioppo, Einsamkeitsforscher aus Chicago, Testpersonen hypnotisieren lassen. Einmal wurde ihnen eine Situation der Einsamkeit suggeriert, dann das Gefühl, gut eingebunden zu sein. „Das mag vielleicht Assoziationen an Gehirnwäsche wecken, doch die Suggestion ruft nur bereits vorhandene Reaktionsmuster aus dem Unterbewussten auf, die wenig später wieder verblassen.“26 Die Einsamkeitswerte bei anschließenden Test waren je nach suggerierter Situation sehr verschieden. Cacioppo folgert: „Die Ergebnisse der Hypnotisierten sahen genauso aus wie bei wirklich Einsamen. Diese Merkmale hängen also nicht von einer genetischen Erblast ab - sondern davon wie wir uns in unserer Umwelt wahrnehmen.“27 Der Glaube an die Machbarkeit ist ein Problem der Gesellschaft und der Wissenschaft, das sich bei jeder mächtigen Technik stellt. Ein großer Unterschied zur Zeit des Nationalsozialismus besteht heute darin, dass damals das Ideal des Menschen zentral festgelegt wurde. Wenn Eltern sich heute mittels der PID Kinder nach ihren Wünschen schaffen könnten, würden sich die einen einen zwei Meter großen Basketballspieler wünschen, andere eine körperliche Behinderung in Kauf nehmen, wenn ihr Kind nur außergewöhnlich intelligent wäre.
Die PID wird schon in einigen Ländern praktiziert. Sicher wird die Technik noch verbessert, aber schwerwiegende Hindernisse und problematische Entwicklungen zeichnen sich schon ab.
7. Daten Fakten und Erfahrungen durchgeführter PIDs
Die PID bedeutet auch bei erfolgreicher Durchführung ohne Komplikationen eine starke psychische und physische Belastung für die Frau. Sie muss eine Hormonbehandlung über sich ergehen lassen, die nötig ist, um die Reifung der befruchteten Eizelle zu ermöglichen. Sie bringt erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich. Die Statistik zeigt auch, dass die ganze Prozedur mit extrem vielen missglückten Versuchen einhergeht. In der Zeitschrift Human Reproduction 15 aus 12/2000 wurde folgende Statistik veröffentlicht: Es werden der Frau durchschnittlich 10 Eizellen entnommen, 9 werden befruchtet. Daraus gelingen nur ca. 5 Embryonen, die untersucht und eingepflanzt werden können. Es werden den Embryonen dann zwei Zellen entnommen und nur wenn die genetische Untersuchung bei beiden den Wünschen entspricht, kann der Embryo transferiert werden. Dieses Kriterium erfüllt im statistischen Mittel nur einer. Von 1993 bis 2000 wurden bei 886 Paaren die PID angewandt. Dabei wurden über 10.000 Eizellen entnommen, 9.090 insemiert und über 5000 Embryonen biopsiert. Letztlich wurden nur 123 Paaren der Kinderwunsch erfüllt, sie bekamen 162 Kinder. Die Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der PID Kinder zu bekommen liegt also bei etwa 14 Prozent.
In neun Fällen wurde eine Mehrlingsreduktion, also ein partieller Schwangerschaftsabbruch, durchgeführt. Etwa 80 Prozent der Schwanger- schaften wurde mittels Pränataldiagnostik kontrolliert und 7 abgebrochen. „In mindestens 49 Fällen kam es zu neonatalen, das heißt postnatalen Komplikationen und in drei Fällen endeten diese mit dem Tod des Kindes.“28 Hille Haker folgert daraus: „Erstens: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wunsch nach einem gesunden Kind über die assistierte Fortpflanzung in Kombination mit Präimplantationsdiagnostik erfüllt werden kann, ist gering. Zweitens: Weder die Pränataldiagnostik noch Schwangerschaftsabbrüche können in entscheidendem Ausmaß vermieden werden. (...) Drittens: Das Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft ist erheblich höher als bei spontanen
Schwangerschaften. Und viertens: Die Möglichkeit neonataler Komplikationen ist dadurch gleichfalls erhöht.“29 Auf der Homepage30 von Roland Graf, Schweizer Diplomchemiker und katholischer Priester, sind die neuesten Zahlen aus Human Reproduction (1/2002) veröffentlicht. „Demnach sind im Jahr 2001 in 24 Zentren aus 14 Ländern im Rahmen von 412 Zyklen PID-Techniken angewendet worden. Davon dienten 78 Zyklen allein der Geschlechtsbestimmung ohne dass ein erhöhtes Risiko zur Übertragung einer vererbbaren Krankheit vorlag! Die Studie nennt das „social sexing“ oder auch „family balancing“. Die Reproduktionsmediziner wählen im Auftrag der Paare jene Embryonen aus, welche dem gewünschten Geschlecht entsprechen. Welche Gründe dafür in Frage kommen, teilte ein Teilnehmer der Studie mit. Er nannte den Ausgleich des Geschlechtsverhältnisses innerhalb einer Familie (family balancing) und den Ausgleich des Geschlechtsverhältnisses am Zentrum innerhalb eines Jahres. (...) Ein Zentrum, das „social sexing“ durchführte, gab an, es sei besser Embryonen zu „eliminieren“, statt Abtreibungen vorzunehmen! Daraus folgt, dass solche ebenfalls allein aus Gründen des Geschlechts durchgeführt werden. Die Annahme, dass nur unfruchtbare Paare, die Gelegenheit für diese Art von PID benützen, ist falsch, denn 75.6% der Zyklen betrafen fruchtbare Paare. Dass die Auftraggeber es mit ihrem Wunsch ernst meinen, bestätigt der Hinweis in der Studie, dass im Rahmen des „social sexing“ ein Kind wegen eines Diagnosefehlers nach invasiver pränataler Diagnostik abgetrieben wurde. Es hatte trotz PID das falsche Geschlecht.“31
Die Statistik zeigt also, dass Menschen in Ländern, in denen die PID erlaubt ist, die PID nutzen um ihr Wunschkind zu bekommen. Es geht hier nicht mehr darum, eine Erbkrankheit zu vermeiden, sondern darum, ein Kind mit den gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Wäre es möglich, andere Eigenschaften als die anfangs genannten Erbkrankheiten und das Geschlecht zu bestimmen, so kann man davon ausgehen, dass auch diese genutzt werden würden. Dieses Verhalten ist meiner Meinung nach auf Deutschland übertragbar. Es würden sich bei entsprechender Gesetzeslage bestimmt Paare finden, die die PID für ihr Wunschkind nutzen würden.
IV. Fazit
Die Diskussion um die PID beinhaltet drei generelle Probleme: Erstens geht es um individuelles Leben menschlicher Frühformen, das heißt um Lebensformen von der befruchteten Eizelle bis zum 10-zell Stadium. Darf man es manipulieren, selektieren und töten? Wir haben gesehen, dass weder die Ethik, noch die Weltreligionen oder die Wissenschaft brauchbare Anhaltspunkte liefern. Auch die Behauptung, mit der PID Abtreibungen zu vermeiden, ist nicht haltbar. Es muss also jeder nach seinem Gewissen und Glauben entscheiden, ab welchem Zeitpunkt er menschlichem Leben vollen Schutz (im Sinne §1 Grundgesetz) zukommen lassen will. Einen gesellschaftlichen Konsens darüber wird es nicht geben, denn das Meinungsspektrum in Deutschland wird auf lange Zeit von strikter Ablehnung bis uneingeschränkter Zustimmung reichen. Für den Gesetzgeber wird es deshalb sehr schwer sein, dem gerecht zu werden.
Zweitens betrachte ich das individuelle Leben der Paare, die die PID anwenden und ihre Kinder. Für Eltern, die Träger einer Erbkrankheit sind, ist es natürlich von größtem Interesse, ihren Kindern diese nicht mitzugeben. Sie können ihnen auf diese Weise viel Leid ersparen und ihnen ein normales Leben ermöglichen. Die Eltern selbst haben den großen Vorteil, sich gesunder Kinder zu erfreuen und die psychisch und physisch sehr anstrengende Pflege nicht übernehmen zu müssen. Da die Kinder dann nicht mehr von dieser Krankheit betroffen sind, können sie sich normal fortpflanzen. Wie die neueste Statistik aus Human Reproduction (1/2002) zeigt, werden ein Großteil der PIDs bei fruchtbaren Paaren angewendet, die sich gerne ein Mädchen oder einen Jungen wünschen. Abgesehen von dem Risiko, das die Frau für sich selbst eingeht und damit riskiert, dass ihre anderen Kinder ohne Mutter aufwachsen müssen, ist der Nutzen von einem Außenstehenden wie mir eher gering einzuschätzen. Gibt es einen Dammbruch, das heißt, werden viele Paare die PID anwenden, nicht um Gendefekte zu vermeiden, sondern um das Geschlecht und in Zukunft vielleicht noch andere Eigenschaften zu bestimmen, ergibt sich daraus ein gesellschaftliches Problem:
Das dritte Problem ist die Auswirkung durch die Anwendung der PID auf die Gesellschaft. Dieses ist es meiner Meinung nach auch, das große Ängste erzeugt. Wenn der Großteil der Paare, die ein Kind wollen, die PID anwenden, besteht die Gefahr, dass nach einigen Generation die Menschen sich nicht mehr natürlich fortpflanzen können. Sie wären dann vollkommen abhängig von den Ärzten und der Technik. Der Status der Reproduktionsmediziner wäre tatsächlich gottähnlich, sie könnten darüber entscheiden, wer Nachwuchs bekommt und wer nicht. Ihre Macht in der Gesellschaft wäre riesig. Gepaart mit einem korrupten Machtsystem besteht die Gefahr, dass der Staat wie nie zuvor in das Leben des Einzelnen eingreift. Man stelle sich vor, die Reproduktionsmedizin wäre in der Hochzeit des Sozialismus schon voll entwickelt gewesen! Auch die Utopie aus Star Wars, eine Armee aus Klonkriegern zu schaffen, ist dann nicht mehr weit entfernt. Wissenschaftler wie Stephen Hawkings meinen, dass wir uns gezielt genetisch verbessern müssen, um im Konkurrenzkampf mit den Maschinen bestehen zu können. Auch bei der Besiedlung anderer Planeten könnten bestimmte Eigenschaften, die wir momentan nicht besitzen, wichtig werden. Bei all den Utopien von Wunschkindern und Menschen mit besseren Eigenschaften bleibt die Gefahr, dass unser Genpool zu klein wird, um auf Veränderung der Lebensumgebung zu reagieren und wir in eine Sackgasse der Evolution laufen. Kommen bestimmte Eigenschaften bei den Eltern „in Mode“, gibt es zeitweise nur noch Kinder mit dieser Eigenschaft. Ebenso könnte es sein, dass es keine Genies mehr gibt. Ob Maler, Schauspieler, Schriftsteller, Mathematiker oder Naturwissenschaftler, herausragende Persönlichkeiten sind nicht selten extreme Persönlichkeiten und manchmal dem sprichwörtlichem Wahnsinn sehr nahe. Der Vorteil der Genialen wird oft mit anderen negativen Eigenschaften bezahlt. Das Leben dieser Menschen ist oft sehr schwierig. Man denke nur an Hermann Hesse , Klaus Kinski oder Ludwig Boltzmann. Viele Eltern werden sich solche Außenseiter der Gesellschaft nicht wünschen.
Diese Vorstellungen sind heute noch Utopien, die PID könnte aber der erste Schritt in diese Richtung sein. Mit fortschreitender Technik wird sich herausstellen, was realisierbar ist und wo Gefahren lauern. Es liegt nicht in der Macht des Einzelnen bei drohendem Missbrauch zu sagen: Bis hier hin und nicht weiter! Die technologische Entwicklung muss mit einer gesellschaftlichen Entwicklung einhergehen, in der der Einzelne für seinen Standpunkt kämpft und sich so im gesellschaftlichen Konsens eine sinnvolle Regelung ergibt.
Die Entwicklung wachsam zu beobachten, um das Machbare sinnvoll zu begrenzen, ist die wichtigste Aufgabe für die Zukunft. Für Bundeskanzler Gerhard Schröder stellt sich die Notwendigkeit der Abwägung immer wieder neu. Dem möchte ich mich anschließen.
[...]
1 Bohne, „Naturrecht und Gerechtigkeit“, in : Festschrift für R. Lehmann, Berlin/Tübingen 1956, I, 3ff,;hier S. 13
2 Nida-Rümelin. F.A.Z. vom 4.1.2001
3 Rudolf Kötter, „Wieviel Ethik enthält die Bioethik?“, Kultur Handlung Wissenschaft, Für Peter Janich, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2002, Seite 138
4 Merkel 2001
5 edition suhrkamp, Biopolitik, Herausgeber Christian Geyer, Beitrag von Josef Wisser, Seite 220
6 edition suhrkamp, Biopolitik, Herausgeber Christian Geyer, Beitrag von Hubert Markl, Seite 188 8
7 Rudolf Kötter, „Wieviel Ethik enthält die Bioethik?“, Kultur Handlung Wissenschaft, Für Peter Janich, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2002, Seite 141
8 Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer; www.zentrale- ethikkommission.de/10/34Stammzell/DEthisch/Religion.html
9 wie 8
10 wie 8
11 wie 8
12 Standpunkt: Buddhisten und die Gentechnik, Erklärung der Deutschen Buddhistischen Union, Ausgabe 58, www.tibet.de/tib/tibu/tibu58/standpunkt.html
13 wie 12
14 Goldmann, Der XIV. Dalai Lama, Logik der Liebe, Aus den Lehren des Tibetischen Buddhismus für den Westen, Seiten 48/49
15 wie 14
16 wie 12
17 edition suhrkamp, Biopolitik, Herausgeber Christian Geyer, Beitrag von Elisabeth Beck-Gernsheim 12
18 edition suhrkamp, Biopolitik, Herausgeber Christian Geyer, Beitrag von Elisabeth Beck-Gernsheim, Seite 33
19 wie 18
20 edition suhrkamp, Biopolitik, Herausgeber Christian Geyer, Beitrag von Michael Naumann
21 edition suhrkamp, Biopolitik, Herausgeber Christian Geyer, Beitrag von Michael Naumann, Seite 269
22 edition suhrkamp, Biopolitik, Herausgeber Christian Geyer, Beitrag von Michael Naumann, Seite 269/270
23 edition suhrkamp, Biopolitik, Herausgeber Christian Geyer, Beitrag von Michael Naumann, Seite 270 Mitte
24 wie 23
25 wie 23
26 Geo, 10/2002, Seite 42, linke Spalte
27 Geo, 10/2002, Seite 42, mittlere Spalte
28 edition suhrkamp, Biopolitik, Herausgeber Christian Geyer, Beitrag von Hille Haker, Seite 146
29 edition suhrkamp, Biopolitik, Herausgeber Christian Geyer, Beitrag von Hille Haker, Seite 146
30 http://cloning.ch/cloning/impressum.html und http://cloning.ch/cloning/pid.html 16
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Präimplantationsdiagnostik (PID) und wie funktioniert sie?
Die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist eine Methode zur Untersuchung von Embryonen auf genetisch bedingte Erbkrankheiten, bevor diese in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt werden. Sie setzt eine In-Vitro-Fertilisation (künstliche Befruchtung) voraus. Dabei werden dem Embryo im frühen Stadium (4-8 Zellstadium) Zellen entnommen und auf genetische Defekte untersucht. Nur Embryonen ohne diese Defekte werden eingesetzt.
Was sind die ethischen Bedenken bezüglich der PID?
Die ethischen Bedenken umfassen unter anderem die Frage, ob eine verbrauchende Manipulation (Tötung) an Embryonen durchgeführt werden darf, ob die Selektion von Embryonen eine Diskriminierung von Behinderten darstellt und ob die PID zu einer "Menschen nach Maß"-Gesellschaft führen könnte. Des Weiteren wird diskutiert, ob der Embryo von Anfang an Menschenwürde besitzt und somit schutzwürdig ist.
Wie ist die rechtliche Situation der PID in Deutschland?
In Deutschland ist die PID nach dem Embryonenschutzgesetz (EschG) verboten, da dieses die genetische Untersuchung von Embryonen und die Entnahme totipotenter Zellen untersagt. Der Embryo genießt gemäß §1 des Grundgesetzes (GG) Schutz, da seine Würde unantastbar ist.
Welche Argumente werden für die Legalisierung der PID angeführt?
Befürworter argumentieren, dass die PID Paaren mit genetischer Belastung die Möglichkeit gibt, gesunde Kinder zu bekommen. Zudem wird auf die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs in bestimmten Fällen hingewiesen, was den absoluten Lebensschutz des Embryos in Frage stelle. Es wird auch argumentiert, dass die PID die Geburt von Kindern mit schweren Erbkrankheiten verhindern und somit Leid vermeiden kann.
Wie positionieren sich die Religionen zur PID?
Die christlichen Kirchen, insbesondere die katholische, lehnen die PID in der Regel ab, da sie den Embryo von Anfang an als schutzwürdiges menschliches Leben betrachten. Andere Religionsgemeinschaften wie das Judentum und der Islam haben differenziertere Ansichten, wobei die Forschung an Embryonen und die PID bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung (z.B. bis zum 40. oder 120. Tag) erlaubt sein können. Der Buddhismus hat keine einheitliche Meinung, lehnt aber Tendenzen zur genetischen Selektion ab.
Welche soziologischen Aspekte spielen bei der PID eine Rolle?
Soziologisch gesehen wird die PID im Zusammenhang mit dem Wunsch von Frauen nach Sicherheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrachtet. Frauen wollen ausschließen, ein behindertes Kind zu bekommen, da dies ihre berufliche Situation beeinträchtigen könnte. Es besteht die Angst vor sozialer Isolation und wirtschaftlicher Abhängigkeit, wenn ein behindertes Kind versorgt werden muss.
Wie könnte sich die PID auf Behinderte in der Gesellschaft auswirken?
Kritiker befürchten, dass die PID die Überzeugung verfestigen könnte, dass behindertes Leben weniger wert sei. Dies könnte zu einer Verschlechterung der gesellschaftlichen Stellung von Behinderten und einem Angriff auf die Individualität jedes Menschen führen.
Gibt es historische Parallelen zur PID-Debatte?
Es wird auf die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus verwiesen, in der die Eugenik und die Euthanasie offen diskutiert wurden. Es besteht die Sorge, dass ein Verlust des Respekts vor dem Leben und ein Glaube an die Machbarkeit durch die Wissenschaft zu ähnlichen Entwicklungen führen könnten.
Welche Erfahrungen wurden mit der PID in Ländern gemacht, in denen sie erlaubt ist?
Studien zeigen, dass die PID mit einer hohen psychischen und physischen Belastung für die Frau verbunden ist und oft zu missglückten Versuchen führt. Zudem werden PID-Techniken teilweise zur Geschlechtsbestimmung ohne medizinische Notwendigkeit eingesetzt ("social sexing"). Die Wahrscheinlichkeit, durch die PID zu einer Schwangerschaft zu gelangen, ist gering, und es besteht ein erhöhtes Risiko für Mehrlingsschwangerschaften und neonatale Komplikationen.
Welche generellen Probleme beinhaltet die Diskussion um die PID?
Die Diskussion umfasst ethische Fragen zum Status des frühen menschlichen Lebens, individuelle Interessen von Paaren mit genetischer Belastung und die möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft, insbesondere die Gefahr einer "Menschen nach Maß"-Gesellschaft und einer Einschränkung des Genpools.
- Quote paper
- Johannes Kiesel (Author), 2002, Präimplantationsdiagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107390