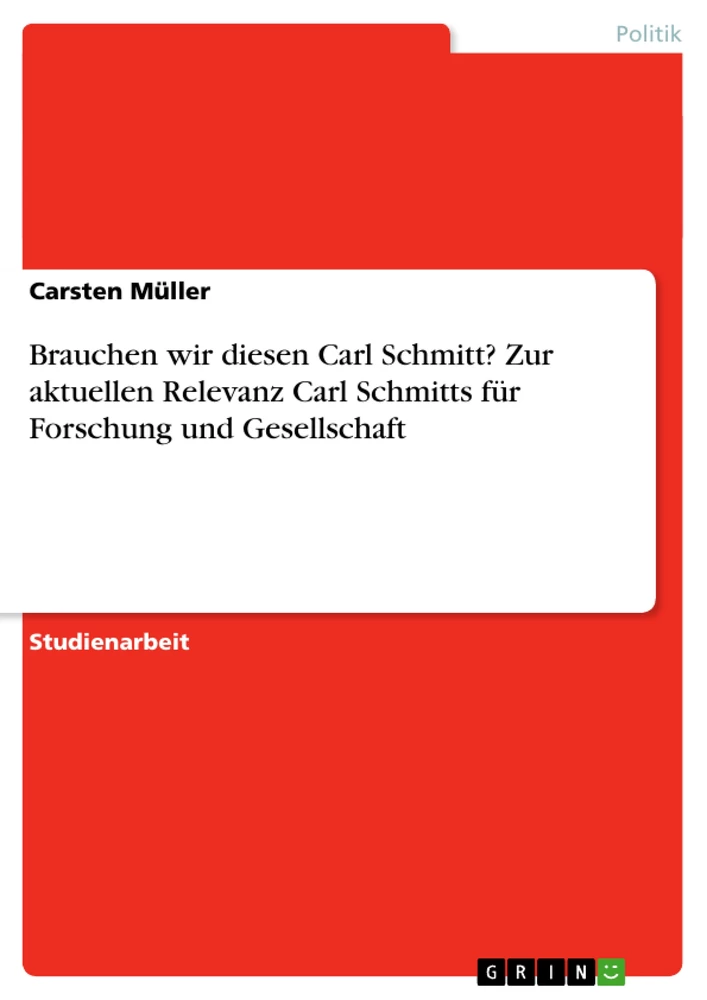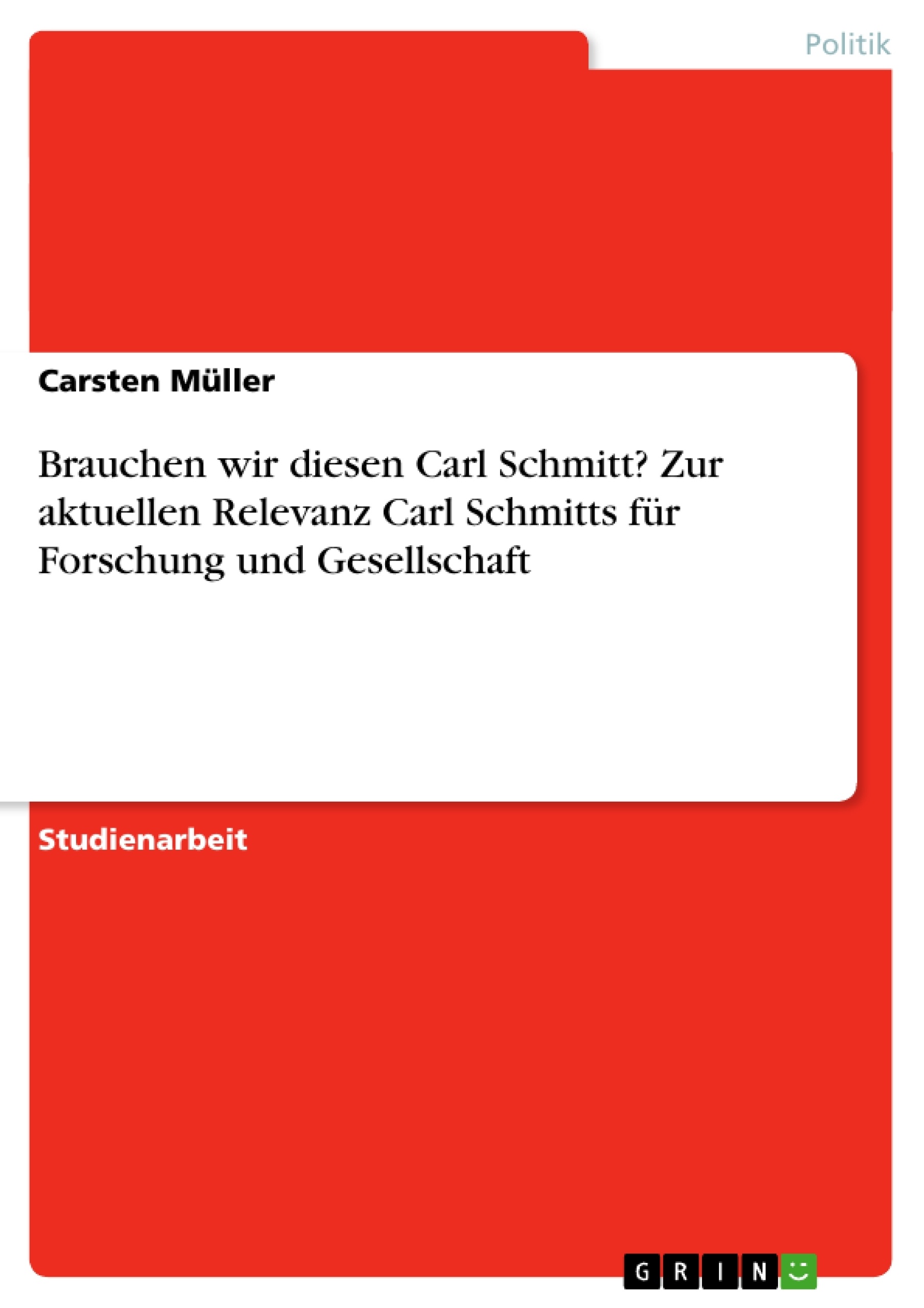"Brauchen wir diesen Carl Schmitt?" Zur aktuellen Relevanz Carl Schmitts für Forschung und Gesellschaft
1. Einführung
Das Interesse am Studium des politischen Denkens kann prinzipiell von zwei Gesichtspunkten geleitet sein. Einerseits wird versucht, geistige Standpunkte in den jeweiligen politischen Konstellationen und theoretischen Debatten ihrer Zeit einzuordnen. Politische Theorie wird so ausschließlich zur Geschichte politischen Denkens. Andererseits ist es möglich, direkt nach der Relevanz einer Position für die theoretische Diskussion der Gegenwart zu fragen. Das erste Vorgehen ist rein historisch interessiert, das zweite dagegen strebt danach, die Ansichten vergangener Denker als anregende Diskussionsbeiträge anzusehen. Die Anregung mag sich dabei entweder in einer Übernahme einzelner Theoriebausteine äußern oder aber in der Ablehnung des gesamten Gedankenkomplexes, indem versucht wird, eine Gegenposition zu entwickeln. Doch worauf, wenn nicht auf vergangenen Positionen, soll man seine Argumentation stützen, falls man an Aufbau und Weiterentwicklung systematischer Theoriebildung interessiert ist?
Auch der Beitrag von Carl Schmitt kann unter Betrachtung der beiden o.g. Gesichtspunkte für die politische Theorieforschung gleichermaßen anregend sein.
Denn wie kaum ein anderer politischer Denker des 20. Jahrhunderts hat die Person Carl Schmitt eine solche Polarisierung der Meinungen und Ansichten bewirkt. Dabei geht es weniger um die adäquate Einordnung seiner Tätigkeit unter ein bestimmtes Berufsfeld1 als vielmehr um die korrekte Dechiffrierung seiner Schriften aus vier Epochen deutscher Staatsgeschichte und deren Nachwirkungen für die bundesrepublikanische Wirklichkeit. Seine Arbeiten zur Zeit des Kaiserreichs, der Weimarer Republik, des nationalsozialistischen Deutschlands sowie der Bundesrepublik trugen und tragen stets ausreichend Zündstoff für teils hitzige grundsatzpolitische Kontroversen in sich.2 Eindeutige Interpretationen scheinen so gut wie unmöglich, nicht zuletzt bedingt durch die zahlreichen Selbstdarstellungen und -charakterisierungen Schmitts nach 1945.3 Besondere Aufmerksamkeit verdienen im Zuge der wissenschaftlichen Bearbeitungen seine Abhandlungen in der Periode von Weimar und Hitler-Deutschland, wobei durch Erstere eine wirklich grundlegende theoretische Kritik an der gesamten Weimarer Staatsauffassung angebracht worden ist.
Einigkeit herrscht hingegen in der Ansicht über Carl Schmitt als eines blendenden Rhetorikers, der es wie kein Zweiter verstand, mit einer scheinbar rationalen Analyse und durch Rückgriffe auf prägnante Formulierungen den uninformierten Leser von der Folgerichtigkeit seiner Gedankenmodelle zu überzeugen.4 Von Modellen als solchen Sinn zu sprechen ist jedoch insofern fehlerhaft, da Carl Schmitt nie ein eigenständiges Theoriegebäude entworfen hat. Seine meist kritischen Abhandlungen sind eher okkasionell zu verstehen, d.h. mit dem historisch-politischen Kontext verbunden. Nicht selten wird ihm außerdem vorgeworfen, sich allzu opportunistisch verhalten zu haben, gerade zur Zeit des Nationalsozialismus.5
Es wird nun also allgemein darauf ankommen - und das gilt nicht nur bei der Betrachtung Carl Schmitts, wenn auch dort im Besonderen -, wissenschaftlichobjektiv an die Deutung dieser Themen der Zeit heranzugehen, um politischen Denkern und auch ihren Werken die rechtmäßige Würdigung zukommen zu lassen.
Die vorliegende Arbeit möchte nun, getreu der gerade erwähnten Prinzipien, Carl Schmitts umfassende Anmerkungen, Becker spricht hierbei auch von Gegenwartsdiagnose6, zur Situation der Weimarer Republik darstellen, seine alternativen Entwürfe näher beleuchten sowie deren Relevanz für unsere bundesdeutsche Gegenwart anhand von Beispielen erörtern.
Zunächst sollen die grundlegenden Charakteristika der Schmittschen Kritik7 an der Weimarer Republik dargelegt werden. Dem beschreibenden ist ein wertender Teil nachgestellt, in dem die Grenzen seines staatstheoretischen Entwurfs verdeutlicht werden sollen.
Es dürfte zum Verständnis seiner Aussagen zunächst erforderlich sein, die Methode seines dezisionistischen Denkens zu verdeutlichen. Daran schließt sich seine Analyse des parlamentarischen Systems und dessen angeblichen Verfallsprozess im Zusammenhang mit liberalen Konstitutionsformen an. Schmitts Demokratieverständnis, das sich ganz offensichtlich an der Rousseauschen Vorstellung orientiert hat, bildet in seiner Gegensatzfunktion zum Parlamentarismus den weiteren Betrachtungskomplex, der seinen Abschluss in der Darstellung des politischen Freund-Feind-Verhältnisses findet.
Der analytische und interpretierende Abschnitt wird sich daraufhin bemühen, durch Erörterung dieser Alternativen, Grenzen seines staatstheoretischen Entwurfs aufzuzeigen und die praktische Relevanz für die heutige politische Wissenschaft herauszuarbeiten, wobei bereits erwähnt werden darf, dass sich angesichts dieses Punktes ein breites Meinungsspektrum herausgebildet hat.
Auf einen definitorischen Grundlagenteil sei in dieser Arbeit verzichtet. Notwendige Definitionen, in denen Begriffe und Kriterien des Autors umrissen sind, werden zu gegebenem Zeitpunkt angeführt, um wesentlichen Aussagen nicht unnötigerweise vorzugreifen.
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Der „klassische“ (anti-liberale) Dezisionismus
8 Für Schmitt ist das Zeitalter des Nihilismus und der Technizität gegenwärtig. Die Moderne ist geprägt durch einen Transzendenzverlust, durch den Kampf des Geistes gegen die vorrückende Welt von Materialismus und Kapital, von Technik und Ökonomie.9 Ob sich dadurch auf seine konservativ-katholische Herkunft10 schließen lässt, wird in dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt.11
Der Dezisionismus, der sich vom Lateinischen decisio = Abkommen, Entscheidung ableitet, fungiert hier praktisch als Therapie dieses Zustandes. Er ist ein dem liberalen Normativismus oder Gesetzesdenken entgegengerichtetes Entscheidungsdenken, für das nicht eine vorgegebene Ordnung, sondern das unbedingte Wollen maßgebend ist, das sich außerdem nicht an der dem Liberalismus eigentümlichen Grundsatzvernunft, sondern an der normungebundenen Gelegenheitsvernunft orientiert.12 Schmitt kommt es nicht darauf an, was von wem oder besser gesagt, wie entschieden wird, sondern dass überhaupt entschieden wird. „Entscheidung war [...] besser als Nicht-Entscheidung. Dezision besser als Diskussion. Dezision oder Diskussion - das wurde für ihn zu einer variierbaren Antithetik, die seine Gegnerschaft gegen Romantik und bürgerliche Politik ebenso umfaßte wie sein eigentümliches Interesse an der Diktatur, und wenn das eine Diskussion war ohne Dezision (Romantik und Liberalismus), so war das andere Dezision ohne Diskussion (Diktatur).“13 Zeigt sich nun also hierin eine prinzipielle, eventuell sozialisationsbedingte, Zuneigung Schmitts zu diktatorischen Strukturen respektive das „Resultat einer romantischen Neigung für das Paradoxon“14 oder drückt dies nicht doch eher sein Bedürfnis nach innerstaatlicher Ordnung15, quasi als Mittel zum Zweck, aus?
Zweifelsohne wird seine dezisionistische Orientierung deutlich in der Formulierung: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“16 Der Souverän, der das Entscheidungsmonopol inne hat, besitzt auch das Recht, die gesamte bestehende Ordnung zu suspendieren, womit wohl nicht die Abschaffung der Verfassung gemeint sein kann, sondern lediglich die zu ihrer Ausführung erlassenen gesetzlichen Normierungen, sofern diese die Verfassung bedrohen.17 Die Diktatur, zu der wir Schmitt bereits eine besondere Zuneigung bescheinigt haben, übernimmt nun im Falle des Ausnahmezustandes die Rolle des Souveräns, da in ihr allein die Möglichkeit zur endgültigen faktischen Entscheidung liegt. Die konkrete Ausnahme wirkt hierbei gewissermaßen als „Ermächtigung einer höchsten Autorität“18, legitimiert sozusagen die Negation des Rechts zwecks Rechtsverwirklichung. Rhonheimer legt in diesem Zusammenhang Wert darauf, dass die Genese von Schmitts Denken seine Ausformung durch den leninistischen Diktaturbegriff erhalten habe und keineswegs auf den Nationalsozialismus zurückzuführen sei.19 Eben dieser Unterscheidung entspringe die eigentliche Bedeutung der Diktatur als eine Art Auftragshandeln, sozusagen als kommissarische Diktatur, und nicht der formalen Gleichsetzung mit Despotie. Entscheidungsbevollmächtigt solle ein starker Führer sein, im konkreten Falle der Weimarer Republik die Person des Reichspräsidenten, der „ein Gegengewicht gegen den Pluralismus sozialer und wirtschaftlicher Machtgruppen zu bilden und die Einheit des Volkes als eines politischen Ganzen zu wahren“20 habe.
Carl Schmitts beinahe radikal anmutende dezisionistische Argumentation muss daher stets im Kontext seines entschiedenen Kampfes gegen Parlamentarismus und Liberalismus gesehen werden, die durch ihren nation- und staatsauflösenden Charakter die politische Integration und die Errichtung einer staatlichen Ordnung unmöglich machen21, denn „Politik ist die Notwendigkeit kollektiv bindenden Entscheidens bei nicht vorauszusetzendem Konsens. [...] Die letzte Entscheidungsinstanz beendet die antagonistischen Konflikte von Akteuren und ihren divergierenden Normvorstellungen autoritativ; sie ist die überlegene politische Herrschaft bzw. die rechts- und verfassungsgebende Macht.“22
2.2 Parlamentarismus- und Liberalismuskritik
Schmitts Essay zur geistesgeschichtlichen Lage des heutigen, eindeutig der Beginn seines antiparlamentarischen und antidemokratischen Bekenntnisses, erschien im Sommer 1923, bereits vier Jahre nach Deutschlands ersten parlamentarischen Gehversuchen. Immer wieder drohte die junge Weimarer Republik durch bürgerkriegsähnliche Aufstände der linken und Putschversuche der rechten Gegner der Demokratie auseinanderzubrechen. Die Besetzung des Rheinlandes durch Frankreich sowie der totale Zusammenbruch der Währung einerseits, die Versuche von Separatisten, das Rheinland unter dem Schutz der Besatzungsmacht aus dem Reichsverband zu lösen, die kommunistischen Aufstände in Sachsen und Thüringen und der Konflikt des Freistaates Bayern mit der Reichsregierung andererseits23, stürzten den Staat in seine gefährlichste Existenzkrise. Schmitt warf dem Weimarer Parlamentarismus vor, in dieser Zeit politischer und sozialer Kämpfe nicht in der Lage zu sein, die (politisch) notwendigen Entscheidungen zu treffen.24
Was den idealtypischen Parlamentarismus seiner Meinung nach noch im 19. Jahrhundert auszeichnete, waren seine konstituierenden Strukturprinzipien Diskussion und Öffentlichkeit.25 In Verbindung mit der freien Meinungsäußerung sah er in diesen das brauchbarste Mittel, das politisch Richtige, die politische Wahrheit zu finden26, denn „die ratio des Parlaments liegt [...] in einem Prozeß der Auseinandersetzung von Gegensätzen und Meinungen, aus dem sich der richtige staatliche Wille als Resultat ergibt. Das Wesentliche des Parlaments ist also öffentliches Verhandeln von Argument und Gegenargument, öffentliche Debatte und öffentliche Diskussion [...].“27
Doch eben diese Prinzipien sieht Schmitt im modernen Parlamentarismus der Weimarer Republik zu einer „leeren Formalität“ verkommen. Die Öffentlichkeit (der Diskussionen) sei abgelöst von einer neuen Geheimpolitik der Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, die Diskussion ersetzt durch die auf Macht gerichtete Parteipolitik. Propaganda und Techniken der Massenbeeinflussung treten an die Stelle der freien Meinungskonkurrenz. Als letzte Konsequenz verliere somit das Parlament seine geistige Basis und seinen eigentlichen Sinn28,29, der mitunter auch in der Kontrolle der monarchistischen Regierungen ruhe. Idealtypisch liege die Aufgabe des Parlaments in der Gesetzgebung, da zu dieser nun einmal Deliberation, also Beratschlagung, zwingend notwendig sei. Die Exekutive, bei der es vordringlich auf energisches Handeln ankomme, müsse sich dahingegen - wie bereits erwähnt - in der Hand einer Person befinden. Hier sei die „Einheit der Dezision“ gefordert/erforderlich.30
Das Parlament in der modernen Massendemokratie sei allerdings ein Ort, an dem „weisungsgebundene Parteiangestellte bereits getroffene Entscheidungen registrieren lassen. In diesem System [...] sind Parteien verfestigte oligarchische Apparate und in den Verhandlungen geht es nicht um das Gemeinwohl, sondern um Kompromisse auf der Basis von Machtkonstellationen.“31 Moderne Massendemokratie bedeutet für Schmitt ein heterogen zusammengesetztes Gebilde aus sich weltanschaulich scharf voneinander abgrenzenden Massenparteien. Die gewählte Volksvertretung sei jedoch nicht in der Lage, mit diesem sozialen Pluralismus fertig zu werden.32
Ottmann33 weist - m.E. mit Recht - auf Schmitts zu scharfe Trennung von Idee und Realität hin, welche selbst im goldenen Zeitalter des englischen Parlamentarismus des 19. Jahrhunderts keineswegs dem Modell reinrationaler Diskussion entsprochen habe. Vielmehr ignoriere Schmitt evidente Attribute des parlamentarischen Systems.34
Nahezu parallel zur offenen Polemik gegenüber dem Parlamentarismus Weimarer Prägung verläuft seine Kritik am Liberalismus. Liberalismus ist für Schmitt die Denaturierung aller politischen Vorstellungen, soll heißen, die Fortsetzung der Politik unter einem anderen Namen.35 Dabei gebe es keine liberale Politik an sich, sondern lediglich eine liberale Kritik der Politik, die ausschließlich auf die Sicherung der individuellen Freiheit und auf deren ungestörte Nutzung ausgerichtet sei.36 Hansen will in diesem Zusammenhang eine durchaus liberale Haltung Schmitts erkannt haben, wenn auch nur auf ökonomischer Ebene, denn „pro-wirtschaftsliberal [sei] seine unbedingte Verteidigung der bürgerlichen Eigentumsordnung, die in der freien Verfügung des individuellen Wirtschaftsubjekts über das Privateigentum und der staatlich-rechtlich garantierten Sicherheit dieser Verfügung besteht.“37 Davon abgesehen steht er doch in der Tradition der gängigen wissenschaftlichen Meinung über Schmitt als des berühmt-berüchtigten Anti-Liberalen.38
2.3 Demokratieverständnis
Hinter der Kritik Schmitts an den offensichtlichen Mängeln Weimars wird nun ein Wunschbild sichtbar, dass einen starken Staat skizziert, der in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und sie auch durchzusetzen, der über den verschiedenen Gesellschaftsgruppen steht und sich nicht ihnen hingibt. Diese Art des Staates zeichnet sich aus durch die Identität von Regierenden und Regierten.39 „Jede wirkliche Demokratie“ - so heißt es bei ihm - „beruht darauf, daß nicht nur Gleiches gleich, sondern, mit unvermeidlicher Konsequenz, das Nichtgleiche nicht gleich behandelt wird. Zur Demokratie gehört also notwendig erstens Homogenität und zweitens - nötigenfalls - die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen.“40 Homogenität könne also durch friedliche Angleichung oder gewaltsame Unterdrückung erreicht werden.
Greift man nun Schmitts Definition der modernen Massendemokratie als ein heterogen zusammengesetztes Gebilde noch einmal auf41, so impliziert dies doch eine deutliche Ablehnung pluralistischer Tendenzen, die durch das liberale Prinzip der Freiheit nur noch verstärkt würden. „Es ist [gewissermaßen] der in seiner Tiefe unüberwindliche Gegensatz von liberalem Einzelmensch-Bewußtsein und demokratischer Homogenität.“42 Die in der Literatur zur Erreichung und Stabilisierung einer demokratischen Staats- und Regierungsform für gewöhnlich als gleichberechtigt angesehenen Grundsätze Freiheit und Gleichheit verlagert Schmitt auf unterschiedliche Bedeutungs-/Einflussebenen. Die Gleichheit sei für ihn das alleinige, innenpolitisch konstitutive Element43, die Basis der demokratischen Identität von Volk und Regierung. Er definiert Identität nicht als etwas vollkommen Gleiches, sondern möchte diese einfach als Identifikation [mit beispielsweise direktdemokratischen Einrichtungen oder auch gemeinsamer Sprache und Geschichte; Anm. des Verfassers] verstanden wissen.44
Zieht man nun die logische Konsequenz aus diesen Ausführungen, so kommt man zu dem Ergebnis, dass Schmitt die Demokratie primär als Staatsform und nicht als Methode begreift. Dies ist für die weitere Betrachtung insofern von Bedeutung, da Schmitts identitärer Demokratiebegriff direkt mit seinen Erörterungen zum Wesen des Politischen in Beziehung steht.
2.4 Das Wesen des Politischen
Ohne politische Homogenität ist nämlich auch die Unterscheidung von Freund und Feind nicht möglich. Und gerade dieses Freund-Feind-Verhältnis bilde - so Schmitt - den Kern der Politik, die sich aus den unterschiedlichsten Beziehungen unter den Menschen zusammensetze. Sie stehe dabei selbständig etwa neben der Unterscheidung von Gut und Böse in der Moral, von schön und hässlich in der Ästhetik oder von rentabel und unrentabel im Ökonomischen.45 Die Trennung von Freund und Feind, die nicht mit einer jener anderen Gegensätze verwechselt oder vermengt werden darf, „hat den Sinn, den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung, einer Assoziation oder Dissoziation zu bezeichnen.“46 Der politische Feind braucht also nicht unbedingt moralisch böse, ästhetisch hässlich oder ein wirtschaftlicher Konkurrent zu sein. Ferner wird er nicht nur vom Konkurrenten, sondern auch vom privaten Gegner unterschieden: „Feind ist nur eine wenigstens eventuell, d.h. der realen Möglichkeit nach kämpfende Gesamtheit von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht. Feind ist nur der öffentliche Feind [...]. Feind ist hostis, nicht inimicus im weiteren Sinne.“47 Zum Begriff des Feindes gehört also „die im Bereich des Realen liegende Eventualität eines Kampfes [...] und die Begriffe Freund, Feind und Kampf erhalten ihren realen Sinn [erst] dadurch, daß sie insbesondere auf die reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben und behalten.“48
Schmitt zufolge verlangt also die politische Einheit gegebenenfalls das Opfer des Lebens. Der Liberalismus indes leugne diesen Ernstfall, von dem aus sich allein das Wesen des Politischen bestimmen lasse. Er sei im Fall eines Angriffs auf die eigene politische Einheit nicht in der Lage, Freund und Feind voneinander zu unterscheiden und den Angreifer zu vernichten. „Für den Individualismus des liberalen Denkens [, in dessen Zentrum ja der Schutz und die Freiheit des Individuums stehen,] ist dieser Anspruch auf keine Weise zu erreichen und zu begründen. Ein Individualismus, der einem andern als dem Individuum selbst die Verfügung über das physische Leben dieses Individuums gibt, wäre ebenso eine leere Phrase wie eine liberale Freiheit, bei der ein Anderer als der Freie selbst über ihren Inhalt und ihr Maß entscheidet.“49 Dadurch wird die Freund-Feind-Polarität durch den Liberalismus in eine universelle Partnerschaft zwischen wirtschaftlichen Konkurrenten und ideologischen Gegnern aufgelöst.50 Demzufolge dürfte es auf ökonomischer Ebene keine Feinde, sondern lediglich Konkurrenten geben. Schmitt betont jedoch, dass aus jedem beliebigen Sachgebiet, sei es nun aus Wirtschaft, Religion oder Moral, der spezifische Punkt des Politischen erwachsen könne, vorausgesetzt, der Gegensatz sei fähig, die Menschen nach Freund und Feind eindeutig zu gruppieren.51 Auch Karl Marx, der den Konflikt rein ökonomisch betrachte, irre in seiner Annahme. Sobald nämlich der Klassengegner als Feind erfasst werde, ändere sich die vorher rein ökonomische Bedeutung des Klassenkampfes zu einer von politischem Belang.52
3. Grenzen seines staatstheoretischen Entwurfs
Einwände an und Widerlegungen von Schmitts staatstechnischen Ideen möchte ich nur exemplarisch vornehmen. Die Fülle möglicher Ansatzpunkte und ihre detaillierten Ausführungen würden andernfalls den Rahmen dieser Arbeit zu sehr übersteigen.53
Für Schmitt steht fest, dass „[...] aus dem reinen und konsequenten Begriff des individualistischen Liberalismus [keine] spezifisch politische Idee gewonnen werden kann. [...] Denn die Negation des Politischen, die in jedem konsequenten Individualismus enthalten ist, führt wohl zu einer politischen Praxis des Mißtrauens gegen alle denkbaren politischen Mächte und Staatsformen, niemals aber zu einer eigenen positiven Theorie von Staat und Politik. Es gibt infolgedessen [...] keine liberale Politik schlechthin, sondern immer nur eine liberale Kritik der Politik.“54 Das jedoch ist zu bezweifeln. Der Liberalismus ist keineswegs wesentlich apolitisch. Viele liberale Staaten haben in der Vergangenheit eindrucksvoll ihre Stärke und Handlungsfähigkeit demonstriert. Erinnert sei dabei nur an Verlauf und Ausgang des Zweiten Weltkrieges, in dem die liberalen Staaten sehr wohl zwischen Freund und Feind unterscheiden konnten und offensichtlich in der Lage waren, ihren Gegner zu besiegen. Schmitts These eines blinden und handlungsunfähigen Liberalismus, der niemals in der Lage sei, inner- und außerstaatliche Gefahren zu erkennen, ist also nicht haltbar. Außerdem können scheinbar ausweglose politische Situationen durchaus mithilfe von Kompromissen gelöst werden, nicht immer braucht es dazu eine autoritäre Entscheidung.
Überhaupt ist sein Dezisionismuskonzept auch in anderer Hinsicht mehr als fraglich. Zu glauben, der Souverän - im konkreten Falle Weimars der Reichspräsident - sei in seinen Entscheidungen stets auf das Wohl und die Sicherheit des Volkes bedacht, ist schlichtweg naiv. Wäre es einem Reichspräsidenten mit diktatorischen Befugnissen denn nicht möglich gewesen, anstatt als Hüter der Verfassung aufzutreten, einen Reichskanzler zu ernennen, der nicht anderes im Sinn hat als die Beseitigung der Verfassung? Und steht diese Naivität nicht im Widerspruch zu Schmitts machiavellisch anmutenden Menschenbild, wenn er schreibt, dass „alle echten politischen Theorien den Menschen als „böse“ voraussetzen, d.h. als keineswegs unproblematisches, sondern als „gefährliches“ und dynamisches Wesen betrachten.“55 Auch hier beweist wieder die Erfahrung des Dritten Reiches, welch fatale Folgen unbegrenzte Macht in den falschen Händen haben kann.
Bezüglich des Parlamentarismuskonzeptes zeigt Sternberger deutlich, dass das angebliche Strukturprinzip der Öffentlichkeit keineswegs ein wesentliches Element des idealtypischen Parlamentarismus darstelle. Die Forderung nach dessen Realisierung sei erst Ende des 18. Jahrhunderts erhoben worden. Zudem fänden sich bereits bei Jonathan Swift Belege über vorher getroffene Absprachen unter den Parlamentsabgeordneten, und das zur Zeit des von Schmitt so gepriesenen britischen Parlamentarismus.56 Außerdem spricht Carl Schmitt von der Krise des Parlamentarismus57, macht seine Argumentation jedoch nur an der Situation des deutschen Parlaments fest. Dadurch, dass er bei seinem Nachweis auf französische und auch englische [Burke, Bentham, Guizot oder auch Mill] Staatsphilosophen zurückgreift, möchte er - so Sternberger - den Eindruck erwecken, dass die „eigenen nationalen Krisen [...] das Elend der [gesamten] Welt“58 widerspiegeln.
Auch in der Betrachtung seines Demokratiebegriffs tun sich mancherlei gedanklich- logische Abgründe auf. Denn einerseits muss man eine politisch vollkommen homogene Gesellschaft zwangsläufig als totalitär bezeichnen59, indem durch die radikale Praktizierung der Gleichheit die politische Freiheit und damit die Demokratie zerstört wird. Andererseits ist es wohl schwerlich möglich, durch die Vernichtung des Feindes, der ja erst durch die Einheitlichkeit der Nation erkannt wird, alle Probleme ein für allemal zu lösen.60 Carl Schmitt benötigt diesen Homogenitätsbegriff anscheinend nur, um seinem Wesen des Politischen die notwendige Grundlage zu verschaffen.61 Doch nicht nur der Homogenitätsbegriff soll hier kritisch beleuchtet werden, sondern auch die identitäre Demokratievorstellung. Klar dürfte sein, dass dieses Modell in modernen, bevölkerungsreichen Staaten zum Scheitern verurteilt wäre. Robert Leicht62 stimmt mit Schmitt in dem Punkt überein, dass es wirklich die Aufgabe einer jeden politischen Ordnung sei, möglichst viele Bürgerwillen zu einem einzigen politischen Willen zusammenzufassen. Interessenaggregation ist schließlich eines der Hauptelemente eines politischen Systems. Doch warnt er davor, die Pluralität und Polarität der Meinungen einzuschränken, da gerade diese das Wesen einer Demokratie ausmachten.
Aus dieser Pluralität der Meinungen lässt sich außerdem die heute wohl gängige Ansicht über das allgemein politische Handeln ableiten. Versteht man unter Politik denn nicht „Maßnahmen zur Führung, Erhaltung und Verwaltung eines Gemeinwesens“63 anstatt Kampf zur Überwindung von Feindschaft oder, notfalls, zur Beseitigung des Feindes? M.E. liegt in Schmitts Begriff des Politischen eine eindeutige Verengung seiner Sichtweise vor. Lässt sich das Wesen des Politischen denn wirklich erst vom Extremfall her erklären? Ist Politik nicht durch das Bemühen gekennzeichnet, sinnvolle und sachgerechte Lösungen von Regelungs- und Gestaltungsfragen zu erarbeiten? Kurios auch, dass Schmitt den Kampf, der die Ordnung und den Frieden im Staat gefährdet, zur Basis des politischen Denkens erklärt. Welche verhängnisvollen Konsequenzen es haben kann, wenn die Möglichkeit eines Kampfes auf Leben und Tod für das Politische konstitutiv wird und gleichzeitig jeder Beliebige zum Feind erklärt werden kann, lässt sich sicherlich leicht erahnen.
4. Brauchen wir diesen Carl Schmitt?
Wie bereits angedeutet, rufen Carl Schmitts staatsrechtliche und politische Werke heutzutage in den unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen mal mehr, mal weniger deutliche Resonanz hervor. Man schwankt zwischen totaler Ablehnung und grenzenloser Verherrlichung. Die Deutung seiner Ideen ist genauso umstritten wie sein gesamtes übriges Werk. Im Hinblick auf die Unsäglichen, die Schmitt während der NS-Zeit geäußert hat64, muss wohl, um ihm eine gerechte Würdigung zukommen zu lassen, zwischen Person und Werk strikt getrennt werden. Daher wird sich meine Betrachtung ausschließlich auf Schmitts Wirken in der Weimarer Zeit beziehen.
Worin liegen also die Gründe seiner starken Ausstrahlung auf die Politikwissenschaft, die Staatsrechtslehre und die Sozialphilosophie?
Zum einen war es wohl seine Fähigkeit, die jeweilige politische Situation, den Zeitgeist, ausfindig zu machen und ihn mit präzisen Begriffen verständlich zu vermitteln. Seine „sprachliche Brillanz“65 wird dabei nicht nur von seinen Anhängern geschätzt.
Eine zweite, damit bereits angedeutete Qualität seiner Texte beruht auf seiner außergewöhnlich einprägsamen Formulierungsgabe. Selbst jene Äußerungen, die seine Kritiker heute als üble geistige Entgleisungen ansehen66, sind meist in einer solchen Scheinklarheit verfasst, dass sie den Leser aus seiner schemenhaften Erkenntnislosigkeit zur angeblichen Erleuchtung zu führen scheinen.
Man könnte also insgesamt von einer besonders ungewöhnlichen Ausstrahlung seiner Texte aus der Weimarer Zeit sprechen, deren ästhetische Qualität im deutschsprachigen Raum sicherlich nur von wenigen wissenschaftlichen Autoren erreicht wurde.
An diesem Punkt nun kommt es zur Aufspaltung seiner Leserschaft. Allgemein wird in der Wissenschaft demnach zwischen Rechts- bzw. Links-Schmittianismus und Schmittianismus der Mitte unterschieden.67 Kennedy warf 1986 der „Frankfurter Schule“ um Habermas, Benjamin und Kirchheimer vor, bewusst Theoriefragmente Schmitts übernommen zu haben. „Es waren [...] vielmehr die gemeinsame Abneigung gegenüber dem Liberalismus und die Skepsis gegenüber liberaler Demokratie - als negative Gemeinsamkeiten -, die das Interesse dieser Theoretiker an Schmitts politischer und juristischer Theorie weckten.“68 Becker weist jedoch darauf hin, dass bei Habermas zu keiner Zeit von Links-Schmittianismus gesprochen werden darf.69 Schmitt-Rezeptionen durch die Linken sah Wieland insbesondere durch deren Anti-Parlamentarismus und Anti-Positivismus bestätigt.70 Man versprach sich sogar eine Renaissance Marxistischer Denkweisen71. Trotz seines wohl offensichtlichen Illiberalismus wurde sogar der Versuch unternommen, Teile von Schmitts Werk in liberalem Sinn zu interpretieren.72
Ungeachtet seines Einflusses auf die politische Philosophie, ist es doch die praktische Relevanz Schmittscher Theoreme, die für uns von besonderem Interesse ist. Ganz eindeutig, das wird auch so von der Wissenschaft bestätigt, richten sich grundlegende Elemente des deutschen Grundgesetzes an Schmitts Lehren aus. Mit dem Prinzip der Streitbaren Demokratie73 zog man die Konsequenzen aus dem Scheitern der Weimarer Republik.
Schmitts Begriff des Politischen mit der Freund-Feind-Polarität im Zentrum hat, wenn auch nicht in seiner radikalsten Ausprägung, bis heute seine Bedeutung nicht verloren. Waren es während des Kalten Krieges die beiden ideologischen Machtblöcke der USA und der UDSSR, die sich einander feindlich gegenüberstanden, so sind es heute die demokratischen Staaten unter Führung der USA im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Die einzig mögliche Wahl, die sich einer Nation damals wie heute bietet, ist die zwischen Freund und Feind. Zudem sollte diese Unterscheidung in abgeschwächter Form auch in der liberalen Demokratie gelten, will sie ihre politischen Gegner nicht unbehelligt an ihrer Zerstörung arbeiten lassen.
Wenn auch sicherlich nicht alle möglichen Bezugspunkte erläutert wurden, so verdeutlicht diese Auswahl die doch auffällige Relevanz des Schmittschen Gedankenkomplexes für die heutige nationale wie internationale Wissenschaft wie für die Gesellschaft überhaupt.
Wie klar geworden sein dürfte, lebt die Person Carl Schmitt mitten unter uns weiter. Sowohl offenkundig als auch im Verborgenen. Mit seinen Arbeiten hat er unmittelbar unsere bundesdeutsche Gegenwart mitgeprägt.
5. Schlussbemerkung
Abschließend bleibt wohl festzuhalten: Schmitts Antiliberalismus „wurzelt [...] juristisch im Dezisionismus, politisch im Etatismus, und sein gesellschaftliches Ideal ist die geeinte Nation.“74 Zur Erinnerung: Was man prinzipiell bei der Beschäftigung mit politischer Theorie nicht vergessen sollte, gilt für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Schmitt im Besonderen: die Beachtung des historischen Kontextes und auch der persönlichen Denkprägungen, die seine Sichtweise und Resultate beeinflusst haben können.
Seine Kritik am Liberalismus, respektive am Parlamentarismus, scheint bisweilen durchaus zu überzeugen, doch bei genauerer Betrachtung wird deutlich, wie extrem einseitig Schmitt argumentiert, und es stellen sich Fragen wie: Kann man das Wesen des Politischen wirklich vom Extremfall her erklären? Ist es nicht überaus naiv, einem einzelnem politischen Führer oder einer Führungsgruppe eine nahezu unbegrenzte Macht zuzusprechen? Ferner: Haben seine Schriften nicht wesentlich dazu beigetragen, den moralischen Nährboden für den nationalsozialistischen Staat erst zu schaffen, und dienten sie später nicht einfach dazu, begangenes oder noch zu begehendes Unrecht zu legitimieren?75
Diese Überzeugung ist durchaus berechtigt und in der politischen Wissenschaft bis heute weit verbreitet. Symptomatisch dafür schrieb Kurt Sontheimer: „Mag er später bei den Nazis auch nicht mehr im hellen Lichte obrigkeitlicher Gunst gestanden haben, so ist doch nichts bekannt, was es uns erlaubte, in Carl Schmitt etwas anderes zu sehen als einen geistigen Wegbereiter, juristischen Verteidiger und Mitläufer der nationalsozialistischen Diktatur.“76 Richtet man den Blick jedoch ausschließlich auf diesen Aspekt seines Werkes, begeht man den gleichen Fehler der Schmitt so häufig vorgeworfenen perspektivischen Verengung77, denn es können durchaus „Großartiges, Randständiges und Unbegreifliches [...] zur gleichen Zeit in einem Kopf wohnen.“78 Und so schmälert denn auch seine (zwar unbestreitbare) wissenschaftliche Unterstützung des Nationalsozialismus seine Bedeutung etwa für die deutsche Verfassungs- und Staatsrechtlehre keineswegs. Auch Carl Schmitt sollte man, will man auf den Gewinn so mancher nützlicher Erkenntnisse nicht verzichten, vorurteilsfrei „die Gerechtigkeit einer angemessenen Auseinandersetzung widerfahren [...] lassen.“79
[...]
1 Ob er nun Jurist (Staatsrechtler, Völkerrechtler), Staatsphilosoph, Politikwissenschaftler, „Reichstheologe“ oder gar „Katechon“, also Aufhalter, war, lässt sich nicht eindeutig klären und bleibt weiterhin Interpretationssache. Für den weiteren Verlauf der Arbeit ist dies jedoch nicht von Belang.
2 Siehe z.B. Hasso Hofmann: Carl Schmitt oder: Die eigene Frage als Gestalt, Würzburg 1985, S. 65f., vgl. auch die dortigen Hinweise auf J.W. Bendersky: Theorist for the Reich, Princeton 1983.
3 Vgl. Kurt Sontheimer: Carl Schmitt. Seine Loyalität gegenüber der Weimarer Verfassung, in: Neue politische Literatur. Berichte über das internationale Schrifttum, 3 (1958), S. 757f und Vittorio Hösle: Carl Schmitts Kritik an der Selbstaufhebung einer wertneutralen Verfassung in Legalit ä t und Legitimit ä t, in: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 61 (1987), S. 2.
4 Vgl. Henning Ottmann: Carl Schmitt, in: Ballestrem, Karl Graf/Ottmann, Henning (Hrsg.): Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts, München 1990, S. 61f.
5 Vgl. u.a. ders., S. 73. Dagegen argumentiert Günther Krauss: Carl Schmitt und die Weimarer Reichsverfassung. Eine Betrachtung zum 11. Juli 1953, in: Piet Tommissen: Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Band V, Berlin 1996, S. 316ff.
6 Vgl. Hartmuth Becker: Die Parlamentarismuskritik bei Carl Schmitt und Jürgen Habermas, Beiträge zur politischen Wissenschaft Bd. 74, Berlin 1994, S. 18.
7 Der Begriff der Kritik wurde hier ganz bewusst gewählt:
8 Diese Bezeichnung gebraucht Christian Schwaabe, um den Dezisionismusbegriff Schmittscher Prägung von denen Derridas und Lübbes abzugrenzen (Vgl. Christian Schwaabe: Liberalismus und Dezisionismus. Zur Rehabilitierung eines liberalen Dezisionismus im Anschluss an Carl Schmitt, Jacques Derrida und Hermann Lübbe, in: Politisches Denken, Jahrbuch 2001, S. 177).
9 Vgl. Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, Text von 1932, Berlin 1979, S. 79ff. Zitierweise: Der Begriff des Politischen.
10 Vgl. Piet Tommissen: Neue Bausteine zu einer Biographie Carl Schmitts, in: Ders. (Hrsg.): Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, 5 (1996), S. 152f.
11 Verwiesen sei hierbei aber auf die Ausführungen nach Rüthers oder Koenen, die von einer mehr oder weniger theologisch geprägten Geistesstruktur Schmitts ausgehen (Vgl. Bernd Rüthers: Carl Schmitt als politischer Denker, in: Die Neue Ordnung, Jahrgang 54, Jahresverzeichnis 2000, S. 438f. und Andreas Koenen: Der Fall Carl Schmitt. Sein Aufstieg zum "Kronjuristen des Dritten Reiches", Darmstadt 1995. Zitiert nach Kurt Sontheimer: Schlüsselfigur der Konservativen Revolution. Der Fall Carl Schmitt, in: DIE ZEIT, 13.10.1995, Rubrik „POLITISCHES BUCH“, ohne Seitenangabe).
12 Vgl. dazu beispielsweise Klaus Hansen: Feindberührungen mit versöhnlichem Ausgang. Carl Schmitt und der Liberalismus, in: Ders./Lietzmann, Hans J. (Hrsg.): Carl Schmitt und die Liberalismuskritik, Opladen 1988, S. 11f.
13 Henning Ottmann, a.a.O., S. 63.
14 Hartmuth Becker: Die Parlamentarismuskritik bei Carl Schmitt und Jürgen Habermas, Beiträge zur politischen Wissenschaft Bd. 74, Berlin 1994, S. 19.
15 Offenkundig wird in diesem Zusammenhang eine gewisse Parallelität zu Machiavelli.
16 Carl Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin 1979, S. 11. Zitierweise: Politische Theologie.
17 Vgl. Peter Schneider: Ausnahmezustand und Norm, Stuttgart 1957, S. 187. Zitiert nach Hartmuth Becker: Die Parlamentarismuskritik bei Carl Schmitt und Jürgen Habermas, Beiträge zur politischen Wissenschaft Bd. 74, Berlin 1994, S. 19.
18 Carl Schmitt: [Die Diktatur: Suspension des Rechts zwecks Rechtverwirklichung], in: Ders.: Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Berlin 1978, S. XIV-XVIII. Zitiert nach Herfried Münkler (Hrsg.): Politisches Denken im 20. Jahrhundert. Ein Lesebuch, München 1997, S. 221.
19 Vgl. Martin Rhonheimer: „Politisierung“ in der Theorie des totalen Staates (Carl Schmitt), in: Ders. (Hrsg.): Politisierung und Legitimitätsentzug. Totalitäre Kritik an der parlamentarischen Demokratie in Deutschland, Reihe Praktische Philosophie Bd. 8, Freiburg 1979, S. 108.
20 Carl Schmitt: Der Hüter der Verfassung, Berlin 1985, S. 159. Zitierweise: Der Hüter der Verfassung.
21 Vgl. Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, S. 70f.
22 Eckard Bolsinger: Konstitutionsformen des Politischen: Carl Schmitt, in: Lietzmann, Hans J. (Hrsg.): Moderne Politik. Politikverständnisse im 20. Jahrhundert, Opladen 2001, S. 117.
23 Vgl. Ludger Grevelhörster: Kleine Geschichte der Weimarer Republik 1918-1933. Ein problemgeschichtlicher Überblick, Münster 2000, S. 76-96.
24 Vgl. Günter Maschke: Drei Motive im Antiliberalismus Carl Schmitts, in: Hansen, Klaus/Lietzmann, Hans J. (Hrsg.): Carl Schmitt und die Liberalismuskritik, Opladen 1988, S. 63.
25 Vgl. Carl Schmitt: Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Berlin 1985, S. 5. Zitierweise: Parlamentarismus.
26 Vgl. ebd., S. 43.
27 Carl Schmitt: Parlamentarismus, Berlin 1985, S. 43.
28 Vgl. Henning Ottmann, a.a.O., S. 67.
29 Vgl. Carl Schmitt: Parlamentarismus, S. 60 ff.
30 Vgl. ebd., S. 56f.
31 Günter Maschke, a.a.O., S. 63f.
32 Vgl. Carl Schmitt: Parlamentarismus, S. 13f.
33 Vgl. Henning Ottmann, a.a.O., S. 67. Dazu zählt Ottmann Interessenpolitik, Verhandlungen, die sozialtechnische Nützlichkeit, die repräsentative und integrative Funktion der Parlamente.
34 Vgl. ebenso die Ausführungen nach Robert Leicht: Jurist ohne Recht, in: Die Zeit, 25.11.1999, Rubrik „Themen der Zeit“, ohne Seitenangabe, sowie Otto Kirchheimer: Bemerkungen zu Carl Schmitts Legalit ä t und Legitimit ä t, in: Ders.: Von der Weimarer Republik zum Faschismus. Die Auflösung der demokratischen Rechtsordnung, Frankfurt 1976, S. 113.
35 Vgl. Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, S. 70f.
36 Vgl. ebd., S. 69ff.
37 Klaus Hansen: Feindberührungen mit versöhnlichem Ausgang. Carl Schmitt und der Liberalismus, in: Ders./Lietzmann, Hans J. (Hrsg.): Carl Schmitt und die Liberalismuskritik, Opladen 1988, S. 13.
38 Vgl. dazu Ellen Kennedy, a.a.O., S. 381; Claus-Dietrich Wieland: Die Linke und Carl Schmitt, S. 109; Klaus Hansen, a.a.O., S. 9ff.
39 Vgl. Carl Schmitt: Verfassungslehre, Berlin 1989, S. 234. Zitierweise: Verfassungslehre.
40 Carl Schmitt: Parlamentarismus, S. 13f.
41 Vgl. ebd., S. 13f.
42 Vgl. Carl Schmitt: Parlamentarismus, S. 23.
43 Vgl. Carl Schmitt: Verfassungslehre, S. 224f.
44 Vgl. Carl Schmitt: Parlamentarismus, S. 35.
45 Vgl. Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, S. 26f.
46 Ebd., S. 27.
47 Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, S. 29.
48 Ebd., S. 33.
49 Ebd., S. 70.
50 Vgl. Klaus Hansen, a.a.O., S. 10.
51 Vgl. Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, S. 37 und 76.
52 Vgl. ebd., S. 38.
53 Eine ausführliche Bearbeitung dieses Themas liegt bei Hartmuth Becker, a.a.O., S. 52-73, vor.
54 Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, S. 69.
55 Ebd., S. 61.
56 Vgl. Dolf Sternberger: Irrtümer Carl Schmitts. Bemerkungen zu einigen seiner Hauptschriften, in: FAZ, 01.06.1985, Rubrik „Bilder und Zeiten“, ohne Seitenangabe.
57 Vgl. Carl Schmitt: Parlamentarismus, S. 10.
58 Dolf Sternberger, a.a.O., ohne Seitenangabe.
59 Vgl. William Kornhauser: Demokratie in der Massengesellschaft, in: Grube, Frank/Richter Gerhard (Hrsg.): Demokratietheorien. Konzeptionen und Kontroversen, Hamburg 1975, 90ff.
60 Vgl. z.B. das Judentum im Laufe der Geschichte vom Mittelalter bis in die Neuzeit.
61 Vgl. Hasso Hofmann: Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, Berlin 1992, S. 148.
62 Vgl. Robert Leicht, a.a.O., ohne Seitenangabe.
63 Der kleine Duden „Fremdwörterbuch“, Mannheim 1983, S. 327.
64 1934: Rechtfertigung der Röhm-Morde; 1936: Auf der Tagung „Wider den jüdischen Geist“.
65 Michael Stolleis: Carl Schmitt, in: Sattler, Martin J. (Hrsg.): Staat und Recht. Die deutsche Staatslehre im 19. und 20. Jahrhundert, Geschichte des politischen Denkens Bd. 1512, München 1972, S. 123.
66 Vgl. Robert Leicht, a.a.O., ohne Seitenangabe.
67 Bei Ottmann findet sich ein kurzer Verweis auf Vertreter und Werke der jeweiligen Richtung. Vgl. Henning Ottmann, a.a.O., S. 79.
68 Ellen Kennedy, a.a.O., S. 381.
69 Vgl. Hartmuth Becker, a.a.O., S. 161f.
70 Vgl. Claus-Dietrich Wieland: Die Linke und Carl Schmitt, in: Recht und Politik, 21 (1985) 2, S. 110.
71 Vgl. Robert Misik: Carl macht Karl wieder lesenswert, in: TAZ, 25.04.2000, S. 17.
72 Vgl. Hermann Lübbe: Carl Schmitt liberal rezipiert, in: Quaritsch, Helmut (Hrsg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 1988, S.426-440.
73 Wichtige Elemente waren die unveräußerlichen Grundrechte, das konstruktive Misstrauensvotum (Art. 67 GG) oder die Grenzen der verfassungsändernden Gewalt (Art. 79 Abs. 3 GG).
74 Günther Maschke, a.a.O., S. 73.
75 Als Beispiele seien angeführt Der F ü hrer sch ü tzt das Recht (1934), Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den j ü dischen Geist (1936) oder die V ö lkerrechtliche Gro ß raumordnung mit Interventionsverbot f ü r raumfremde M ä chte (1939).
76 Kurt Sontheimer: Der Macht näher als dem Recht. Zum Tode Carl Schmitts, in: Die Zeit, 19.04.1985, S. 7.
77 Vgl. dazu Helmut Quaritsch: Über den Umgang mit Person und Werk Carl Schmitts, in: Ders. (Hrsg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 1988, S. 16, oder Bernd Rüthers, a.a.O., S. 440.
78 Ebd., S. 16f.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Brauchen wir diesen Carl Schmitt?" Zur aktuellen Relevanz Carl Schmitts für Forschung und Gesellschaft?
Die Arbeit untersucht Carl Schmitts Beitrag zur politischen Theorie, insbesondere seine Kritik an der Weimarer Republik, und analysiert seine Relevanz für die gegenwärtige bundesdeutsche politische Wissenschaft und Gesellschaft. Sie beleuchtet seine dezisionistische Philosophie, seine Kritik am Parlamentarismus und Liberalismus, sein Demokratieverständnis und sein Konzept des Politischen.
Was sind die zentralen Themen der Schmittschen Kritik an der Weimarer Republik?
Schmitt kritisiert vor allem den Parlamentarismus und Liberalismus der Weimarer Republik, da diese seiner Meinung nach durch Diskussion und Kompromissfindung die Fähigkeit zu entscheidungsfreudigem Handeln verlieren und somit die politische Ordnung gefährden. Er sieht im Pluralismus und in der Schwächung des Staates durch liberale Prinzipien eine Gefahr für die politische Einheit.
Was versteht Carl Schmitt unter Dezisionismus?
Dezisionismus ist für Schmitt ein Entscheidungsdenken, das sich gegen den liberalen Normativismus richtet. Es betont die Notwendigkeit einer klaren Entscheidung, die nicht unbedingt auf rationalen Gründen, sondern auf der Souveränität des Entscheiders beruhen kann. "Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet" ist eine zentrale Formel seines Denkens.
Wie steht Carl Schmitt zum Parlamentarismus und Liberalismus?
Schmitt ist ein entschiedener Kritiker des Parlamentarismus und Liberalismus. Er argumentiert, dass der Parlamentarismus durch Geheimpolitik und Parteienzwang seinen ursprünglichen Sinn, die rationale Diskussion und die Suche nach der politischen Wahrheit, verloren hat. Der Liberalismus wird von ihm als Aushöhlung des Politischen gesehen, da er die Bedeutung der staatlichen Ordnung und der Freund-Feind-Unterscheidung relativiert.
Was ist Schmitts Demokratieverständnis?
Schmitts Demokratieverständnis basiert auf der Idee der Homogenität des Volkes. Er argumentiert, dass eine wirkliche Demokratie voraussetzt, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird. Dies impliziert die Notwendigkeit, Heterogenes auszuschließen oder zu vernichten. Er betont die Identität von Regierenden und Regierten und sieht Gleichheit als konstitutives Element der Demokratie.
Was bedeutet das Freund-Feind-Verhältnis für Carl Schmitt?
Das Freund-Feind-Verhältnis ist für Schmitt der Kern des Politischen. Es ist die Unterscheidung zwischen einer Gesamtheit von Menschen, die bereit ist, für ihre Einheit zu kämpfen (Freund), und einer ebensolchen Gesamtheit, die eine Bedrohung darstellt (Feind). Die Freund-Feind-Unterscheidung ist unabhängig von moralischen, ästhetischen oder ökonomischen Kriterien und kann im Extremfall die Bereitschaft zum Töten erfordern.
Welche Kritik wird an Schmitts staatstheoretischem Entwurf geübt?
Kritiker bemängeln, dass Schmitts Dezisionismus zu autoritären und willkürlichen Entscheidungen führen kann. Seine Homogenitätsvorstellung wird als totalitär abgelehnt, da sie die politische Freiheit unterdrückt. Zudem wird ihm vorgeworfen, mit seinen Theorien den Nationalsozialismus ideologisch vorbereitet und gerechtfertigt zu haben.
Warum ist Carl Schmitt trotz seiner umstrittenen Positionen für die heutige politische Wissenschaft relevant?
Schmitts Werke regen bis heute zur Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen der politischen Theorie an. Seine Analysen der Weimarer Republik und seine Kritik an Parlamentarismus und Liberalismus bieten wertvolle Einblicke in die Funktionsweise von Demokratien und die Gefahren politischer Instabilität. Zudem haben seine Ideen, insbesondere das Prinzip der Streitbaren Demokratie, Einfluss auf die Ausgestaltung des deutschen Grundgesetzes gehabt.
Worin besteht die Bedeutung von Carl Schmitts Werk "Der Begriff des Politischen"?
"Der Begriff des Politischen" ist eine zentrale Schrift von Carl Schmitt, in der er das Wesen des Politischen durch die Unterscheidung von Freund und Feind definiert. Diese Unterscheidung, so Schmitt, ist grundlegend für jede politische Einheit und bestimmt die Möglichkeit des Staates, seine Existenz zu sichern.
Wie wird Carl Schmitt heutzutage in der Wissenschaft rezipiert?
Die Rezeption Carl Schmitts in der Wissenschaft ist ambivalent. Es gibt Befürworter, die seine analytischen Fähigkeiten und seine prägnanten Formulierungen schätzen, und Kritiker, die seine ideologischen Verirrungen und seine Nähe zum Nationalsozialismus ablehnen. Man unterscheidet in der Wissenschaft zwischen Rechts- bzw. Links-Schmittianismus und Schmittianismus der Mitte.
- Quote paper
- Carsten Müller (Author), 2002, Brauchen wir diesen Carl Schmitt? Zur aktuellen Relevanz Carl Schmitts für Forschung und Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107258