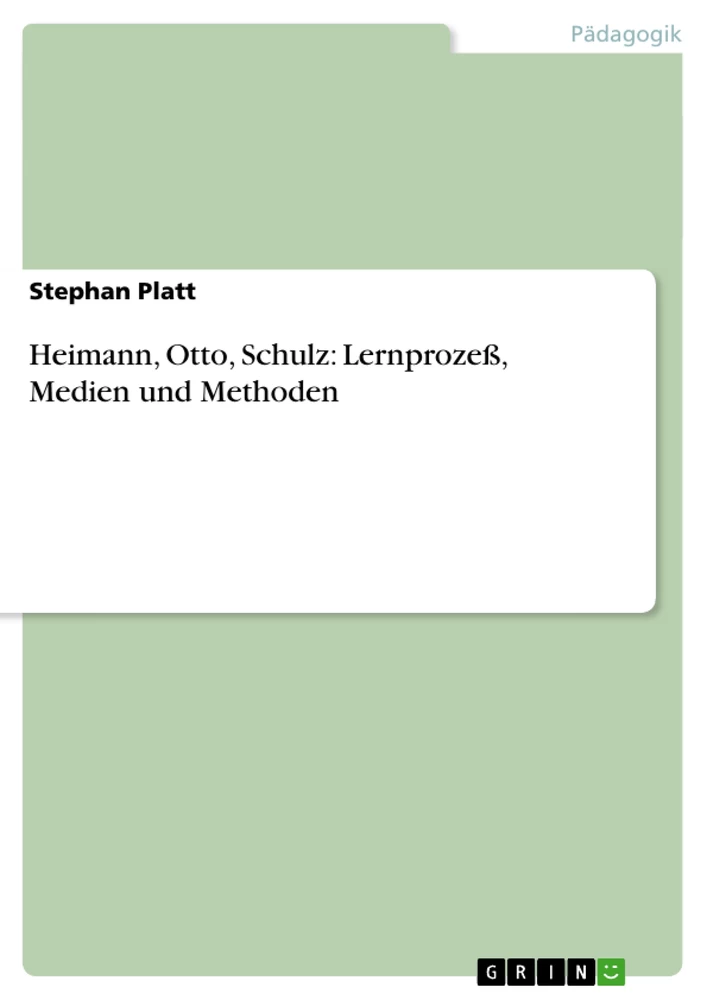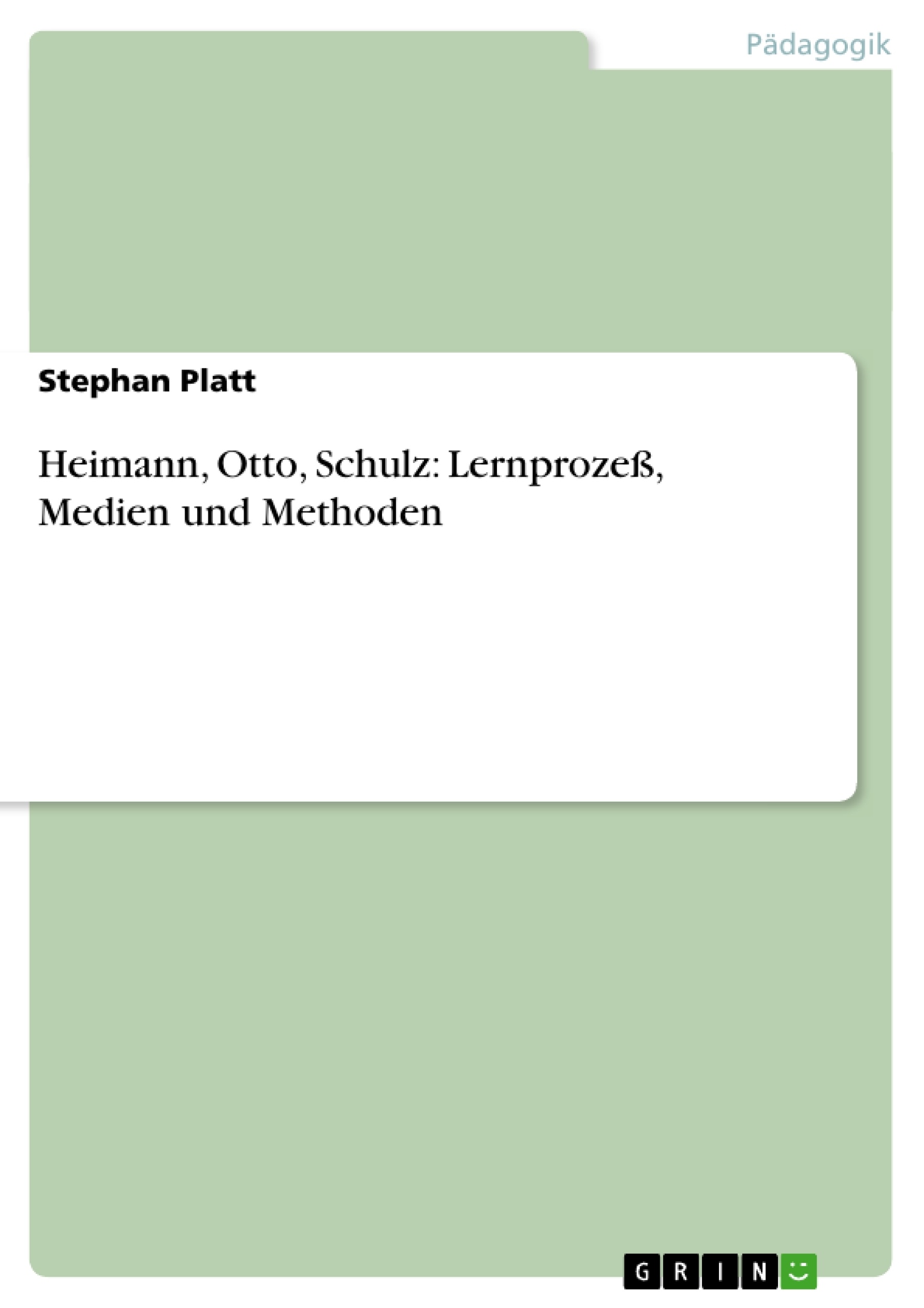Was macht guten Unterricht aus? Tauchen Sie ein in die Welt der Didaktik mit einer tiefgreifenden Analyse der Modelle von Heimann, Otto und Schulz, die seit Jahrzehnten die Lehrerbildung prägen. Dieses Buch beleuchtet, wie sich die Perspektiven auf Lehr-Lern-Prozesse, insbesondere in Bezug auf Methoden, Medien und die Rolle der Lernenden, im Laufe der Zeit gewandelt haben. Entdecken Sie, wie Heimann, Otto und Schulz zunächst allgemeingültige Formalstrukturen didaktischer Prozesse in den Fokus rückten, um ein wertneutrales Instrument zur Analyse und Bewertung von Unterricht zu schaffen. Erfahren Sie, wie der Unterricht von einem dynamischen Interaktionsprozess zu einem Feld bewusster Entscheidungen über Methoden entwickelt wurde, von Gruppenarbeit bis hin zu Artikulationsstufen. Paul Heimanns Beitrag zur Anerkennung von Medien als eigenständige, relevante Elemente im didaktischen Prozess wird ebenso gewürdigt wie die ambivalenten Wirkungen von Unterrichtsmaterialien. Wolfgang Schulz' Weiterentwicklung des Ansatzes rückt die planerischen Aspekte und die Schülerorientierung in den Vordergrund, wodurch der Rezipient vom Objekt zum emanzipierten Subjekt wird. Die Interaktion aller Teilnehmer bei der Unterrichtsplanung ermöglicht Beteiligung, Emanzipation und die Wiederherstellung des Realitätsbezugs des Unterrichtsgegenstandes. Die Planung erfolgt in drei Schritten: Perspektivenplanung, Umrißplanung und Prozeßplanung, wobei Kompetenz, Autonomie und Solidarität im Mittelpunkt stehen. Die Vermittlungsvariablen, wie Methoden und Medien, werden sorgfältig differenziert und auf ihre Eigendynamik hin untersucht. Dieses Buch bietet wertvolle Einblicke für alle, die sich mit Unterrichtsplanung, Didaktik und den Herausforderungen des modernen Lernens auseinandersetzen, und regt dazu an, die Planung des Planungsprozesses selbst zu hinterfragen, um den Lernprozess optimal zu gestalten. Erforschen Sie die vielschichtigen Dimensionen von Lehr-Lern-Prozessen und die Bedeutung von Sach-, Sozial- und Gefühlserfahrungen für eine ganzheitliche Bildung. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für Pädagogen, Dozenten und alle, die an der Gestaltung effektiver und ansprechender Lernumgebungen interessiert sind.
S T E P H A N P L A T T
(Bei Verwendung des Textes - auch in Teilen - bitte ich um einen entsprechenden Hinweis in der Quellenangabe. Danke.)
Heimann, Otto, Schulz: Lernprozeß, Medien und Methoden UdK Berlin, 2002
Das lern- bzw. lehrtheoretische Modell von Heimann, Otto, Schulz hat sich in den knapp vierzig Jahren seiner Existenz in seinen grundlegenden Konstituenten kaum, in der Auffassung ihrer Bedeutung und des Zusammenspiels dagegen deutlicher gewandelt. Eingegangen werden soll im folgenden vor allem auf die Veränderungen in den Bereichen Methoden und Medien sowie auf den Lernprozeß und die Rollen, die Teilnehmern solcher Prozesse zugeschrieben bzw. zuerkannt werden.
In den gemeinschaftlich von Heimann, Otto, Schulz veröffentlichten Publikationen liegt der Fokus eher auf dem Aufzeigen allgemeingültiger Formalstrukturen didaktischer Prozesse. Da sich die Autoren um ein Optimieren der Lehrerausbildung bemühten, ist es nachvollziehbar, daß der Betrachtungsschwerpunkt dabei zunächst auf der Kommunikatorenseite (Entscheidungsfelder) liegt - wenn auch auf Grundlage einer Analyse der Rezipientenseite (Bedingungsfelder): Ziel ist, ein wertneutrales Analyse- und Bewertungstool zu entwickeln, mit dem Unterricht und dort gefällte Entscheidungen beurteilt werden sollen1 [1 ].
Zwar wird Unterricht durchaus als »dynamischer Interaktionsprozeß«2 [2 ] aufgefaßt; und auch dessen unterschiedliche Zielqualitäten (Anbahnung, Entfaltung, Vollendendung/Tat) deuten dessen prozessualer Charakter an. Heimann, Otto, Schulz ist es aus meiner Sicht aber wichtiger, die unterschiedlichen Möglichkeiten zur analytischen Strukturierung von Unterrichtsprozessen als deren Verläufe aufzuzeigen, um auf diese Weise zunächst einmal Bewußtsein für das Entscheidungsfeld »Methode« zu schaffen.
Es umfaßt sowohl konkrete Maßnahmen (beispielsweise Gruppen- oder Einzelunterricht) als auch Umgangsformen oder konzeptionellen Mustern niederschlägt (z.B. ganzheitlicher oder analytischer Unterricht), so daß sich Strukturmöglichkeiten u.a. aus der Sozialform, der Aktionsform oder insbesondere aus Artikulationsstufen bzw. Lernphasen ergeben, wie sie Heinrich Roth vorgeschlagen hat3 [3 ].
Daß Medien als relevante Konstituenten des didaktischen Prozesses überhaupt wahrgenommen werden und ihnen eine eigenständige Rolle als Entscheidungsfeld zugestanden wird, ist Paul Heimanns Verdienst. Als per definitionem »Mittel der Verständigung über Absichten, Gegenstände und Verfahren«4 [4 ] manifestieren sie sich in Form von Humanfaktoren (z.B. Sprache, Mimik, Gestik) sowie in Form von Materialfaktoren (Karte, Buch usw.) und haben in ihrer Eigenschaft, je nach Anwendungssituation Lehr- oder Lernmittel zu sein, ambivalenten Charakter.
Gerade bezüglich der Unterrichtsmaterialien wird eine ähnliche Mehrperspektivität zu bedenken gegeben: Medien stellen Inhalte auf unterschiedliche Weise dar (als Abbild, Muster oder Symbol), können zugleich Produktionsmittel wie auch Werkzeug sein; und selbst ihre Nutzung wird von anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen beeinflußt (z.B. Vertrautheitsgrad; gesellschaftliche Akzeptanz eines Mediums), so daß Medien sowohl eine lernfördernde wie auch eine lernhemmende Wirkung haben können5 [5 ].
Wie dies mit dem Unterrichts- bzw. Lernprozeß korrespondiert und was sich konkret während dieses Prozesses ereignet, liegt nicht im Zentrum des Blickwinkels der lerntheoretischen Didaktik.
Wolfgang Schulz schreibt den Ansatz dann kontinuierlich fort und stellt dabei weniger die analytischen, sondern mit Nachdruck die planerischen Aspekte von Lehr-Lern-Prozessen in den Vordergrund. Zudem entwickelt er keine Theorie und auch kein Rezept, sondern ein hinsichtlich Anspruch und Reichweite dazwischenliegendes Modell6 [6 ].
Es ist stärker schülerorientiert und macht deutlich, daß sich der Rezipient in der didaktischen Betrachtung sukzessive vom Objekt zum Subjekt wandelt, dem als emanzipiertem Prozeßplanungspartner Mitsteuerungsrechte und Kontrollbefugnisse zugeschrieben werden - und zwar auf allen Ebenen7 [7 ].
Unterrichtsplanung als eine ausdrückliche Funktion didaktischen Handelns8 [8 ] ist für Schulz Interaktion9 [9 ], an der alle Teilnehmer partizipieren können, sollen und müssen. Damit wird einerseits Bevormundung ausgeschlossen, andererseits Beteiligung und Emanzipation ermöglicht10 [10 ]. Gleichzeitig wird der Realitätsbezug des Unterrichtsgegenstandes, der aufgrund der Notwendigkeit zur sequentiellen Vermittlung ja aus dem Erfahrungszusammenhang gelöst wurde, wieder hergestellt und so Einsicht in die Alltags- und Lebensrelevanz des Stoffes gesichert11 [11 ].
Die Planung, in die nun im Idealfall alle Betroffenen einbezogen werden, nähert sich dem LehrLern-Prozeß in drei Schritten unterschiedlicher Reichweite12 [12 ] - nämlich in Form einer längerfristigen Perspektivenplanung, einer mittelfristigen Umrißplanung und der konkreten Prozeßplanung sowie ihrer laufenden Korrektur.
Auf der Ebene der Perspektivenplanung geht es um die Aufstellung eines durchaus ideell orientierten Richtzielkatalogs, der die Ausrichtung des Lehr-Lern-Prozesses auf gemeinschaftliche Ziele13 [13 ] und die Erreichung derselben zu kontrollieren ermöglicht. In der Planungsmatrix, die Schulz aus den intentionalen Aspekten Kompetenz, Autonomie und Solidarität sowie den thematischen Felder Sach-, Gefühls- und Sozialerfahrung entwickelt, deuten sich die unterschiedlichen Segmente an, die ein Lehr-Lern-Prozeß mit Wolfgang Schulz abzudecken hat.
Auf der Ebene der Umrißplanung geht es um die eigentliche Lernsituation, in der ein Lehr-Lern- Prozeß die definierten Unterrichtsziele in den subjektbezogenen Dimensionen Kognition, Affekt und Psychomotorik anbahnen, entfalten und schließlich habitualisieren soll14 [14 ]. Dafür mögen mit Hilfe der Umrißplanung Varianten und Akzentuierungen antizipiert werden; weitere Aspekte, die in einer solchen Planung berücksichtigt werden müssen, sind die Ausgangslage der Rezipienten, Vorschläge zur Erfolgskontrolle und insbesondere Methoden und Medien, die Schulz unter dem Terminus Vermittlungsvariablen subsumiert.
Den Bereich der Methoden differenziert Schulz aus in Handlungs- und Umgangsformen, also Verhaltensweisen der Interaktion, sowie in lernorganisatorische Maßnahmen, den Organisationsformen15 [15 ]. Ganz ähnlich zu der Strukturierung nach Heimann, Otto, Schulz werden als planbare Strukturmomente Sozialform, Aktionsform bzw. -weisen, Großformen wie Projekt oder Simulation und schließlich die Untergliederung des Lehr-Lern-Prozesses in Teilschritte und Phasen genannt16 [16 ].
Ganz anders als bei Heimann, Otto, Schulz definiert Schulz Medien nicht nur als Hilfs- und Verständigungsmittel (Medien der Selbstinformation, der Kooperation sowie Produktionsmittel), sondern auch als Objektivation von Lehrfunktionen (z.B. Präsentation, Training, Kontrolle)17 [17 ]. Er betont, daß im Hinblick auf das Bildungsziel diejenigen Medien zu bevorzugen sind, die der Selbstunterrichtung dienen, der aktiven Produktion und solche, die kooperatives Problemlösen und Selbstkontrolle ermöglichen; Massenmedien schließt er dabei ausdrücklich mit ein. Zugleich weist er darauf hin, daß bei der Planung des Medieneinsatzes deren Eigendynamik zu berücksichtigen ist: Medien interpretieren Themen, reproduzieren Realität und können den methodischen Gang des Lehr-Lern-Prozesses weitgehend vorschreiben18 [18 ].
Für dritte Ebene, die Ebene der konkreten Prozeßplanung sowie der andauernden Planungskorrektur, stellt Wolfgang Schulz fest, daß sie im wesentlichen aus der Diskussion der Umrißplanung sowie einer sich anschließenden einfachen Ablaufplanung priorisierter Teilziele und -schritte mit Zuordnung von Hilfen und Kontrollmomenten besteht. Eine solche Prozeßplanung ist im Zweifel »der kunstvoll kanalisierten Unterrichtsentwicklung«19 [19 ] vorzuziehen: und: eine »scheingenaue, mit der Personalität lernender Menschen nicht rechnende, planende Vorwegnahme des Lehr-Lern-Prozesses«20 [20 ] ist seiner Ansicht nach nicht wünschenswert.
Folglich anerkennt Wolfgang Schulz die planende Klärung und Auswahl von Medien und Methoden zwar als prozeßrelevant21 [21 ]; wie sich Medien und Methoden auf den Lehr-Lern- Prozeß wie auf die Wissensübermittlung und -aneignung aber auswirken, bleibt unberücksichtigt.
Fazit
Anhand der didaktischen Modelle von Paul Heimann, Gunter Otto und fortführend Wolfgang Schulz wird deutlich, daß Unterrichtsprozesse formale Strukturen aufweisen und die sorgfältige Planung solcher Prozesse von großer Wichtigkeit ist. Wie aber der Prozeß von seinen Konstituenten beeinflußt wird und umgekehrt, bleibt offen: Schulz klärt nicht, wie der Lehr-Lern- Prozeß im Detail abläuft, sondern wie der Prozeß der Planung solcher Verläufe vonstatten geht; es geht ihm um die Planung des Planungsprozesses, nicht um die Planung des Lernprozesses.
Hilfreich ist meiner Ansicht nach weniger die Erkenntnis, daß Planung unterschiedliche Reichweiten hat und den Rezipienten auf allen Ebenen als Partizipanten berücksichtigen muß. Wichtiger ist mir, daß für Lehr-Lern-Prozesse bzw. in ihrer methodischen und medialen Begleitung und Umsetzung ganz unterschiedliche Qualitäten zu berücksichtigen sind (Sach-, Sozial- und Gefühlserfahrungen bzw. kognitive, affektive sowie psychomotorische Dimensionen). Daß sich diese Qualitäten auf verschiedenen Niveaus entfalten, muß vom medialen Angebot berücksichtigt werden.
Welche Lernphasen dabei durchlaufen werden, ist abhängig vom gewählten Erklärungsmodell; ich stimme diesbezüglich mit Wolfgang Schulz überein, daß die Wahl des Modells ziel- und themenabhängig ist.
Als dreidimensionales Modell würde ich den Verlauf des Lehr-Lern-Prozesses wie folgt darstellen: In jedem Zielsegment gilt es, die Aspekte Kompetenz, Autonomie und Solidarität über Anbahnung, Entfaltung und Habitualisierung zu erreichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 [1 ] Vgl. Heimann, Paul: Didaktik als Theorie und Lehre. In: Die deutsche Schule, 54. Jg., Heft 9, Hannover 1962, S. 409 ff
2 [2 ] Vgl. Heimann, Paul: Didaktik als Theorie und Lehre. In: Die deutsche Schule, 54. Jg., Heft 9, Hannover 1962,: S. 412
3 [3 ] Heimann, Otto, Schulz grenzen die von Roth vorgestellte Stufenfolge (Motivation; Schwierigkeit; Lösung; Tun und Ausführen; Behalten und Einüben; Bereitstellung und Integration) von anderen, sich ebenfalls am Lernprozeß orientierenden Strukturierungsansätzen als besonders gelungen ab. Genannt wurden in diesem Zusammenhang z.B. Herbart (Vertiefung (Klarheit, Assoziation), Besinnung (System, Methode)), Neubert (Einstimmung, Darbietung, Besinnung, Tataufruf) und Kerschensteiner (Schwierigkeitsanalyse und -umgrenzung, Lösungsvermutung, Prüfung der Lösungskraft, Bestätigungsversuche). Vgl. Heimann, Paul, Otto, Gunter, Schulz, Wolfgang: Unterricht - Analyse und Planung. Hannover 1970, S. 30 ff
4 [4 ] Heimann, Paul, Otto, Gunter, Schulz, Wolfgang: Unterricht - Analyse und Planung. Hannover 1970, S. 24
5 [5 ] Heimann, Paul, Otto, Gunter, Schulz, Wolfgang: Unterricht - Analyse und Planung. Hannover 1970, S. 34 ff
6 [6 ] Vgl. Schulz, Wolfgang: Unterrichtsplanung. München 1980, S. 4 ff; Schulz, Wolfgang: Die lehrtheoretische Didaktik. In: Gudjons, Herbert, Teske, Rita, Winkel, Rainer (Hg.): Didaktische Theorien. Braunschweig 1981, S. 29 ff
7 [7 ] 1996 fordert Schulz, statt des immer noch lehrerzentrierten Unterrichts eine entwicklungspartnerschaftliche Planung von Unterricht einzusetzen, die die Rezipientenbeteiligung von Anfang bis Ende sichert; alles andere wäre im Grunde autoritär. Vgl. Schulz, Wolfgang: Anstiftung zum didaktischen Denken. Weinheim 1996, S. 32 ff
8 [8 ] Vgl. Schulz, Wolfgang: Die lehrtheoretische Didaktik. In: Gudjons, Herbert, Teske, Rita, Winkel, Rainer (Hg.): Didaktische Theorien. Braunschweig 1981., S. 33 - 35
9 [9 ] Als modus operandi empfiehlt Schulz ein Handlungsmodell analog zur themenzentrierten Interaktion der Ruth Cohn, das eine Balance zwischen den Anforderungen sicherzustellen hilft, die sich aus der Sache, seitens der Gruppe und natürlich seitens des einzelnen Rezipienten ergeben.. Vgl. Schulz, Wolfgang: Die lehrtheoretische Didaktik. In: Gudjons, Herbert, Teske, Rita, Winkel, Rainer (Hg.): Didaktische Theorien. Braunschweig 1981, S. 34
10 10 Vgl. Schulz, Wolfgang: Unterrichtsplanung. München 1980, S. 7 ff
11 11 Vgl. Schulz, Wolfgang: Unterrichtsplanung. München 1980, S. 19
12 12 Vgl. Schulz, Wolfgang: Unterrichtsplanung. München 1980., S. 28 ff; zuletzt Schulz, Wolfgang: Anstiftung zum didaktischen Denken. Weinheim 1996, S. 135 ff
13 13 Ziel des Unterrichts ist die Selbstproduktion (!) prinzipiell handlungsfähiger, zur Selbstbestimmung berufener Subjekte zu orientierten, emanzipierten Mitgliedern der Gesellschaft. Daß diese Gesellschaft natürlich über ihre institutionellen, herrschafts- und produktionsmittelbezogenen Rahmenbedingungen gleichwohl Einfluß auf den Unterricht nimmt, wird von Schulz berücksichtigt. Vgl. Schulz, Wolfgang: Die lehrtheoretische Didaktik. In: Gudjons, Herbert, Teske, Rita, Winkel, Rainer (Hg.): Didaktische Theorien. Braunschweig 1981., S. 31 ff. Schulz, Wolfgang: Unterrichtspraxis und Unterrichtswissenschaft. In: Klafki, Wolfgang, Otto, Gunter, Schulz, Wolfgang: Didaktik und Praxis. Weinheim 1979, S. 83 ff
14 14 Vgl. Schulz, Wolfgang: Unterrichtsplanung. München 1980, S. 100 ff
15 15 Vgl. Schulz, Wolfgang: Unterrichtsplanung. München 1980, S. 109 ff
16 16 Dabei bleibt einerseits die Orientierung an Heinrich Roth gegeben, andererseits wird sie zur Disposition gestellt: Die Möglichkeit, den Unterrichtsprozeß gemäß seiner Artikulationsstufen in entsprechende Phasen zu gliedern, zieht sich zwar wie ein roter Faden durch die Veröffentlichungen von Wolfgang Schulz. Aber er weist zugleich expressis verbis darauf hin, daß gerade die Auswahl eines geeigneten Phasierungsmodells stets ziel-, sach- und meines Erachtens nach sicherlich auch personenabhängig und damit disponibel ist. Vgl. Schulz, Wolfgang: Anstiftung zum didaktischen Denken. Weinheim 1996, S. 135 ff
17 17 Vgl. Schulz, Wolfgang: Unterrichtsplanung. München 1980, S. 122 ff
18 18 Vgl. Schulz, Wolfgang: Anstiftung zum didaktischen Denken. Weinheim 1996, S. 168
19 19 Vgl. Schulz, Wolfgang: Die lehrtheoretische Didaktik. In: Gudjons, Herbert, Teske, Rita, Winkel, Rainer (Hg.): Didaktische Theorien. Braunschweig 1981, S. 43
20 20 Vgl. Schulz, Wolfgang: Die lehrtheoretische Didaktik. In: Gudjons, Herbert, Teske, Rita, Winkel, Rainer (Hg.): Didaktische Theorien. Braunschweig 1981, S. 42
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text von Stephan Platt über Heimann, Otto, Schulz?
Der Text analysiert das lern- bzw. lehrtheoretische Modell von Heimann, Otto, Schulz und dessen Veränderungen über die Zeit, insbesondere in den Bereichen Methoden, Medien, Lernprozess und Rollen der Teilnehmer.
Was ist das Hauptaugenmerk der Publikationen von Heimann, Otto, Schulz?
Der Fokus liegt auf dem Aufzeigen allgemeingültiger Formalstrukturen didaktischer Prozesse, mit dem Ziel, ein wertneutrales Analyse- und Bewertungstool für Unterricht und Entscheidungen zu entwickeln.
Wie wird Unterricht im Kontext von Heimann, Otto, Schulz aufgefasst?
Unterricht wird als "dynamischer Interaktionsprozess" aufgefasst, wobei jedoch die analytische Strukturierung von Unterrichtsprozessen im Vordergrund steht.
Welche Rolle spielen Medien in diesem didaktischen Modell?
Medien werden als relevante Konstituenten des didaktischen Prozesses wahrgenommen, die sowohl in Form von Humanfaktoren (Sprache, Mimik) als auch Materialfaktoren (Buch, Karte) auftreten und ambivalenten Charakter haben.
Wie unterscheidet sich der Ansatz von Wolfgang Schulz von dem von Heimann, Otto, Schulz?
Wolfgang Schulz legt mehr Wert auf die planerischen Aspekte von Lehr-Lern-Prozessen und betont die Schülerorientierung, wobei der Rezipient vom Objekt zum Subjekt wird, dem Mitsteuerungsrechte zugeschrieben werden.
Was versteht Schulz unter Unterrichtsplanung?
Unterrichtsplanung ist für Schulz Interaktion, an der alle Teilnehmer partizipieren können, sollen und müssen, um Bevormundung auszuschließen und Beteiligung zu ermöglichen.
Welche Schritte umfasst die Planung nach Schulz?
Die Planung nähert sich dem Lehr-Lern-Prozess in drei Schritten: Perspektivenplanung, Umrissplanung und konkrete Prozessplanung mit laufender Korrektur.
Wie definiert Schulz Medien?
Schulz definiert Medien nicht nur als Hilfs- und Verständigungsmittel, sondern auch als Objektivation von Lehrfunktionen wie Präsentation, Training und Kontrolle.
Was ist das Fazit des Textes bezüglich der didaktischen Modelle?
Die didaktischen Modelle von Heimann, Otto und Schulz zeigen, dass Unterrichtsprozesse formale Strukturen aufweisen und Planung wichtig ist. Jedoch bleibt offen, wie der Prozess von seinen Konstituenten beeinflusst wird.
Welche Dimensionen sind für Lehr-Lern-Prozesse zu berücksichtigen?
Für Lehr-Lern-Prozesse sind unterschiedliche Qualitäten wie Sach-, Sozial- und Gefühlserfahrungen bzw. kognitive, affektive sowie psychomotorische Dimensionen zu berücksichtigen.
- Quote paper
- Stephan Platt (Author), 2002, Heimann, Otto, Schulz: Lernprozeß, Medien und Methoden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107023