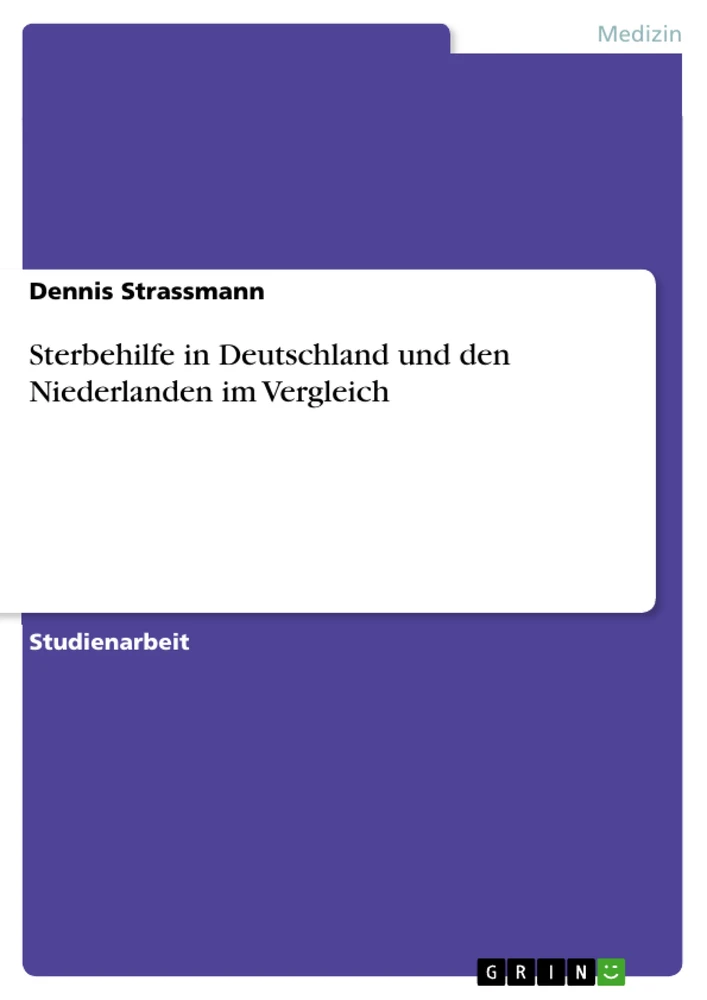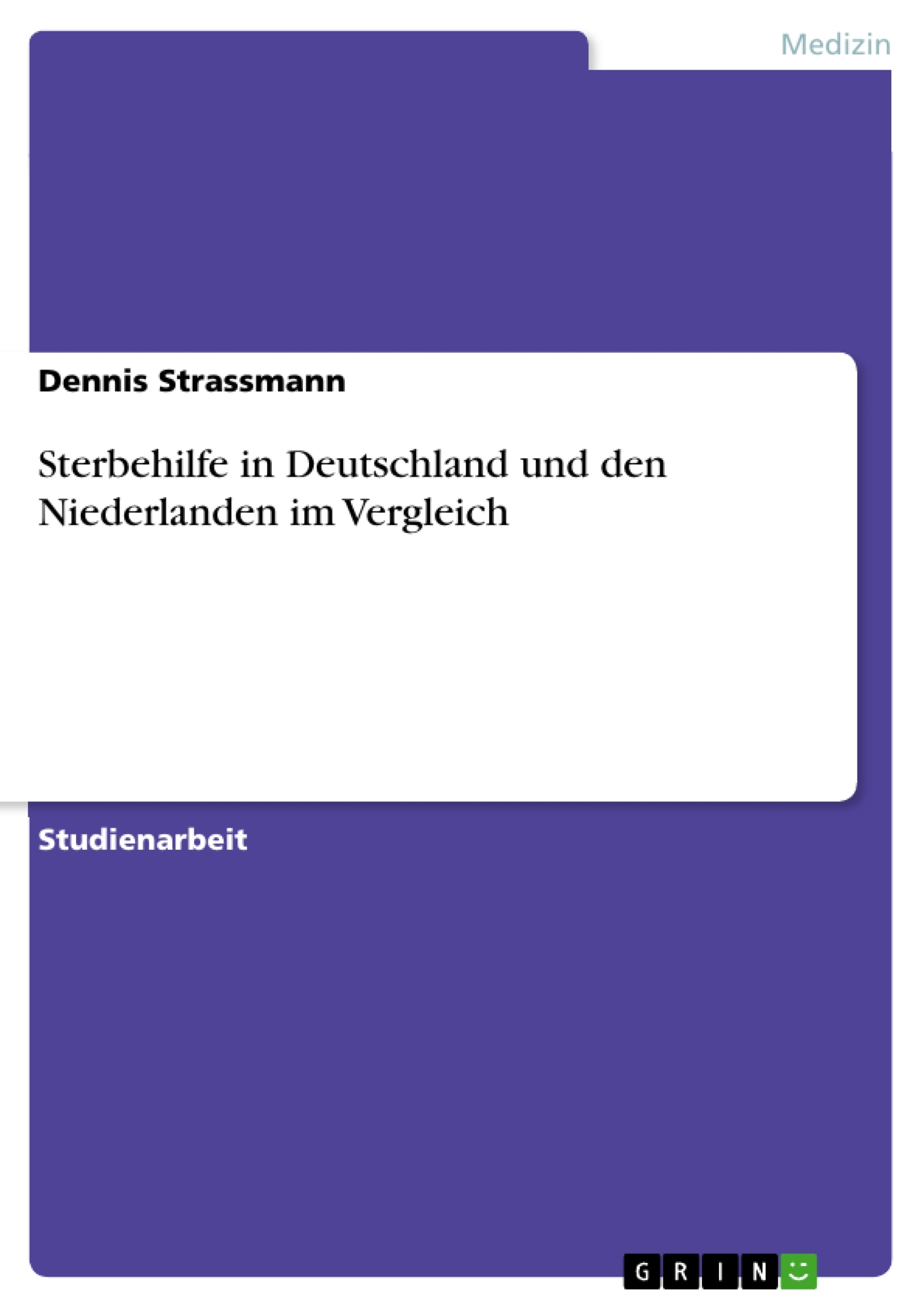Ist es womöglich humaner, Patienten mit unheilbarer Krankheit und großen Schmerzen einen früheren Tod und damit ein Sterben in Würde zu ermöglichen? Sollte Sterbehilfe gesetzlich legalisiert sein oder wäre das mit den ethischen Prinzipien der Gesellschaft und der Ärzteschaft unvereinbar?
Die Diskussion um das Thema Sterbehilfe ist zweifellos schwierig, da die Auseinandersetzung mit dem Tod bzw. dem Sterben in der heutigen Gesellschaft eher vermieden wird. Auf der anderen Seite machen es u.a. die erheblich gestiegene Lebenserwartung und der medizinische Fortschritt nötig, das Thema auf einer breiten Basis zu diskutieren bzw. aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Es stellt sich die Frage ob der Einsatz von Hightech-Medizin in jeder Situation sinnvoll ist oder ob die Intensivmedizin es dem Patienten mit infauster Prognose unmöglich macht, in Würde zu sterben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Formen der Sterbehilfe
3. Situation in Deutschland
4. Situation in den Niederlanden
5. Positionen zur Sterbehilfe
6. Fazit
1. Einleitung
Die Diskussion um das Thema Sterbehilfe ist zweifellos schwierig, da die Auseinandersetzung mit dem Tod bzw. dem Sterben in der heutigen Gesellschaft eher vermieden wird. Auf der anderen Seite machen es u.a. die erheblich gestiegene Lebenserwartung und der medizinische Fortschritt nötig, das Thema auf einer breiten Basis zu diskutieren bzw. aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Es stellt sich die Frage ob der Einsatz von Hightech-Medizin in jeder Situation sinnvoll ist oder ob die Intensivmedizin es dem Patienten mit infauster Prognose unmöglich macht, in Würde zu sterben. Ist es womöglich humaner, Patienten mit unheilbarer Krankheit und großen Schmerzen einen früheren Tod und damit ein Sterben in Würde zu ermöglichen? Sollte Sterbehilfe gesetzlich legalisiert sein oder wäre das mit den ethischen Prinzipien der Gesellschaft und der Ärzteschaft unvereinbar?
2. Formen der Sterbehilfe
Man unterscheidet generell zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Weiterhin unterscheidet man zwischen zwei Formen der aktiven Sterbehilfe; direkt- aktive Sterbehilfe und indirekt- aktive Sterbehilfe.
Unter direkter aktiver Sterbehilfe versteht man die gezielte Tötung eines Patienten, zum Beispiel um seine unerträglichen Schmerzen zu beseitigen. Erfolgt diese Tötung, egal mit welchen Motiven, ohne ein Verlangen des Patienten, so macht sich sowohl der Arzt als auch das Pflegepersonal eines Tötungsdelikts (§ 212 StGB „Totschlag“) schuldig.
Bittet der Patient um Tötung, weil er nicht mehr imstande ist, die unerträglichen Schmerzen oder sonstigen Qualen, die mit seinem Sterben verbunden sind, zu ertragen, so macht sich der Arzt, der diesem Verlangen nachkommt, einem weiteren Delikt, nämlich der ,,Tötung auf Verlangen" schuldig (§ 216 StGB). Unter der indirekt- aktiven Sterbehilfe versteht man die Durchführung schmerzlindernder Maßnahmen, die aber eine lebensverkürzende Nebenwirkung haben. So zum Beispiel die Analgesie mit starken Opiaten wie Morphium. Diese Form der Sterbehilfe ist juristisch zulässig, durch den sog. „rechtfertigenden Notstand“ nach § 34 StGB.
Als passive Sterbehilfe wird der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen bezeichnet. Passive Sterbehilfe ist nur dann zulässig, wenn die angezeigte Therapie das Recht des Patienten auf menschenwürdiges Sterben verletzen würde. Sie ist nur strafbar, wenn sie ohne Einwilligung des Patienten vollzogen wird. Verzichtet der Arzt beim sterbenden Patienten auf letztlich überflüssige lebensverlängernde Maßnahmen, so greift er nicht aktiv in das Behandlungsgeschehen ein. Er unterlässt eine an sich mögliche und vielleicht sogar medizinisch notwendige Behandlungsmaßnahme. Dieses passive Sterben lassen ist für den Arzt keineswegs unproblematisch. Er darf von sich aus und möglicherweise sogar gegen den Willen des Patienten niemals auf lebensverlängernde oder lebenserhaltende Maßnahmen verzichten. Seine Garantenstellung und die ärztliche Hilfspflicht gebieten, dass er dem Patienten die optimale ärztliche und pflegerische Behandlung zu Teil werden lässt.
3. Situation in Deutschland
In Deutschland gibt es noch keine gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe. Sie fällt bis jetzt in die Zuständigkeit des Strafrechts und ist, wie schon unter 2. erwähnt, in der Form als direkt- aktive Sterbehilfe verboten.
Allerdings gibt es, sozusagen spiegelbildlich zur kontroversen Diskussion in den Medien und in der Gesellschaft, auch eine parlamentarische Auseinandersetzung zu dem Thema im Ethik- Rat und in einer Enquete-Kommission des Bundestages. Hier wie dort wird darum gerungen, Lösungen zu finden, die zum einen den Wünschen, bzw. den Vorstellungen nach einem würdevollen Sterben ebenso gerecht werden, wie den nachvollziehbaren Forderungen der Ärzteschaft nach einem verbindlichen Verfahrensschema, das den Ärzten Verhaltenssicherheit gibt und sie vor gerichtlichen Konsequenzen schützt.
4. Situation in den Niederlanden
In den Niederlanden wird schon seit den 80er Jahren aktive Sterbehilfe praktiziert. Sie war zwar auch hier nicht gesetzlich erlaubt, wird jedoch toleriert, wenn die Ärzte sich nach einem Kriterienkatalog richten. Der Patient muss seinen Wunsch zu sterben unbeeinflusst und bei klarem Verstand äußern. Seine Leiden müssen schwer und nicht mit medizinischen Mitteln zu lindern sein. Der Arzt muss einen Kollegen zu Rate ziehen und der Justizbehörde einen Fallbericht zusenden. Doch auch dieses System gerät immer wieder in die Kritik: So sollen die Ärzte vielfach gegen diese Richtlinien verstoßen haben, indem angeblich auf die Einwilligung des Patienten und den
Fallbericht an die Justizbehörde verzichtet wurde. In einer Untersuchung wurde festgestellt, dass bei 3 von 100 Todesfällen durch Euthanasie auf eine Einwilligung des Patienten verzichtet wurde, 1996 wurden 60% der Fälle nicht den Justizbehörden gemeldet. Auch gibt es Kritik, dass durch die Senkung der Haushaltsmittel in staatlichen
Krankenhäusern und Pflegeheimen der finanzielle Aspekt eine große Rolle spielt - lebensverlängernde Maßnahmen werden nicht vergütet und es wird befürchtet, dass Ärzte sich nicht mehr nach dem Wohl des Patienten richten, sondern versuchen, Behandlungskosten zu sparen, indem sie auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten.
Im letzten Jahr (2001) wurde ein Gesetz eingeführt, das nun die aktive Sterbehilfe in den Niederlanden legalisiert, jedoch nur unter einem strengen Kriterienkatalog. Nach einer Schätzung gab es 1998 etwa 20.000 Anfragen auf Sterbehilfe und 1999 verhalfen niederländische Ärzte 2216 Schwerstkranken zu einem sanften Tod. Alle diese Zahlen lassen den Eindruck entstehen, dies könnte dazu führen, dass die Hemmung, das Leben eines Patienten ,,zu seinem eigenen Wohl" zu beenden, nachlässt. So wird z.B. der Vorwurf laut: ,,Ärzte sind keine Götter, doch sie spielen immer öfter Gott, indem sie ihren Patienten und deren Angehörigen lebensverlängernde Behandlungsmethoden trotz Nachfrage und Zahlungsbereitschaft vorenthalten." (- Die Welt, Der Sozialstaat hilft (nach) beim Sterben, 30.11.00)
Eine ganz andere Überlegung ist, dass Sterbehilfe zur Normalität wird, und dass vor allem für ältere und kranke Menschen, der Zwang entsteht, ihr Leben beenden zu müssen, da sie der restlichen Bevölkerung nur Nachteile bringen. Sterbehilfe könnte zu einer gesellschaftlichen Pflicht werden.
5. Positionen zur Sterbehilfe
Wenn es um Positionen zum Thema Sterbehilfe geht, nähert man sich dieser Problematik entweder aus einer juristischen Perspektive (siehe Punkte 2 und 4), hauptsächlich aber versucht man, in einer ethisch-philosophischen Diskussion Antworten auf die sich immer wieder stellenden Fragen zu finden:
- Gibt es das vielfach postulierte Recht auf Sterben- sollte dem Individuum Verfügungsgewalt über den eigenen Tod eingeräumt werden ? - Wer darf (soll ?) entscheiden- auf wem liegt die Last der Entscheidung ? - Wann genau hört Sterbebegleitung auf und wann fängt Sterbehilfe an ? - Ist der Todeswunsch zweifelsfrei zu erkennen ? - Darf man das Recht auf Sterben einem Patienten verweigern ? - Muss sich ein Arzt dem Willen des Patienten oder seiner Angehörigen beugen ? Wie sind sog. Patiententestamente oder
Patientenverfügungen einzuschätzen- welche Verbindlichkeit wird diesen Verfügungen zugebilligt ? - Soll ein Arzt im Sinne der Nächstenliebe handeln (dem Patienten Leiden ersparen) oder seine Ehrfurcht vor dem Leben bewahren? Insbesondere Ärzte müssen sich immer wieder mit diesen Fragen auseinandersetzen, die Antworten sind letztendlich die Grundlage ihrer Entscheidung, ob ihre Handlungsweise noch dem Passus (2) der Berufsordnung der Ärzte entspricht „Aufgabe des Arztes ist es, das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen sowie Leiden zu mildern. Der Arzt übt seinen Beruf nach den Geboten der Menschlichkeit aus. Er darf keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit seiner Aufgabe nicht vereinbar sind oder deren Befolgung er nicht verantworten kann.“, oder dazu in Widerspruch gerät. Mit dem technischen Fortschritt auch in der Medizin und den immer umfangreicheren naturwissenschaftlichen Kenntnissen ist es möglich geworden, die Entstehung und das Ende eines Menschen zu beeinflussen- mit diesen Möglichkeiten muss aber auch die Verantwortung für die Anwendung oder Nichtanwendung übernommen werden, die einen Einzelnen schon überfordern kann und der er nur gerecht werden kann, wenn er sich den o. e. Fragen stellt.
Die Positionen, die dabei bezogen werden, richten sich nach dem jeweiligen Menschenbild und reichen von der Aussage, dass jedem Menschen zu seinem Recht auf Sterben zu verhelfen sei, bis zu der Überzeugung, dass Menschen in keinem Falle die Legitimation haben, über das Ende eines Lebens zu entscheiden. Hinter dieser letztgenannten Position stehen die Erfahrungen aus der Geschichte, menschliches Leben zu bewerten nach lebenswert und nicht lebenswert mit ihren unsäglichen Folgen und die Angst vor einem Einstieg in eine Euthanasiedebatte.
6. Fazit
Aus meiner Sicht kann es keine moralisch- ethisch unanfechtbare Position zur Sterbehilfe geben. Jeder Einzelfall wirft die gleichen Fragen und Probleme auf, die ich in meinen Ausführungen nur kurz anreißen konnte. Für und gegen jede Position gibt es begründete, nachvollziehbare Argumente; aber letztendlich ist die wesentlichste Frage nicht zweifelsfrei zu beantworten: wann wird Leben -und aus wessen Sichtwinkel überhaupt betrachtet- so unerträglich, wann ist das Leid so unermesslich, dass es seine Beendigung durch Beenden des Lebens erzwingt ? Außerhalb jeder Legitimationsdebatte steht für mich die Sterbebegleitung, wie sie die Möglichkeiten der Palliativmedizin bieten, auch wenn diese sicher noch ausgebaut, d.h. viel intensiver erforscht und entwickelt werden muss.
Gerade weil diese Thematik so vielschichtig ist und weil befriedigende Antworten pauschal nicht zu finden sind, wird hier oft sehr emotional diskutiert, damit wird man der Problematik nicht gerecht.
Notwendig ist eine permanente Auseinandersetzung mit diesen Fragen, nur in der ständigen Diskussion können Lösungsansätze gefunden werden, die sicher niemals generalisiert werden können, aber handelnden Personen eine größere Sicherheit in der Entscheidungsfindung geben.
Wichtig ist, dass diese öffentliche Auseinandersetzung die schwerwiegenden ethisch- moralischen Kategorien von Sterbehilfe immer wieder in das öffentliche Bewusstsein und in den Mittelpunkt der Diskussion stellt, damit verhindert wird, dass es im Rahmen einer Euthanasiedebatte wieder um die Einteilung in lebenswertes und lebensunwertes Leben geht und/ oder, wie unter Punkt 4 kurz angesprochen, wirtschaftliche Gründe zum Maßstab von Entscheidungen werden können.
Literaturverzeichnis
1. Wessels, Johannes: „Strafrecht, Allgemeiner Teil“ 30. Auflage, Verlag C.F.Müller 2001
2. Benzenhöfer, Udo: „Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart“
Verlag C.H.Beck, München 1999
3. Wuermeling, Hans-Bernhard: „Ärztliche Pflicht - ein Leben in Würde sichern“ in Zeit-Fragen Nr. 38 vom 01.06.97
4. Hauswirth, Otto: „Die Unvereinbarkeit der aktiven «Sterbehilfe» mit der hippokratischen Ethik“ Zeit-Fragen Nr. 80d vom 18.6. 2001
5. Wagner, Rudolf: „Niederlande - Parlament erlaubt Sterbehilfe“ in Der Spiegel, 27.11.2000
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text behandelt umfassend das Thema Sterbehilfe, einschließlich verschiedener Formen, der aktuellen Situation in Deutschland und den Niederlanden, sowie unterschiedlicher ethischer und juristischer Positionen dazu.
Welche Formen der Sterbehilfe werden unterschieden?
Es wird zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe unterschieden. Aktive Sterbehilfe wird weiter unterteilt in direkt-aktive und indirekt-aktive Sterbehilfe.
Wie wird direkte aktive Sterbehilfe definiert?
Direkte aktive Sterbehilfe ist die gezielte Tötung eines Patienten, beispielsweise zur Beseitigung unerträglicher Schmerzen.
Was versteht man unter indirekter aktiver Sterbehilfe?
Indirekte aktive Sterbehilfe bezieht sich auf schmerzlindernde Maßnahmen mit lebensverkürzender Nebenwirkung, wie z.B. die Analgesie mit starken Opiaten wie Morphium.
Was ist passive Sterbehilfe?
Passive Sterbehilfe ist der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen.
Wie ist die Situation in Deutschland bezüglich der Sterbehilfe geregelt?
In Deutschland gibt es keine explizite gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe. Direkt-aktive Sterbehilfe ist verboten und fällt unter das Strafrecht.
Wie ist die Situation in den Niederlanden?
In den Niederlanden ist aktive Sterbehilfe unter strengen Kriterien legalisiert, nachdem sie bereits seit den 80er Jahren toleriert wurde.
Welche ethischen Fragen werden im Zusammenhang mit Sterbehilfe aufgeworfen?
Es werden Fragen diskutiert wie das Recht auf Sterben, die Entscheidungsfindung, die Abgrenzung zwischen Sterbebegleitung und Sterbehilfe, die Erkennbarkeit des Todeswunsches und die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen.
Welche Positionen zur Sterbehilfe werden im Text dargestellt?
Die dargestellten Positionen reichen von der Befürwortung eines Rechts auf Sterben bis zur Ablehnung jeglicher Legitimation, über das Ende eines Lebens zu entscheiden, basierend auf historischen Erfahrungen und der Angst vor einer Euthanasiedebatte.
Was ist das Fazit des Textes?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass es keine moralisch-ethisch unanfechtbare Position zur Sterbehilfe gibt und dass jeder Einzelfall spezifische Fragen und Probleme aufwirft. Die Sterbebegleitung durch Palliativmedizin wird als wichtig erachtet.
Was wird als notwendig erachtet, um mit der Problematik der Sterbehilfe umzugehen?
Eine permanente Auseinandersetzung mit diesen Fragen wird als notwendig erachtet, um Lösungsansätze zu finden und zu verhindern, dass wirtschaftliche Gründe oder eine Einteilung in lebenswertes und lebensunwertes Leben zum Maßstab von Entscheidungen werden.
- Quote paper
- Dennis Strassmann (Author), 2002, Sterbehilfe in Deutschland und den Niederlanden im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106986