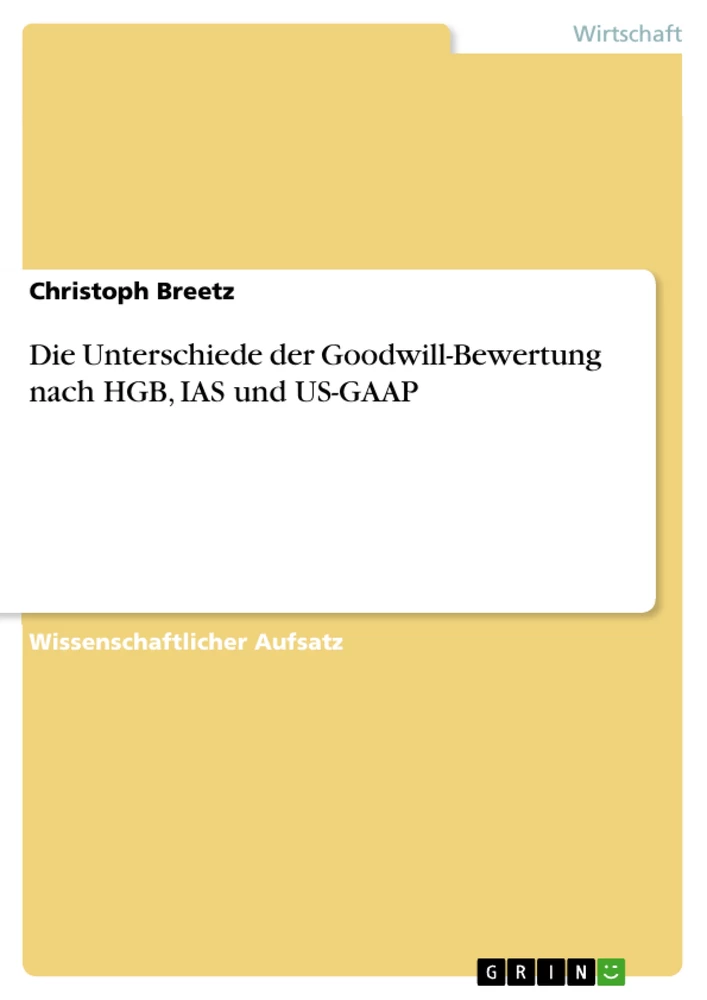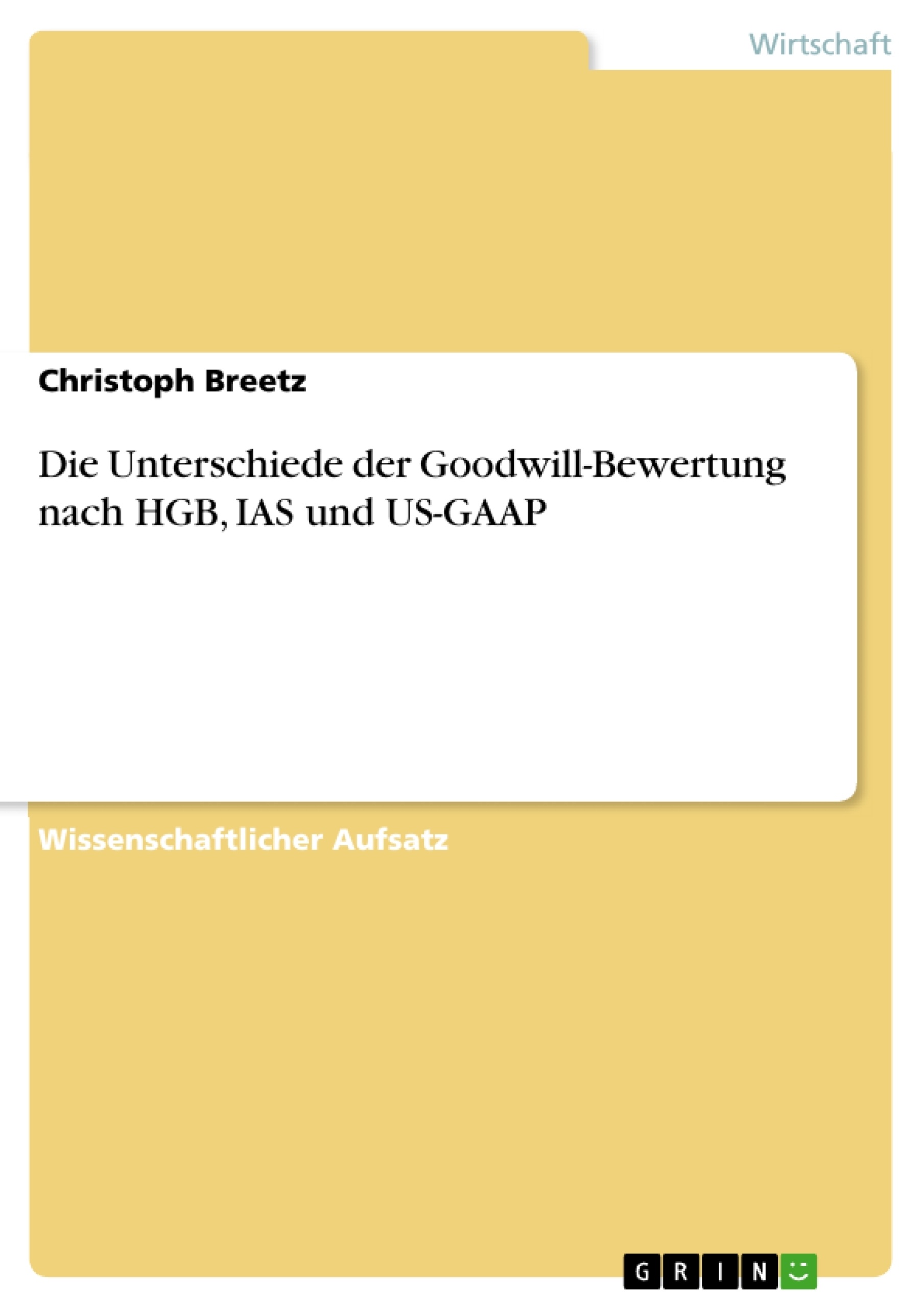Die Rahmenbedingungen der externen Rechnungslegung zur Bewertung und Bilanzierung des Goodwill weisen zum Teil starke Unterschiede auf. Dies bezieht sich nicht nur auf die Aktivierungspflichten und Verbote, sondern auch auf die Abschreibung. Die Unterschiede liegen unter anderem begründet in den unterschiedlichen Zwecken der Rechnungslegungssysteme, wonach das HGB vorrangig den Gläubigerschutz avisiert (Fremdkapitalgeber), IAS und US-GAAP hingegen vorrangig den Investorenschutz avisieren (Eigenkapitalgeber).
Die am 29.06.2001 vom FASB erlassenen neuen Vorschriften SFAS 141 und SFAS 142 zur Abbildung von Unternehmenserwerben und zur Goodwill –Bilanzierung, weisen einen weiteren Schritt in Richtung fair value Accounting auf. Die Arbeit behandelt dabei ausschließlich die neuen Vorschriften und geht nicht auf die Umsetzung der alten Vorschriften in die neuen Vorschriften ein.
Ein weiterer Schritt zur Harmonisierung der Bilanzregeln ist die am 29.10.2002 getroffene Vereinbarung zwischen der FASB und der IASB zur Angleichung der Rechnungslegungsstandards nach US-GAAP und IAS, welche bis 2005 abgeschlossen sein soll. Ferner empfiehlt die EU-Kommission die Umsetzung der Bilanzierung nach IAS bei allen börsennotierten Unternehmen bis 2005 bei konsolidierten Abschlüssen.
Ziel dieser Arbeit ist es daher, die derzeitigen Vorschriften zur Bewertung und Bilanzierung des Goodwills in den einzelnen Rechnungslegungssystemen und die damit verbundenen Probleme darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gang der Untersuchung
- 3 Grundlagen
- 3.1 Der originäre Goodwill
- 3.2 Der derivative Goodwill
- 3.3 Der positive und negative Goodwill
- 4 Ansatz und Bewertung des Goodwills nach dem HGB
- 4.1 Handelsbilanz
- 4.1.1 Originärer Goodwill
- 4.1.2 Derivativer Goodwill
- 4.1.3 Sonderfall negativer Goodwill
- 4.2 Steuerbilanz
- 4.2.1 Originärer Goodwill
- 4.2.2 Derivativer Goodwill
- 4.2.3 Sonderfall negativer Goodwill
- 4.3 Besonderheiten im Konzernabschluss
- 4.4 Zusammenfassung
- 5 Ansatz und Bewertung des Goodwills nach IAS
- 5.1 Arten des Goodwills
- 5.1.1 Besonderheiten des derivativen Goodwills
- 5.1.2 Besonderheiten des originären Goodwills
- 5.2 Bilanzierung des Goodwills
- 5.2.1 Werhaltigkeitstest und außerplanmäßige Abschreibung
- 5.2.1.1 Durchführung des Bottom-Up-Testes
- 5.2.1.2 Durchführung des Top-Down-Testes
- 5.2.2 Zuschreibung
- 5.3 Ausweis- und Offenlegungspflichten
- 5.4 Behandlung des negativen Goodwills
- 5.5 Zusammenfassung
- 6 Ansatz und Bewertung des Goodwills nach US-GAAP
- 6.1 Arten des Goodwills
- 6.1.1 Besonderheiten des derivativen Goodwills
- 6.1.2 Besonderheiten des originären Goodwills
- 6.2 Bilanzierung des Goodwills
- 6.2.1 Ansatz des Goodwills und Zuordnung auf die Reporting Units
- 6.2.2 Impairment Test
- 6.2.2.1 Stufe 1 des Impairment Testes
- 6.2.2.2 Stufe 2 des Impairment Testes
- 6.2.3 Ausweis- und Offenlegungspflichten
- 6.3 Behandlung des negativen Goodwills
- 6.4 Zusammenfassung
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Bewertung und Bilanzierung des Goodwill nach HGB, IAS und US-GAAP. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Rechnungslegungsstandards aufzuzeigen sowie die damit verbundenen Probleme zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Entstehung, Aktivierung und Abschreibung des Goodwill, wobei insbesondere auf die verschiedenen Arten des Goodwill, wie den originären und derivativen Goodwill sowie den positiven und negativen Goodwill, eingegangen wird.
- Bewertung und Bilanzierung des Goodwill nach HGB, IAS und US-GAAP
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Rechnungslegungsstandards
- Aktivierung und Abschreibung des Goodwill
- Arten des Goodwill: originär, derivativ, positiv, negativ
- Probleme und Herausforderungen in der Bilanzierung des Goodwill
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung erläutert die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der externen Rechnungslegung zur Bewertung und Bilanzierung des Goodwill. Es werden die Unterschiede in den Aktivierungspflichten, -verboten und Abschreibungsmethoden zwischen den Rechnungslegungssystemen HGB, IAS und US-GAAP beleuchtet.
- Kapitel 2: Gang der Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise der Arbeit. Es werden die gängigen Begriffe und Definitionen rund um den Goodwill dargestellt, bevor die einzelnen Rechnungslegungssysteme auf ihre Vorschriften bezüglich der Bewertung und Bilanzierung des Goodwill hin überprüft und entsprechend dargestellt werden.
- Kapitel 3: Grundlagen: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Arten des Goodwill definiert und differenziert: originär, derivativ, positiv und negativ.
- Kapitel 4: Ansatz und Bewertung des Goodwills nach dem HGB: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bilanzierung des Goodwill im Handels- und Steuerrecht nach HGB. Es werden die Besonderheiten im Konzernabschluss und die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte dargestellt.
- Kapitel 5: Ansatz und Bewertung des Goodwills nach IAS: Dieses Kapitel erläutert die Bilanzierung des Goodwill nach IAS, inklusive der Werhaltigkeitstest-Methode, der Zuschreibung und der Behandlung des negativen Goodwill.
- Kapitel 6: Ansatz und Bewertung des Goodwills nach US-GAAP: Dieses Kapitel beschreibt die Bilanzierung des Goodwill nach US-GAAP, inklusive des Impairment Testes, der Ausweis- und Offenlegungspflichten und der Behandlung des negativen Goodwill.
Schlüsselwörter
Goodwill, Bewertung, Bilanzierung, HGB, IAS, US-GAAP, originärer Goodwill, derivativer Goodwill, positiver Goodwill, negativer Goodwill, Aktivierung, Abschreibung, Werhaltigkeitstest, Impairment Test, Reporting Units, Rechnungslegungssysteme, Unternehmenserwerb.
- Quote paper
- Christoph Breetz (Author), 2003, Die Unterschiede der Goodwill-Bewertung nach HGB, IAS und US-GAAP, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/10696