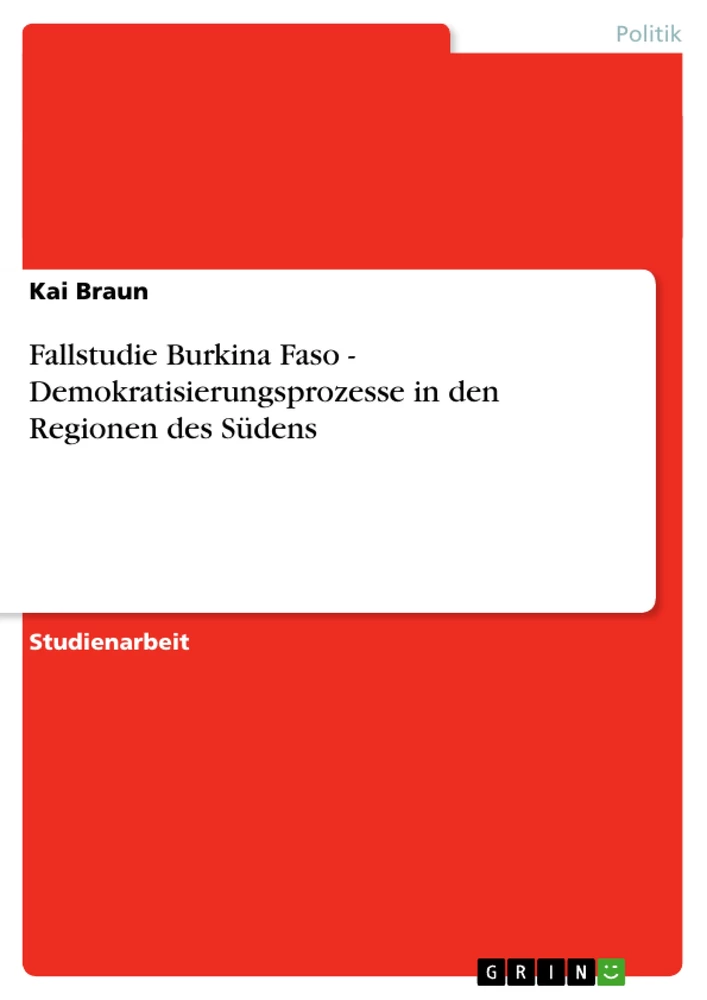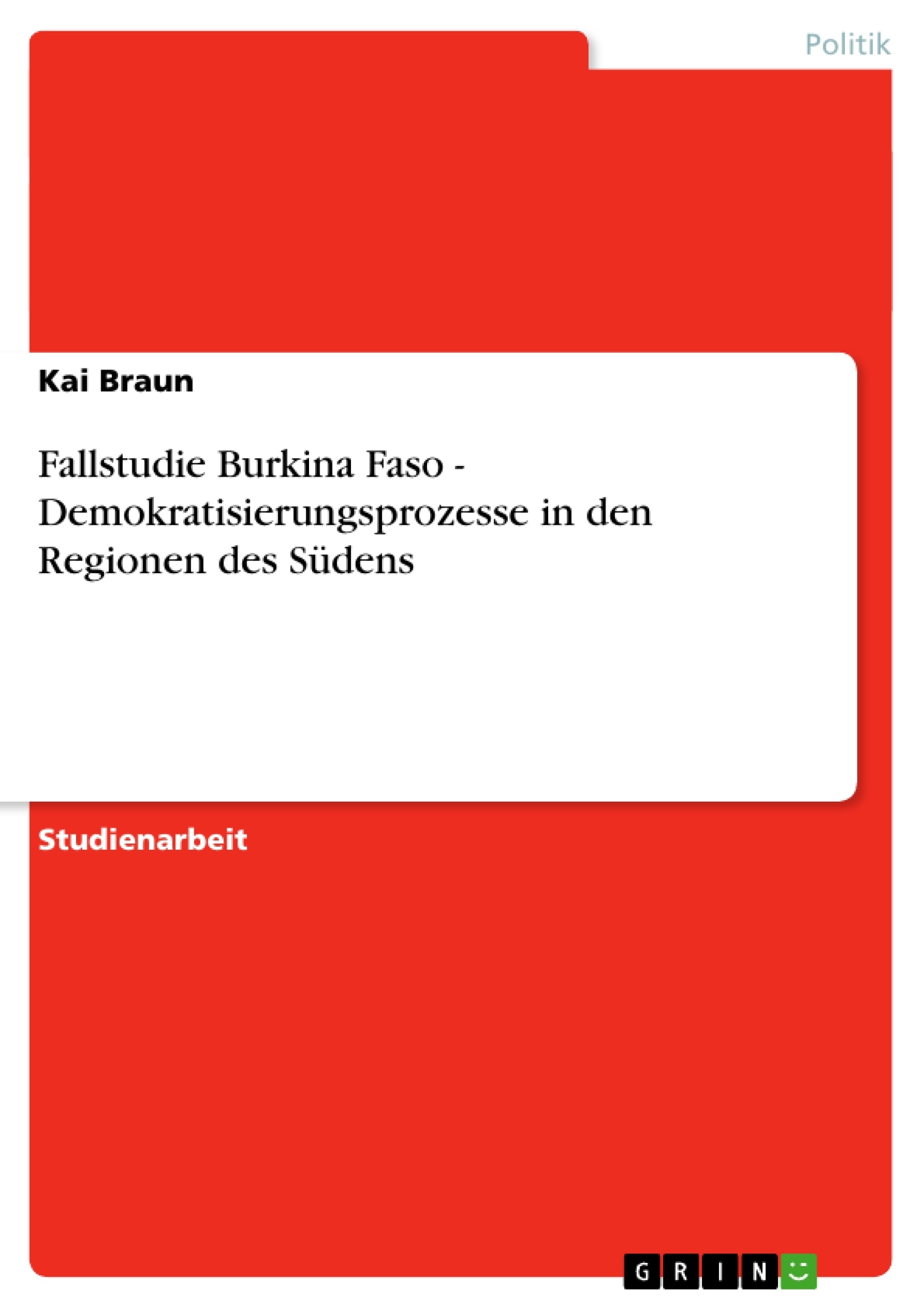Inhalt
Einleitung
1.0 Historischer Überblick des Demokratisierungsprozesses in Burkina Faso
1.1 Kolonialzeit
1.2 Die erste Republik 1960-1966
1.3 Die Herrschaft der Militärs 1966-1978
1.3.1 Redemokratisierung - Die zweite Republik 1971-1974
1.4 Die Phase der Instabilität 1978 -1983
1.5 Burkina Faso unter der Regierung des Conseil National de la revolution (CNR)
1.6 Schritte zur Redemokratisierung unter Compaoré
2.0 Der Einfluss gesellschaftlicher Gruppen im politischen Prozess
2.1 Die Parteien
2.2 Die Gewerkschaften
2.3 Das Militär
3.0 Ergebnisse und Ursachen des Demokratisierungsprozesses
3.1 Erfolgreiche Demokratie
3.2 Ursachen
3.2.1 Interne Ursachen
3.2.2 Externe Ursachen
4.0 Zusammenfassung
Literatur
Einleitung
Die vorliegende Arbeit untersucht den Demokratisierungsprozess in dem kleinen schwarzafrikanischen Staat Burkina Faso seit der Unabhängigkeit, die das Land 1960 erwarb. Im ersten Teil werden in einem historischen Überblick die verschiedenen Stationen der sich ablösenden Regierungen vorgestellt und die mehrfachen Versuche beschrieben, eine Demokratisierung einzuleiten.
Das Land erlebte seit 1960 insgesamt sechs gewaltsame Regierungswechsel. Welche gesellschaftlichen Gruppen dabei prägenden Einfluss ausübten und welche Rolle sie einnahmen, wird in einem zweiten Punkt erläutert.
Im letzten Teil der Arbeit werden Ergebnisse und Ursachen des Demokratisie- rungs- prozesses analysiert. Burkina Faso zählt im Hinblick auf die demokratische Entwicklung zu den wenigen erfolgreichen Staaten Afrikas. Bei der Betrachtung der Ursachen dieser positiven Enwicklung wird sich herausstellen, dass der Einfluss auf die politische Herrschaft im Land vor allem von innerstaatlichen Gruppierungen ausging und weniger von exogenen Faktoren bestimmt wurde.
1.0 Historischer Überblick des Demokratisierungsprozesses in Burkina Faso
1.1 Kolonialzeit
Ende des 19 Jhd. eroberten französische Truppen ohne größere Kämpfe die drei Reiche der Mossi von Quagadougou (heutige Hauptstadt), Yatenga und Tenkodo- go. Das gesamte Gebiet wurde 1919 als Kolonie Obervolta konstituiert und in Französisch-Westafrika eingegliedert. Im Jahre 1958 konstituierte sich die autono- me Republik Volta, die 1959 in Obervolta umbenannt wurde. Sie erhielt am 5.August 1960 die volle Souveränität.
1.2 Die erste Republik 1960-1966
Der erste Staatschef der Republik wurde der aus christlichen Gewerkschaften kommende Maurice Yaméogo. Er gehörte der interterretorialen Partei Ras- semblement Démocratique Africain (RDA) an, deren Führer er 1958 wurde, nach- dem der Parteivorsitzende Coulibaly, ein erfahrener und angesehener Politiker, un- erwartet starb. Eine durch dessen Tod ausgelöste Regierungskrise nutzte Yaméo- go, um sich gegen innenpolitischen Widerstand durchzusetzen und wurde so 1958 der erste Regierungschef des Landes. Seine Machtbasis ruhte am Anfang nur auf der RDA, die lediglich regional verankert war. Konsequent begann Yaméogo aller- dings diese Basis auszubauen. Nach den für die RDA erfolgreich verlaufenden Par- lamentswahlen band er die zweite Partei des Landes, das Parteienbündnis MRV- PRA (Mouvement de Regroupement Voltaique - Partei Démocratique Unifi é) in sei- ne Herrschaft ein und konnte dadurch seine Partei RDA zur nationalen Einheitspar- tei ausweiten. Es entstand, im Gegensatz zu den meisten anderen afrikanischen Ländern, gleich nach dem Ende der Kolonialzeit ein Ein-Parteien- System, welches allein der Machterhaltung des starken Mannes Yaméogo diente. Parallel versuchte er alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen wie Regierung, Verwaltung und Par- lament gleichzuschalten, d.h. direkt seiner Verfügungsgewalt zu unterstellen. Au- ßenpolitisch wurde dieser Kurs trotz anderweitiger liberaler Vorgaben aus Frank- reich dadurch unterstützt, indem das Land weiterhin großzügig finanzielle und per- sonelle Hilfe bekam. Frankreich honorierte damit die Haltung Yaméogos, der eine enge Anbindung an die alte Kolonialmacht suchte. Der Gleichschaltungsprozess gelang nicht völlig. Vor allem die Gewerkschaften ließen sich nicht in die Herrschaft Yaméogos einbinden.
Die katholische Kirche unterstützte zunächst den aus ihren Reihen kommenden Präsidenten, distanzierte sich später aber von ihm, als er sich durch sein Verhalten gegen die Kirche stellte. Mit zunehmender Amtszeit häuften sich die willkürliche Eingriffen Yaméogos in Partei und Verwaltung. Viele regionale Führer, v.a. aus dem Stamm der Mossi und andere Politker büßten dadurch an Einfluss ein. Die Folge war, dass die Einheitspartei RDA nicht mehr ausreichend im Land repräsen- tiert war. Durch die schlechte wirtschaftliche Lage wuchs die Unzufriedenheit be- sonders in der Stadtbevölkerung. So bildete sich zum Jahreswechsel 1965/66 eine breite Koaltion gegen die Ein-Parteien-Diktatur, die aus Gewerkschaftern, Parteipo- litkern, Stadtbevölkerung und Mitgliedern der katholischen Kirche bestand. Es kam 1966 zu Demonstrationen und schließlich zum unblutigen Putsch durch die Armee. Neuer Machthaber wurde General Lamizana.
1.3 Die Herrschaft der Militärs 1966-1978
Die kleine Armee Burkina Fasos (ca. 1500 Mann) verhielt sich während der Span- nungen 1966 zunächst neutral und abwartend. Die Armeeführung drängte nicht von sich aus an die Macht, sondern wurde von Gewerkschaften und Demonstranten dazu aufgefordert, die Macht für eine kurze Übergangsperiode zu übernehmen. Die Militärführung verstand sich als Treuhänder der nationalen Einheit und wollte die desolate Finanz- und Wirtschaftslage stabilisieren. Als klar wurde, dass die Sanie- rung nicht in einer kurzen Übergangsperiode zu leisten war, verlängerte das Militär einseitig die Herrschaftsausübung auf vier Jahre. Diese Maßnahme wurde von den Gewerkschaften und weiten politischen Kreisen abgelehnt. Dennoch gelang es dem Militär durch eine Reihe von erfolgreichen Maßnahmen das Vertrauen der Be- völkerung zu gewinnen. U.a. sanierte Lamizana die Staatsfinanzen, gewerkschaftli- che Rechte und freie Meinungsäußerung blieben erhalten und die Armeeführung bereicherte sich nicht am Staatsvermögen, sondern legte eine erstaunliche An- spruchslosigkeit an den Tag.
1.3.1 Redemokratisierung - Die zweite Republik 1971-1974
Im Jahre 1970 war die Armee dann in der Tat bereit, ihre Herrschaft an eine ge- wählte zivile Regierung zu übergeben. Dazu war eine neue Verfassung nötig, die in langwierigen Verhandlungen ausgearbeitet wurde. In den Verhandlungen wurde deutlich, dass das Militär sich nicht vollständig aus der Regierungsverantwortung zurückzuziehen würde. Der Verfassungsentwurf, der schließlich dem Volk zur Ab- stimmung vorgelegt wurde, orientierte sich in weiten Teilen an der Verfassung der V. Republik. Im Referendum 1970 votierten 98% der Wähler für die Verfassung. Ende 1970 wurden freie und faire Parlamentswahlen durchgeführt. Eindeutiger Sieger wurde die ehemalige Einheitspartei UDV-RDA. Auch anderen Parteien ge- lang der Sprung ins Parlament, so dass in Burkina Faso nach zehn Jahren erst- mals wieder eine pluralistische Parteienlandschaft aufblühte. Um eine ausreichen- de parlamentarische Basis zu haben, koalierte die UDV-RDA mit der PRA. Präsi- dent des Staates blieb General Lamizana, der sich von nun an, entsprechend dem französichem Vorbild, als Schiedsrichter außerhalb und oberhalb der Parteien sah. Wichtige Ministerposten wurde allerdings weiter mit Offizieren der Armee besetzt. Dieses Privileg hatten die Militärs bei den verfassungsgebenden Beratungen durchgesetzt. Hier zeigt sich bereits eine der beiden Konfliktherde, die letztlich zum Scheitern der zweiten Republik führten, der Konflikt zwischen Militärs und Zivilisten. Der zweite Konfliktherd spielte sich zwischen den Parteien ab, insbesondere gab es große Spannungen in der größten Partei UDV-RDA. So kam es, dass sich die entscheidenden politischen Institutionen selbst blockierten und das Land nicht vo- ranbrachten und das zu einer Zeit, in der das Sahelland von einer großen Dürreka- tastrophe heimgesucht wurde. In einer politischen Pattsituation ergriff 1974 nun das Militär durch Präsident und General Lamizana erneut die Macht. Im Gegensatz zu 1966 handelte die Militärführung diesmal aus eigenem Antrieb und hatte dem- entsprechend wenig Unterstützung in der Bevölkerung. Die Herrschaft sollte dies- mal bis 1978 andauern und war von dem Versuch geprägt, die Herrschaftsbasis der Militärs dauerhaft anzulegen. U.a. wurden deshalb alle politischen Parteien verboten. Weitergehende Maßnahmen scheiterten aber an dem Widerstand der Gewerkschaften.
1.4 Die Phase der Instabilität 1978-1983
Bereits 1976 beauftragte General Lamizana eine Komission, die erneut eine Ver- fassung für das Land erarbeiten sollte. Ziel der neuen Verfassung war es, einen möglichst breiten Konsens für alle Bevölkerungsschichten zu finden. Die neue Ver- fassung wurde von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung angenommen. Bei den Parlamentswahlen 1978 ging erneut die UDV-RDA knapp als stärkste Kraft hervor. Auch diesmal gelang es anderen Parteien, in das Parla- ment einzuziehen. Bei den gleichzeitig stattfindenden Präsidentenwahlen wurde General Lamizana im zweiten Wahlgang Sieger. Die knappen Mehrheitsverhältnis- se im Parlament, der schwindende Rückhalt von Präsident Lamizana in der Bevöl- kerung und dem Militär führten dazu, dass alte Spannungen und Konflikte nicht einvernehmlich gelöst werden konnten. Der dritte Demokratieversuch in Burkina Faso scheiterte an den alten Persönlichkeiten und Strukturen. Der von Oberst S. Zerbo geführte unblutige Putsch 1980 eröffnete eine Reihe von Militärputschen: 1982 unter Quedraogo, 1983 unter T. Sankara und schließlich 1987 unter B.Campaoré.
1.5 Burkina Faso unter der Regierung des Conseil National de la revolution (CNR)
Die Machtergreifung unter Hauptmann Sankara im August 1983 beendete eine to- tale Konfusion und das herrschende politische Vakuum im Staat. Der nationale Revolutionsrat (CNR) bestand aus "vier Führern", die sich unter der Führung des Hauptmanns Blaise Campaorés gebildet hatten. Erstes Ziel des CNR war die Kon- solidierung der eigenen Macht. Dazu mussten sie zunächst im völlig desorganisier- ten Militär ihre Macht durchsetzten. Dies geschah u.a. dadurch, dass zwei profilier- te höhere Offiziere erschossen wurden. Politisch wollte der CNR mit Unterstützung linker Gruppen eine "demokratische Volksrevolution" starten. Als diese Gruppen und die Gewerkschaften versuchten, auf die politische Macht mehr Einfluss zu nehmen, wurde sie von der Revolutionsregierung mit drastischen Maßnahmen un- terdrückt. Dadurch verlor der CNR rasch die Unterstützung v.a. der städtischen Be- völkerung und musste sich fortan allein auf die von ihm reformierte und wiede- rerstarke Armee stützen. 1984 erfolgte die Umbennung des Landes von Obervolta in Burkina Faso (Land der unbestechlichen Männer).
Zahlreiche vom CNR initiierte Programme zu Verbesserung der Lebensbe- dingun- gen der ländlichen Bevölkerung und der Frauen scheiterten aus verschie- denen Gründen. Mit zunehmender Amtsperiode verblassten Popularität und Charisma des Präsidenten Sankara. Hinzu kamen Spannungen und Kompetenz- gerangel inner- halb der "vier Führer" der Revolution, die nicht gelöst wurden. So konnten sie sich u.a. nicht auf die Errichtung geeigneter Institutionen einigen, die zur Ausübung ihrer Herrschaft nötig gewesen wären. Der Konflikt musste daher eskalieren und wurde nicht anders als durch einen erneuten Putsch unter der Regie Campaorés beendet. Dieser Putsch endete blutig. Mit Sankara kamen ca. vierzig weitere Menschen ums Leben.
1.6 Schritte zur Redemokratisierung unter Compaoré
Der neue Herrscher, Hauptmann Campaoré, verfolgte im Gegensatz zu seinem Vorgänger weniger einen sozialrevolutionären als vielmehr einen pragmatischen Kurs. Nachdem er seine Macht festigen konnte, leitete Campaoré zu Beginn der neunziger Jahre eine vorsichtige Demokratisierung ein. Eine neue ausgearbeitete Verfassung wurde im Juni 1991 in einem Referendum vom Volk angenommen. Sie sieht u.a. die Wahl eines Parlaments alle fünf Jahre und die Wahl des Präsidenten alle sieben Jahre vor, der nur einmal wiedergewählt werden kann. Auf Grundlage der neuen Verfassung wurde im Dezember 1991 Campaoré mittels durchgeführter Präsidentenwahlen im Amt bestätigt. Allerdings verweigerte die Oppositon wegen mangelnder Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen die Teilnahmen an den Wahlen und rief zum Boykott auf. Daher lag die Wahlbeteiligung bei der Präsiden- tenwahl nur bei 27%.
An den im darauffolgenden Jahr abgehaltenen freien Parlamentswahlen beteiligten sich 27 Parteien. Stärkste Kraft wurde die Partei des Präsidenten Organisation pour la démocratie populair/ Mouvement du travail (ODP-MT) mit 78 Sitzen. Daneben gelang es vier weiteren Oppositionsparteien in das Parlament einzuzie- hen. Mit einer Gesamtzahl von 22 Sitzen blieb ihr Stimmenanteil aber sehr gering. Die ehemals mächtige RDA errang von diesen nur sechs Sitze. Im weiteren Verlauf gelang es dem Präsidenten die Beziehungen zum Ausland zu normalisieren. Die Weltbank konstantierte 1994 erstmal wirtschaftliche Fortschritte im Land. Bei den zweiten durchgeführten Parlamentswahlen 1997 konnte die Partei des Präsidenten unter jetzt neuem Namen Congrés pour la démocratie et le progrés (CDP) 101 von 111 Sitzen erringen und damit ihre Machtposition ausbauen. Mit ihr zogen drei Opposi- tionsparteien ins Parlament. Die RDA verlor vier Mandate und muss sich von nun an mit zwei Sitzen begnügen. Bei der Präsidentenwahl von 1998 wurde Campaoré mit 87,5% der Stimmen wiedergewählt.
2.0 Der Einfluss gesellschaftlicher Gruppen im politischen Prozess
Möchte man die politische Entwicklung eines Landes im Bezug auf die Demokrati- sierung untersuchen, so muss man den Einfluss von gesellschaftlichen Gruppen und Kräften in Betracht ziehen. Im vorliegenden Fall Burkina Faso haben in den letzten vierzig Jahren nach der Unabhängigkeit zahlreiche Gruppen versucht, poli- tischen Einfluss zu nehmen. Als Erstes muss hier das Volk der Mossi genannt werden, welches mit einem Bevölkerungsanteil von fast 50% die Mehrheits-Ethnie darstellt. Unübersehbar war der Anspruch des Mossivolkes auf politische Einfluss- nahme 1958 deutlich geworden, als der Mossikönig seine Krieger vor dem Parla- mentsgebäude aufmarschieren ließ. In seltener Eintracht wiesen allerdings nahezu alle gesellschaftlichen Gruppen diesen Anspruch zurück. Von da an versuchten die Mossifürsten in Zusammenarbeit mit politischen Parteien ihre Einflussphäre zu wahren. Dabei traten im Laufe der Zeit aber immer stärker die persönlichen Ambiti- onen der einzelnen Führungskräfte in den Vordergrund. Dies traf auch für die Mit- glieder anderer Völkerstämme des Landes zu. Im Ergebnis spielte das Kriterium der Ethnizität kaum noch eine entscheidende Rolle. Dies wird u.a. dadurch bestä- tigt, dass es in Burkina Faso im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern (z.b. Ruanda) zu keinen ernsthaften ethnischen Konflikte kam.
Vergleichbares gilt für den Versuch der Einflussnahme durch religiöse Gruppen und durch Familienclans. So versuchte der Clan des gestürzten ersten Präsidenten Yaméogo nach 1966 immer wieder in den politischen Prozess wesentlich einzu- greifen, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Auch der Einfluss der katholischen Kirche blieb sehr gering, wenn man von der Ausnahme absieht, dass in der Herrrschaft Yaméogos einzelne Katholiken in Spitzenpositionen kamen.
Einen erheblichen größeren Machtfaktor bildeten die Mitglieder des öffentlichen Dienstes und der Verwaltung. Mit über 50% stellten sie die größte Gruppe der re- gelmäßigen Einkommensbezieher. Sie waren weitgehend in Gewerkschaften orga- nisiert. Verstärkt wurde deren Machtposition dadurch, dass die Gewerkschafts- führer zu den wenigen hochqualifizierten Bediensteten gehörten, die zentrale Positionen im öffentlichen Dienst besetzten.
Neben den Gewerkschaften entwickelten sich die Parteien und das Militär zu weiteren bedeutenden politischen Gruppen.
Der Umstand, dass weder die einzelnen Völker, noch Kirchen oder islamische Gruppen, noch Familienclans eine bedeutende Rolle in der Herrschaftsausübung darstellten, führte zur politischen Bedeutungslosigkeit der Masse der Landbevölkerung. Letztlich waren es "modernisierte", d.h. städtische Bevölkerungsschichten, die ihr politisches Schicksal in die Hand nahmen. Eine gewisse Ausnahme hiervon bildeten lediglich Teile des Militärs.
Für Burkina Faso kristallisieren sich demnach drei gesellschaftliche Gruppen heraus, die den entscheidenden Einfluss auf die politische Entwicklung des Landes ausübten (und üben) und damit auch wesentlich sind für die Betrachtung des Demokratisierungsprozesses: die Parteien, die Gewerkschaften und das Militär. Diese werden nun im Einzelnen genauer analysiert.
2.1 Die Parteien
Seit der Unabhängigkeit spielten die Parteien eine dominierende Rolle im politi- schen Leben des Landes. Im Gegensatz zu den Gewerkschaften und dem Militär ist ihre Hauptbedeutung darin zu suchen, dass sie als Artikulations- und Integrati- onsorgane für die afrikanische Gesellschaft dienen. Durch die Parteien ist es jedem Einwohner zumindest theoretisch möglich, seine politischen Interessen zu vertre- ten. Dies ist beim Militär überhaupt nicht der Fall und bei den Gewerkschaften nur bedingt, da diese wie erwähnt v.a. den öffentlichen Dienst repräsentieren. So wich- tig ihre Funktion als Artikulations- und Repräsentationsplattform auch ist, genau in dieser Hauptfunktion liegt auch die größte Schwäche der Parteien.
Schon die Bildung der ersten Einheitspartei unter Yaméogo kurz nach der Unab- hängigkeit ließerkennen, dass die Parteien zu Instrumenten in der Hand ihrer Füh- rer wurden. Im weiteren Verlauf der Geschichte bestätigte sich die Befürchtung. Die Parteien dienten immer mehr den einzelnen Führungspersönlichkeiten, indem sie deren Machtansprüche durchsetzen mussten. Molt spricht in diesem Zusam- menhang von einem für Afrika typischen System des Klientelismus (Molt, S.17). Das hatte gravierende Folgen für das Land:
1. Die Parteien entwickelten keine Programmatik zur Lösung der anstehenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme. Dadurch konnte sich keine differenzierte Parteienstruktur entwickeln. Die Parteien unterschieden sich kaum in ihren wenigen programmatischen Punkten.
2. Die herrschende Führungsschicht änderte sich zwischen 1960 und 1980 kaum. In unterschiedlichen Konstellationen und Funktionen blieben dieselben Köpfe die Hauptakteure im politischen Leben des Landes.
3. Die Integrationsfähigkeit und die Repräsentanz der Parteien schwand im Land immer mehr. Es gelang den Parteien immer weniger, Protestpotential zu mobilisieren. Einzige Ausnahme bildeten Anfang der achtziger Jahre die sog. "revolutionären" Parteien, die in Kooperation mit den Gewerkschaften v.a. die urbane Bevölkerung zu Protestaktionen bewegen konnten.
Ein weiterer Schwachpunkt ist bei den verschiedenen Regierungsparteien zu su- chen, die immer wieder dazu neigten, eine Ein-Parteien-Herrschaft etablieren zu wollen. Anstatt die Kooperation mit der Opposition zu suchen, zielten sie auf deren allmähliche Unterwerfung. So gelang es den Parteien nicht, ein ausgeprägtes Ver- fassungsbewußtsein zu entwickeln. Die jüngere Geschichte bestätigt diesen Trend. Auch wenn seit 1992 im Parlament Oppositionsparteien vertreten sind, so dominiert doch seit Beginn der Herrschaft Compaorés eindeutig seine Partei das politische Geschehen. Die zweiten freien Parlamentswahlen 1997 führten nicht zu einem Re- gierungswechel, sondern stärkten im Gegenteil die herrschende Partei. Bei einer Sitzverteilung von 101 zu 10 Sitzen kann durchaus weiter von einem Ein-Parteien- System gesprochen werden.
2.2 Die Gewerkschaften
Wie bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt, sammelten sich in den Gewerkschaften vor allem die Arbeitnehmer, die im öffentlichen Dienst oder halb- staatlichen Unternehmen eine feste Anstellung besaßen und damit über ein regel- mäßiges Einkommen verfügten. Damit rekrutierten die Gewerkschaften ihre Mit- glieder nicht aus den unterpriviligierten, ungebildeten, ländlichen Schichten, son- dern aus den priviligierten Mittel- und Oberschichten der Städte, die in der Regel qualifizierte Ausbildungen durchlaufen hatten. Bei einer Bevölkerung von knapp acht Millionen Menschen besitzen nur ca. 50.000 - 60.000 eine festes Einkommen. Zahlenmäßig sind die Gewerkschaften somit eher klein und können nicht als Rep- räsentanz großer Bevölkerungsschichten angesehen werden. Die geringe numeri- sche Größe der Gewerkschaften steht in einem sehr deutlichen Missverhältniss zu dem politischen Einfluss den sie ausübten. Die Gewerkschaften nahmen und neh- men entscheidenden Einfluss auf die politische Herrschafts- ausübung des Landes. Diese Diskrepanz zwischem geringem sozialem Rückhalt in der Bevölkerung und maßgeblicher Beteiligung an der politischen Entwicklung hatte zwei Gründe:
1. Da nahezu alle Gewerkschaftsmitglieder in irgendeiner Form in staatlichen Institutionen beschäftigt waren, konnten sie wesentlich die ökonomische und administrative Effizienz des Staates mitbestimmen. Welche Regierung auch immer die Macht in Händen hielt, sie musste auf die Dominanz der Gewerkschaften Rücksicht nehmen und den Ausgleich mit ihnen suchen.
2. In den verschieden Phasen der Entwicklung des Landes seit der Unabhängigkeit stellten die Gewerkschaften zeitweise die einzig ernstzunehmende oppositionelle Plattform dar. Das galt besonders in der Zeit nach der zweiten Machtübernahme durch die Miltärs, als zwischen 1974-1978 alle Parteien verboten waren. Den Ge- werkschaften gelang es aus den verschiedenen zerschlagenen Oppositions- grup- pen Massen zu mobilisieren, mit denen sie weitergehende Machtansprüche der Armeeführung erfolgreich abwehren konnten. Auch in der Zeit zuvor, als Yaméogo die Vereinheitlichung der Parteien vorantrieb, bildeten die Gewerkschaften das Sprachrohr für Oppositionspolitiker. Beim Sturz Yaméogos erwiesen sich die Ge- werkschaften als die treibende Kraft, indem sie sich zu einem gemeinsamen Komitee der Gewerkschaftszentralen zusammenschlossen und von dort aus Proteste und Kundgebungen organisierten. In der Zeit der militärischen Herrschaft waren die Gewerkschaften auf die Sicherung ihrer Freiheitsrechte bedacht und konnten so ihre Unabhängigkeit bewahren.
Die Beipiele zeigen, dass die Gewerkschaften ein sehr starker Akteur im politi- schen Prozess der Demokratisierung sind. Diese Stärke darf aber nicht über ihre Schwächen hinwegtäuschen. Die größte Schwäche ist darin zu suchen, dass es ihnen, interessanterweise analog zu den Parteien, nie gelang, ein gewerk- schaflti- ches Gesamtkonzept für eine demokratische Machtausübung zu entwickeln. Be- zeichnend dafür war 1966 die Aufforderung der Gewerkschaften an das Militär, die Macht zu übernehmen, obwohl die Armeeführung dies ursprünglich gar nicht beab- sichtigt hatte. Hier wurde die Schwäche der Gewerkschaften ein alternatives ziviles Regierungskonzept vorzulegen und durchzusetzten, d.h. selbst die Macht in die Hand zu nehmen, mehr als offenkundig. Im Fehlen einer solchen Alternative mussten sich die Gewerkschaften einem stärkerem Akteur beugen. Schmitz fasst das Dilemma der Gewerkschaften treffend zusammen:
Eine direkte und dauerhafte Beteiligung der Gewerkschaften an der politischen Herrschaftsausübung Burkina Fasos erscheint nur im Zusammenhang mit dem Militär oder gesellschaftspolitischen Gruppen möglich, die eine weitreichendere Verankerung in größeren Teilen der Bevölkerung besitzen [...]. (S.324)
Eine weitere Schwäche lag in der Tatsache begründet, dass führende Gewerkschafter zeitweise an der Macht beteiligt waren und dadurch in ihrer Basis an Rückhalt verloren. Auch hier kann man eine Paralelle zu den Parteiführern ziehen (vgl. 2.1). Allerdings verkamen die Gewerkschaften nicht wie die Parteien zu Klientelsystemen, die nur der Elite dienen mussten.
Zusammengefasst lässt sich auf der einen Seite eine für afrikanische Verhältnisse eher seltene, starke Machtposition der Gewerkschaften konstatieren, die auf der anderen Seite aber durch eine Ohnmacht der Gewerkschaften überschattet wird, welche es ihr nicht erlaubte, machtpolitische Verantwortung aus eigener Kraft dau- erhaft zu übernehmen.
2.3 Das Militär
Das Militär übt seit der Machtübernahme 1966 einen sehr entscheidenden und prägenden Einfluss auf die politische Macht im Staat aus. Seit diesem Zeitpunkt bis heute waren und sind die Militärs, wenn auch mit ganz unterschiedlichen Vor- stellungen, an der Herrschaft beteiligt. Der jetzige Staatspräsident Compaoré war Major der Armee. Beim Putsch 1983 war er einer der "vier Führer" der "Revolution" und gelangte, wie beschrieben, durch den ersten blutigen Putsch in der Geschichte des Landes 1987 an die Macht. Allein diese Fakten können als Beleg dafür gelten, dass die Bedeutung des Militärs für die Machtausübung aus dem Spektrum der ge- sellschaftspolitisch aktiven Gruppen herausragt. Gleichzeitig muss dazu gesagt werden, dass sich die politische Herrschaft der burkinabischen Armee deutlich von den Regimen anderer schwarzafrikanischer Militärdiktaturen unterschieden. Die Ursache für diesen Umstand ist in dem Offizierskorps zu suchen. Dieser Teil der Armee war in Burkina Faso der politisch Handelnde. Um die unterschiedlichen Po- sitionen der verschiedenen Militärregierungen zu verstehen, müssen drei Generati- onen von Offiziersgruppen differenziert werden. Die erste Generation, zu dem der langjährige Präsident Lamizana gehörte, fingen als einfache Soldaten in der Kolo- nialarmee Frankreichs an. Durch den Weltkrieg und die anschließenden Kolonial- kriege bewährt, stiegen sie nach und nach in die verschiedenen Offiziersränge auf. Ihre Haltung war eher gutmütig und auf den Konsens mit allen politischen Kräften ausgerichtet. Lamizana musste 1966 förmlich an die Macht gedrängt werden. Er war es auch, der zweimal die Rückkehr zu einer zivilen Regierung initiierte, die aus genannnten Gründen scheiterte (vgl. 1.2 und 1.3). Über den ersten Versuch Lami- zanas (1970) das Militär aus der Regierunsverantwortung zurückzunehmen und durch eine zivile Regierung zu ersetzen, schreibt Schmitz die bemerkenswerte Aussage:
Diese sehr stark vom Staatspräsidenten (Lamizana) geprägte Vorgehensweise, politische Konflikte ohne Anwendung von Gewalt und möglichst konsensuell auszutragen, erwies sich damit zum wiederholten Maße als wesentliches Merkmal der politischen Kultur Burkinas. [...] Dem Militärregime war damit ein für Schwarzafrika außergewöhnliches Ergebnis gelungen. Es war nicht der Verführung der Macht und der erneut erhobenen Forderung nach einer "Entwicklungs-Diktatur" erlegen, sondern hatte einen geregelten Übergangsprozess zu einer gewählten Zivilregierung eingeleitet.
Die zweite Generation von Offizieren war dagegen anders geprägt und strukturiert. Sie konnte oft schon eine akademische Ausbildung im Ausland vorweisen, entwi- ckelte ein elitäres Bewußtsein und zeigte sich in den Auseinandersetzungen um die Herrschaft im Land ungeduldiger und weniger Konsensbereit als die Offi- ziersgruppe um Lamizana. Diese Gruppe war es auch, die die zweite Machtüber- nahme der Militärs 1974 entscheidend vorantrieb, als die demokratischen Instituti- onen sich unfähig erwiesen, die soziale und wirtschaftliche Krise des Landes zu meistern. Wie erwähnt fand diesmal die Machtergreifung keine Unterstützung und Legitimation in der politisch aktiven Bevölkerung. Als das Militär seine Macht si- chern wollte, nahmen die Proteste (v.a. von den Gewerkschaften organisiert, vgl. 2.2) an Heftigkeit zu. Dass die Armee nicht versuchte mit repressiven und gewalt- tätigen Maßnahmen die Opposition niederzuschlagen, ist wohl nur dem mäßigen- dem Einfluss der älteren Offiziersgruppe zu verdanken, die sich innerhalb des Mili- tärs noch einmal durchsetzen konnten. Bei dem Putsch 1980 unter Regie Zerbos wurde diese ältere Generation endgültig von der zweiten abgelöst. Es folgte ein Phase in der das Land in Apathie und Chaos versank. Der Putsch 1983 unter San- kara brachte eine neue, die dritte Generation von führenden Offizieren an die Macht, die die zweite ablöste. Sie war durch jüngere Offiziere gekennzeichnet, die über keinerlei Erfahrungen mehr in der Kolonialarmee besaßen und die fast aus- schließlich an auswärtigen, oftmals renommierten Miltärakademien sehr gut aus- gebildet wurden. Diese Offiziere kamen meistens aus den aufstrebenden Mittel- schichten der Städte und sollten den permanten Bedarf an Führungskräften im Land decken. Während ihrer Ausbildung im Ausland hatten sie intensive Kontakte zu linksintellektuellen Milieus der Universitäten. Von daher erklärt sich der sozial- revolutionäre Charakter des CNR (vgl. 1.5). Der heutige Staatschef Campaoré, der die Redemokratisierung seit 1991 einleitete, entstammt der dritten Generation von Offizieren. Seine auswärtige hervorragende Ausbildung und die Nähe zu linken Studentengruppen (die zwar revolutionär gesinnt waren, sich aber keineswegs für Miltärdiktaturen aussprachen) mag entscheidend für den Erfolg seiner friedlichen Überleitung zu einer Zivilregierung beigetragen haben.
Betrachtet man die Rolle der burkinabischen Armee im Gesamten, so stellt sie sich als der herausragende Akteur dar, der über einen sehr langen Zeitraum die Ge- schicke des Landes maßgeblich lenkte. In diesen Punkt gleicht Burkina Faso vielen anderen afrikanischen Staaten seit der Unabhängigkeit. Bemerkenswert und abso- lut außergewöhnlich war das Verhalten der verschiedenen Militärregime im Bezug auf persönliche Bereicherung und gewalttätiger Unterdrückung. Hier übten die jeweiligen Machthaber eine für Afrika ganz atypische Zurückhaltung. Das ist sehr bemerkenswert und wichtig für die weitere demokratische Entwicklung des Landes. Schmitz kommt in seiner Bewertung über das Militär zu dem Schluss:
Andererseits hat sich das burkinabische Militär bei seiner Herrschaftsausübung auch nicht zu Formen politischer Herrschaft hinreißen lassen, die für Prätorianer-Regime in zahlreichen anderen afrikanischen Staaten typisch sind. In den 25 Jahren der militärisch geprägten Herrschaftsausübung hat es weder starre, langandauernde Perioden repressiver Gewaltanwendung, noch ungezügelte Formen persönlicher Bereicherung, korporativer Bevorzugung oder regionalistisch-tribalistischen Dominanzstrebens gegeben. (S.305)
3.0 Ergebnisse und Ursachen des Demokratisierungsprozesses
3.1 Erfolgreiche Demokratie
Seit der dritten Verfassungsreform 1991 unter Campaoré entwickelte sich das Land zu einem Staat, in dem wesentliche demokratische Elemente realisiert und veran- kert wurden. Schubert,Tetzlaff und Vennewald sprechen von einem "demokrati- schen Grund- und Minimalkonsens" (S.32), der mindestens drei Punkte umfasst::
1. Beteiligung der Bevölkerung an Personal- und Sachfragen
2. Kontrolle der Macht durch rechtliche Bindung
3. Anerkennung der Menschenwürde und der Menschenrechte
Alle drei Punkte können im heutigen Burkina Faso als gegeben gelten. Sowohl das Staatsoberhaupt als auch das Parlament werden in regelmäßigen Abständen vom Volk gewählt (Punkt 1). Freie und faire Wahlen fanden bereits zum zweiten Mal statt (vgl.1.6). Der Staat verfügt über eine rechtsverbindliche Verfassung. Die Iudi- cative ist weitgehend unabhängig (Punkt 2). Schwere und dauerhafte Menschen- rechtsverstöße können im Land nicht beobachtet werden (Punkt 3).
Folgerichtig zählt Tetzlaff Burkina Faso zu einer Gruppe von dreizehn "...politisch relativ stabile Staaten mit positiven Veränderungen in Richtung auf nationale Aus- söhnung, Demokratisierung und marktwirtschaftliche Reformen..." (Tetzlaff S.3)
Im Resultat zählt Burkina Faso demnach im Hinblick auf die demokratische Entwicklung zu den erfolgreicheren Staaten Afrikas.
3.2 Ursachen
Bei der Betrachtung der Ursachen für die positive Entwicklung des Landes, können interne und externe Gründe gefunden werden, wobei die internen von wesentlich größerer Bedeutung sind.
3.2.1 Interne Ursachen
Der Demokratisierungsprozess in Burkina Faso ist maßgeblich "von oben", d.h. vom autoritärem Regime bzw. der alten Regierung gesteuert worden. Schmidt merkt dazu an, dass es dadurch u.a. auch in Burkina zu keinem Systemwechsel gekommen ist (Schmid, S.264). Eine Schlüsselrolle fällt dem Militär zu, welches mehrmals die Macht übernahm und insgesamt dreimal versuchte, eine demokrati- sche Entwicklung einzuleiten. Erst der dritte Versuch war von dauer- haftem Erfolg gekrönt. Gemäßdem Konzept der strategischen und konfliktfähigen Gruppen (SKOG) übernahm die Armee weitgehend den Part der herrschenden, d.h. strate- gischen Gruppe. Ihre "wichtigste Machtressource ist die Anwendung physischer Gewalt" (Schubert, Tetzlaff, Vennewald, S.80). In der Anwendung dieser wichtigs- ten Ressource übte das Militär in Burkina Faso wie beschrieben eine ungewöhnli- che Zurückhaltung. Sie kam im Wesentlichen nur bei den verschiedenen Putschen zum Einsatz und selbst diese verliefen in der Mehrzahl unblutig ! Massive militäri- sche Gewaltanwendung gegen die Opposition oder die Zivilbevölkerung kennt das Land nicht. Die Armee spielte ihre stärkste Karte nicht aus. Das ist ein entschei- dender Grund und auch ein Verdienst der führenden Offiziere für die erfolgreiche Hinwendung zur Demokratie.
Darüberhinaus darf man aber einen weiteren wichtigen Grund für die erfolgreiche Demokratisierung nicht übersehen: die Existenz einer schlagkräftigen Opposition. Im SKOG-Konzept stellt die Opposition die konfliktfähige Gruppe dar. Sie muss ü- ber ein ausreichendes "Droh- und/oder Verweigerungspotential zur Durchsetzung ihres ... Gruppen- oder Standesinteresse verfügen" (Schubert, u.a. S.68) und die- ses Potential gegen strategische Gruppen wirksam einsetzen, d.h. konfliktbereit sein. Ohne eine durchsetzungsstarke Opposition kann politischer Wandel und die Konsolidierung eines Reformprozesses nicht stattfinden. Eine "oppositionelle Ge- genmacht" ist "zwingende Vorraussetzung für Transition (Schubert u.a., S. 58). Diese "grundsätzliche These" (Schubert u.a., S.58) im SKOG - Konzept wird im Fall Burkina Faso bestätigt. Die verschiedenen Parteien und v.a. die Gewerkschaften bildeten in den verschiedenen Phasen der Militärherrschaft und davor einen mäch- tigen und wirksamen Gegenpol zu der jeweiligen strategischen Gruppe (vgl. 2.1 und 2.2). Letztere mussten immer wieder auf Druck der Opposition entweder ab- danken (z.b. Yaméogo) oder Reformprozesse einleiten (z.b. Lamizana und Com- paoré).
Zusammenfassend lassen sich zwei wesentliche interne Ursachen für die erfolgreiche Transition in Burkina Faso festhalten:
1. eine auf Ausgleich und Konsens bemühte strategische Gruppe - das Militär
2. eine durchsetzungsstarke Opposition - die Parteien und Gewerkschaften.
3.2.2 Externe Ursachen
Wie bereits erwähnt, spielen die internen Ursachen für den Demokratisierungs- prozess eine wichigere Rolle als die externen Faktoren. Trotzdem dürfen letztere nicht unberücksichtigt gelassen werden. Hierzu zählt v.a. das Ende des Ost-West- Konflikts, in dessen Folge westliche Industrieländer ihre Hilfe verstärkt von demo- kratischen Reformen und der Achtung der Menschenrechte abhängig machten. Das relative arme Burkina Faso ist weiterhin als afrikanisches Binnen- und Sahel- land auf Kooperation mit dem Westen angewiesen. Insofern übten auch westliche Geberländer auf die demokratische Entwicklung einen gewissen Einfluss aus.
4.0 Zusammenfassung
Der seit 1960 als Präsidialrepublik konstituierte Staat Burkina Faso gilt heute als ein erfolgreiches Modell für die Etablierung demokratischer Strukturen in einem Entwicklungsland. Maßgeblich haben interne Faktoren, ein konsensbereites Mili- tär und eine starke Opposition, den Demokratisierungsprozess beeinflusst. Seit nunmehr einem Jahrzehnt erlebt das Land eine bis dahin nicht gekannte Phase der politischen Stabilität. Der Transformationsprozess wurde nicht vom Volk, sondern "von oben" eingeleitet und gelenkt. Seit 1991 wurden bereits zweimal Parlaments- und Präsidentenwahlen abgehalten. Trotz mancher Schwächen im demokratischen System, hierzu zählt v.a. die starke Dominanz der Partei des Präsidenten im Parlament, gelang es den politischen Kräften im Land, den politi- schen Wandel herbeizuführen und auf einem für alle Seiten befriedigenden Ni- veau zu stabilisieren.
Dieser Erfolg, der zu dem noch mit wenig Blutvergießen einherging, ist leider nur wenigen afrikanischen Ländern beschieden.
Literatur
Baratta, M. (Hrgs.): Der Fischer Weltalmanach 2000
Lohfeld, H.: Spiegel Almanach ´99, Hamburg 1998
Mair, S.: Weg zur Demokratie in den neunziger Jahren, In: Informationen zur politischen Bildung, Afrika 1, Heft 264, 3.Quartal 1999
Molt, P.: Chancen und Voraussetzungen der Demokratisierung Afrikas, In: Aus Politik und Zeitgeschichte B12-13/1993, S.12-21
Nohlen, D.: Lexikon Dritte Welt, Hamburg 1998
Schmidt, S.:Parteien und demokratische Konsolidierung in Afrika, In: Merkel, W. (Hrsg.):Systemwechsel 3, Parteien im Transformationsprozeß, Opladen 97
Schmitz, E.: Politische Herrschaft in Burkina Faso, Freiburg 1990
Schuber,G./Tetzlaff, R./Vennewald, W. (Hrgs.): Demokratisierung und politischer Wandel, Münster 1994
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Seite?
Diese Seite enthält einen Überblick über den Demokratisierungsprozess in Burkina Faso von der Kolonialzeit bis in die späten 1990er Jahre. Sie untersucht historische Ereignisse, den Einfluss verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und die Ursachen für den Demokratisierungsprozess.
Welche historischen Phasen des Demokratisierungsprozesses in Burkina Faso werden behandelt?
Die Seite behandelt folgende Phasen: die Kolonialzeit, die erste Republik (1960-1966), die Herrschaft der Militärs (1966-1978) mit der Redemokratisierung in der zweiten Republik (1971-1974), die Phase der Instabilität (1978-1983), Burkina Faso unter der Regierung des Conseil National de la revolution (CNR) und die Schritte zur Redemokratisierung unter Compaoré.
Welche gesellschaftlichen Gruppen werden hinsichtlich ihres Einflusses auf den politischen Prozess analysiert?
Die analysierten Gruppen sind die Parteien, die Gewerkschaften und das Militär.
Welche Rolle spielten die Parteien im Demokratisierungsprozess?
Die Parteien dienten als Artikulations- und Integrationsorgane, wurden aber oft zu Instrumenten in der Hand ihrer Führer, was die Entwicklung einer differenzierten Parteienstruktur behinderte.
Welchen Einfluss hatten die Gewerkschaften?
Die Gewerkschaften, obwohl zahlenmäßig klein, übten einen bedeutenden politischen Einfluss aus, insbesondere als oppositionelle Plattform während der Militärherrschaft.
Wie wurde die Rolle des Militärs bewertet?
Das Militär spielte eine entscheidende Rolle, insbesondere durch das Offizierskorps. Dabei werden drei Generationen von Offiziersgruppen unterschieden, die sich in ihrer Haltung zur Macht und zum Konsens unterschieden.
Was sind die Ergebnisse des Demokratisierungsprozesses in Burkina Faso laut dieser Analyse?
Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass sich Burkina Faso zu einem Staat entwickelt hat, in dem wesentliche demokratische Elemente realisiert und verankert wurden, was es im Hinblick auf die demokratische Entwicklung zu einem der erfolgreicheren Staaten Afrikas macht.
Welche Ursachen werden für den Erfolg der Demokratisierung genannt?
Es werden interne und externe Ursachen unterschieden, wobei die internen Ursachen (ein konsensbereites Militär und eine starke Opposition) als wesentlich wichtiger angesehen werden.
Welche externen Faktoren haben möglicherweise den Demokratisierungsprozess beeinflusst?
Das Ende des Ost-West-Konflikts und die damit verbundene Abhängigkeit westlicher Hilfe von demokratischen Reformen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Burkina Faso gilt als ein erfolgreiches Modell für die Etablierung demokratischer Strukturen in einem Entwicklungsland, wobei interne Faktoren und insbesondere die politische Stabilität des Landes hervorgehoben werden.
Welche Literatur wird in diesem Text verwendet?
Es wird eine Reihe von Publikationen erwähnt, darunter: Der Fischer Weltalmanach 2000, Spiegel Almanach ´99, Artikel aus politischen Bildungsreihen und Fachbücher zum Thema Demokratisierung in Afrika.
- Arbeit zitieren
- Kai Braun (Autor:in), 2001, Fallstudie Burkina Faso - Demokratisierungsprozesse in den Regionen des Südens, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106909