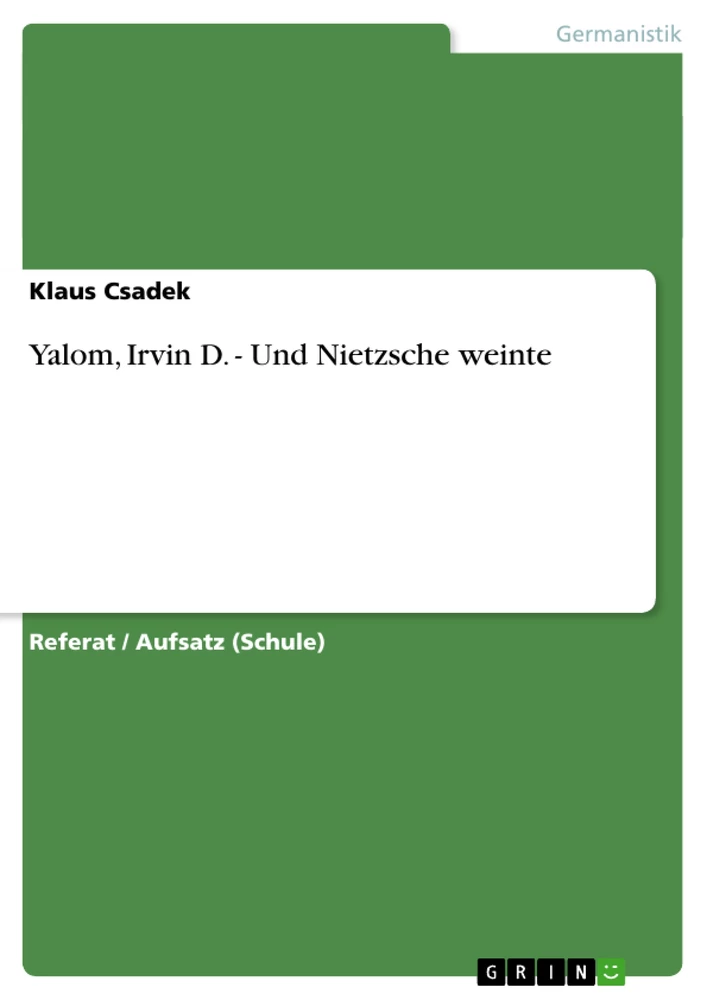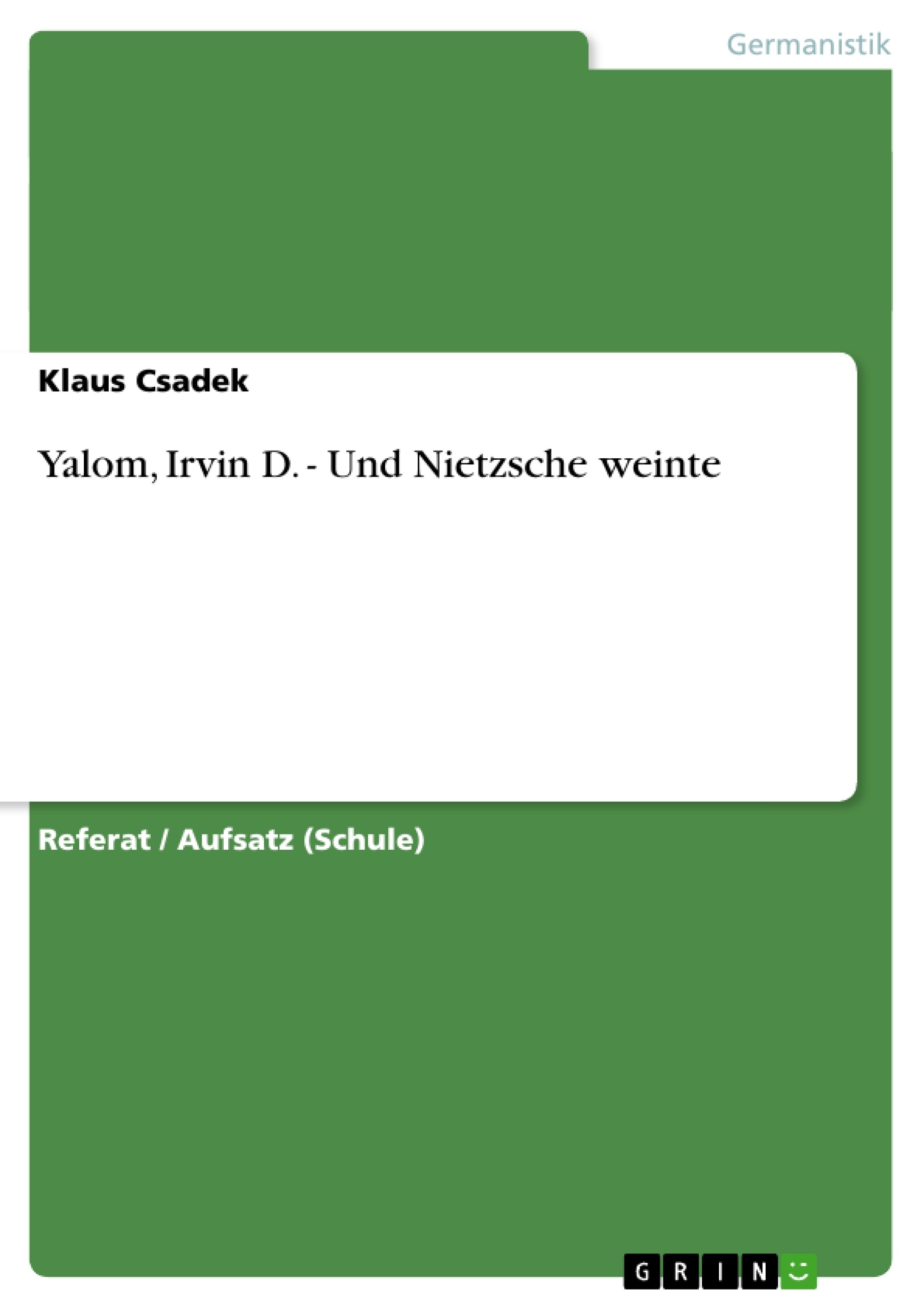Wien, Ende des 19. Jahrhunderts: Eine Stadt im Umbruch, ein Nährboden für neue Ideen und tiefgreifende Krisen. In Irvin D. Yaloms Roman "Und Nietzsche weinte" kreuzen sich die Wege zweier außergewöhnlicher Männer auf unerwartete Weise. Dr. Josef Breuer, ein angesehener Wiener Arzt und Mentor des jungen Sigmund Freud, steckt in einer persönlichen Krise. Geplagt von unerfüllten Sehnsüchten und dem Gefühl, sein Leben zu verpassen, sucht er nach einem Ausweg aus seiner emotionalen Lähmung. Gleichzeitig wird er von Lou Andreas-Salomé, einer faszinierenden und intelligenten jungen Frau, aufgesucht, die ihn um Hilfe für Friedrich Nietzsche bittet. Der berühmte Philosoph leidet unter qualvollen Migräneattacken und einer tiefen Verzweiflung, die sein Schaffen zu ersticken droht. Getrieben von dem Wunsch, Nietzsche zu helfen und gleichzeitig seine eigenen Dämonen zu bekämpfen, willigt Breuer ein, den Philosophen zu behandeln, ohne dass dieser von der eigentlichen Absicht weiß: Eine Therapie der Seele, getarnt als medizinische Behandlung. Was folgt, ist ein faszinierendes intellektuelles Duell und ein tiefgründiger Austausch zwischen Arzt und Patient. Breuer und Nietzsche begeben sich auf eine gemeinsame Reise der Selbstentdeckung, konfrontieren sich mit ihren Ängsten, Sehnsüchten und verborgenen Wünschen. Dabei entwickeln sie neue Ansätze zur Behandlung psychischer Leiden, die die Grundsteine für die moderne Psychotherapie legen werden. "Und Nietzsche weinte" ist mehr als nur ein historischer Roman; es ist eine packende Auseinandersetzung mit den großen Fragen des Lebens: Sinnfindung, Liebe, Tod und die Suche nach dem eigenen Ich. Yalom verwebt auf meisterhafte Weise historische Fakten mit fiktiven Elementen und lässt den Leser eintauchen in die Welt des frühen Wien, in der die Geistesgrößen der Zeit um neue Erkenntnisse ringen. Ein Roman, der zum Nachdenken anregt und die Leser noch lange nach der letzten Seite beschäftigt. Die Begegnung zwischen Breuer und Nietzsche wird zu einem Spiegel, in dem sich der Leser selbst erkennt, mit seinen eigenen Zweifeln und Hoffnungen. Eine Geschichte über die heilende Kraft der Freundschaft und die Möglichkeit, durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schmerz zu innerer Stärke und persönlichem Wachstum zu gelangen. Ein Muss für alle, die sich für Philosophie, Psychologie und die faszinierende Atmosphäre des Fin de Siècle interessieren. Eine brillante Mischung aus historischer Genauigkeit und psychologischer Tiefe, die den Leser von der ersten bis zur letzten Seite fesselt und zum Reflektieren über die eigenen Lebensfragen anregt. Ein literarisches Meisterwerk, das die Leser in seinen Bann zieht und nachhaltig beeindruckt.
Inhaltsverzeichnis
1. Biographie des Autors
2. Die Hauptcharaktere
2.1. Friedrich Willhelm Nietzsche
2.2. Dr. Josef Breuer
2.3. Sigmund Freud
2.4. Lou Andreas-Salomé
3. Inhalt
4. Anmerkungen des Autors
5. Kritik
6. Quellenverzeichnis
Klaus Csadek 5AKT
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Biographie des Autors
Dr. Irvin D. Yalom wurde am 13.Juni 1931 in Washington D.C. geboren. Seine Eltern kamen nach dem zweiten Weltkrieg in die USA. Sie lebten in einem armen Viertel, das von Afroamerikanern dominiert war. Auf der Strasse war es nicht besonders sicher, aus diesem Grund las er sehr viel. Um die Bücher zu bekommen, fuhr er zweimal pro Woche mit dem Rad zur Bibliothek. Als er zu studieren begann, wusste er, dass er Psychiatrie weiter studieren würde, da dies ein wachsender Markt war. Er merkte sehr schnell, dass jeder Mensch seine eigene Geschichte hat, und dies faszinierte ihn. Zu schreiben begann er für Fachzeitschriften. Sein erstes Buch war „The Theory and Practice of Group Psychotherapy“. Dieses Buch war ein großer Erfolg. Es wurde über 700.000 mal verkauft und in zwölf Sprachen übersetzt. Er meint, dass der Erfolg seines Buches darin liegt, dass er in seiner Jugend sehr viel las (viele seiner Leser meinen, dass sich dieses Buch wie eine Novelle liest) und dass er sehr viele Erfahrungen sammelte, bevor er zu schreiben begann. Es folgten weitere erfolgreiche Lehrbücher, (er spezialisierte sich immer mehr auf die Existenzpsychologie) bis er begann, seine ersten Romane zu schreiben. Er nennt seinen Schreibstil (den er bei den Romanen verwendet) „teaching novels“, da sie nicht nur spannende Geschichten sind, sondern auch sehr lehrreich und pädagogisch wertvoll. Sein Meisterwerk „Und Nietzsche weinte“ war unter anderem vier Jahre lang an der Spitze der israelischen Bestsellerliste. Seine weiteren Romane heißen „Die Liebe und ihre Henker“, „Und andere Geschichten der Psychotherapie“, „Das rote Sofa“ und sein neuestes Werk trägt auf Englisch den Titel „Momma and the Meaning of Life“.
Die Hauptcharaktere
Friedrich Willhelm Nietzsche
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Friedrich Wilhelm Nietzsche wurde am 15. Oktober 1844 in Röcken (in Sachsen) geboren. Da sein Vater (ein lutherischer Priester) verstarb, als Nietzsche fünf Jahre alt war, zogen ihn seine Mutter und seine Schwester auf. Er studierte Philologie. 1879 erhielt er eine Professur in Basel, die er aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben musste. Hier beginnt das Buch seinen fiktiven Aufenthalt in Wien. Er wird als sehr stolzer Mensch dargestellt, der nie jemanden Macht über sich geben möchte. Er glaubt, dass wenn man jemandem vertraut, man diesem Macht über einen selbst gibt. Aus diesem Grund ist er sehr zurückhaltend und reagiert sehr aggressiv, wenn ihm jemand helfen will (da er ihm dann etwas schulden würde). Er ist ein sehr intelligenter (seiner zeit weit voraus seiender) Mann. Den größten Einfluss üben auf ihn sein verstorbener Vater, seine Schwester und Lou Salomé aus. Mit der letzteren hatte er ein Verhältnis, das sie nicht als Verhältnis sah, was er nie verkraftete. Seine Schwester hat angeblich die beiden gegeneinander aufgehetzt. Sie wurde in Wirklichkeit dadurch berühmt, dass sie seine Bücher nach seinem Tod vermarktete (außerdem soll sie sie so umgeschrieben haben, dass sie sich als rechte Propaganda verkaufen ließen). Charakterlich wird Nietzsche in dem Buch authentisch dargestellt (dies gilt auch für seinen Lebenslauf - ausgenommen seinem nie stattgefundenen Wienaufenthalt und den Treffen mit Breuer).
Dr. Josef Breuer
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Josef Breuer wurde am 15.Jänner 1842 in Wien geboren. Er war Doktor der Medizin. Er widmete sich den Fragen des Gleichgewichtssinns (den er mittels Tauben erforschte) und der Physiologie der Atmung in ihren Beziehungen zum Nervensystem. Er verfasste gemeinsam mit Sigmund Freud die „Studien über Hysterie“. Er verstarb am 20.Juni 1925 in Wien. Er wird im Buch als alter kraftloser Mann in der Midlifecrisis beschrieben. Er verliebte sich in seine Patientin Bertha Pappenheim, der er das Pseudonym Anna O. gab. Sie war auch in Wirklichkeit bei ihm in Behandlung und er gab ihr auch wirklich das Pseudonym, aber ob er sich wirklich in die junge (für damals sehr hübsche) Frau verliebte, weiß man nicht sicher. Über Bertha Pappenheim möchte ich keine Biographie schreiben, nicht weil sie nicht wichtig wäre, (ganz im Gegenteil) aber sie ist im Buch nur deswegen wichtig, weil sie Breuers sexuelle Phantasien durch ihre Schönheit, Jugend, Unschuld und dadurch, dass er sie behandelt, (und sie ihm dadurch folgen muss) angeregt. Aber sie spielt keine Rolle, in dem Sinn, dass sie aktiv an dem Schauspiel teilhaben würde. Sie könnte durch jede andere hübsche, junge Patientin ersetzt werden.
Sigmund Freud
Der Begründer der Psychoanalyse wurde am
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.Mai 1856 in Freiburg (in Mähren) geboren. Er beschäftigte sich mit der Physiologie und der Hirnpathologie bevor er sich zu der Tätigkeit der Psychoanalyse entschloss. Er wurde 1902 zum Professor ernannt. 1938 musste er wegen seiner jüdischen Abstammung nach London emigrieren . Er bekam am 23.September 1939 von einem Freund Sterbehilfe (Freud war an Kehlkopfkrebs erkrankt). Freud wird als begeisterter Wissenschaftler dargestellt. Zu der Zeit in der das Buch spielt, ist er noch Junggeselle und studiert noch. Er ist sehr gut mit Breuer befreundet und beschäftigt sich sehr viel mit dem Phänomen Traum. Auch diese Charakteristik entspricht der Wirklichkeit.
Lou Andreas-Salomé
Sie wurde am 12.Februar 1861 in St.Petersburg
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
als Tochter eines russischen Generals geboren. Sie war mit dem Orientalisten Friedrich Carl Andreas verheiratet. Sie pflegte regen Kontakt zu wichtigen Größen ihrer Zeit, wie zum Beispiel Nietzsche, Rilke und Sigmund Freud. Sie wollte mit keinem dieser Männer eine sexuelle Beziehung, sie wollte intellektuellen Kontakt. Dies verstanden die meisten Männer dieser Zeit leider nicht. Sie dachten, dass Frauen, die intellektuell waren nur ihre „Chancen bei Männern“ verbessern wollen würden, was bei Lou Andreas-Salomé definitiv nicht richtig war. Aus diesem Grund brach sie einigen Männern (wie auch Friedrich Nietzsche) ohne dass sie es wollte das Herz. Sie wird im Buch als ziemlich herzlos dargestellt. Dies beruht sicher auf dem Eindruck den sie bei Männern ihrer Zeit hinterlassen haben muss. Sie ist sehr berechnend und weiß was sie will. Sie hält sich auch nicht an gesellschaftliche Regeln, was daran liegt, dass sie sehr emanzipiert ist. Auch dies dürfte authentisch sein.
Inhalt
Die Personen, die im Roman vorkommen gab es wirklich, bis auf ein paar Ausnahmen, auf die ich nicht zu sprechen kommen werde.
Die junge Philosophin Lou Andreas-Salomé kontaktiert den Wiener Arzt Dr. Josef Breuer, um ihn zu bitten, dass er Friedrich Wilhelm Nietzsche von seiner Verzweiflung heilt, ohne dass dieser etwas davon erfährt, da dieser sehr eitel ist. Widerwillig geht dieser auf den Vorschlag ein. Der Philosoph kommt zu Dr. Breuer in dem Glauben gegen seine Migräneanfalle behandelt zu werden. Nietzsche ist sehr verschlossen, wodurch es dem Arzt nicht gelingt, zu seiner Verzweiflung zu gelangen. Ganz abgesehen davon, dass er nicht weiß, wie man ein Gefühl behandeln soll. Als der Philosoph abreisen möchte, überredet ihn Dr. Breuer dazu, ihn gegen seine „Midlifecrisis“ zu behandeln. Im Gegenzug behandelt er ihn, gegen seine Migräne. Der Philosoph geht widerwillig auf den Vorschlag ein. In Wirklichkeit wollte der Arzt Zeit gewinnen und meint, dass er so leichter an Nietzsches Gefühlswelt herankommt. Der Philosoph versucht Dr. Breuer durch die von diesem erfundene Methode des chimney-sweepings von der Verzweiflung zu befreien. Diese Heilmethode basiert auf freier Assoziation. Am Ende der Behandlung ist Dr. Breuer, der seine Sitzungen mit dem Philosophen zensuriert seinem Schützling Freud erzählt, kurz davor seine Frau zu verlassen und sein Leben neu zu beginnen. Er lässt sich von Freud hypnotisieren, um es in Gedanken es auszuprobieren. Durch diese Hypnosebehandlung bemerkt er, dass es nicht der richtige Weg für ihn wäre. Durch seine Gespräche mit Nietzsche hat sich sein Leben, vor allem seine Beziehung zu seiner Frau Bertha sehr verbessert. Es dürfte auch dem Philosophen besser gehen. Ob es ihm wirklich auf Dauer besser geht erfährt man leider nicht, da dieser sofort nach der Behandlung abreist.
Anmerkungen des Autors
Irvin D. Yalom erklärt in seinem Nachwort, dass Josef Breuer und Friedrich Nietzsche sich im wirklichen Leben nie begegnet sind. Dass die Hauptpersonen und ihre Lebensumstände auf Tatsachen bestehen, hab ich schon oben bei den Biographien erwähnt. Der Autor meint, dass er den Lebensstoff des Jahres 1882 herauslöste und neu verknüpfte. Die Briefe im Buch sind Originalbriefe, bis auf eine Ausnahme. Die Krankenberichte Breuers sind selbstverständlich erfunden, da sie in Wirklichkeit nicht aufeinander trafen.
Die Frage, ob Breuer mit Bertha Pappenheim ein Verhältnis hatte oder nicht, ist wie schon erwähnt noch nicht erklärt. Verschiedene Aussagen aus dieser Zeit lassen es aber wahrscheinlich sein. Sigmund Freud sprach mit seinem Biographen Ernest Jones ausführlich über die Verstrickung Breuers mit seiner Patientin. In einem früheren Brief an seine Frau Martha Bernays beteuerte er „ihm solle derartiges niemals widerfahren“I. Der Psychoanalytiker George Pollock warf die Frage auf, ob Breuers starke Reaktionen auf Bertha Pappenheim darin gewurzelt haben könnten, dass er seine gleichnamige Mutter verloren hatte.
Nietzsches Krankenbild entnahm Irvine D. Yalom dem Nietzsche-Porträt von Stefan Zweig aus dem Jahre 1939. Er hat auf Grund seiner extrem schweren Migräne zahlreiche europäische Ärzte konsultiert. Aus diesem Grund wäre es theoretisch möglich, dass er auch einmal auf Dr. Breuer gestoßen sein könnte. Allerdings unwahrscheinlich ist, dass Lou Salomé ihm dazu „verholfen“ hat, da sie sich laut ihren Biographen, nicht um ihn gekümmert hat.
Wie bereits erwähnt, sind fast alle Briefe authentisch. Dies gilt nicht für die im Buch geschilderten Träume. Von diesen sind nur zwei belegt. Die anderen sind frei erfunden.
Nietzsche trug in Wirklichkeit nicht zur Entwicklung der Psychotherapie bei. Allerdings hatte der Autor beim Lesen der Werke Nietzsches das Gefühl, dass es auch diesem um Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung existentiell bedeutsamer Anliegen ging. Irvine D. Yalom zitiert in „Und Nietzsche weinte“ ausschließlich aus jenen Werken Nietzsches, die schon zu dieser Zeit fertig geschrieben wurden („Menschliches, Allzumenschliches“, „Unzeitgemäße Betrachtungen“, „Morgenröte“ und „Die fröhliche Wissenschaft“), wobei er davon ausging, dass Nietzsche die Grundgedanken des „Zarathustra“ bereits fertig hatte.
„Und Nietzsche weinte“ entstand unter anderem mit Hilfe der Philosophie Professoren Eckart Förster und Dagfinn Follesdal, die ihm den philosophischen Background lieferten.
Kritik
Der Autor Irvin D. Yalom hat einen fesselnden Schreibstil. Geschrieben ist das Werk in moderner Sprache, mit Ausnahme der Briefe und der direkten Reden. Bei diesen fühlt man sich in das Wien der Jahrhundertwende zurückversetzt.
Das Buch ist aus der Sicht eines neutralen Erzählers geschrieben, bei dem man allerdings das Gefühl hat, er wüsste mehr über Breuer als über Nietzsche. Dies könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass Irvine D. Yalom Psychiatrie in Stanford unterrichtet und daher sich leichter mit Dr. Breuer als mit Nietzsche identifizieren kann. Ein weiterer möglicher Grund wäre, dass er dadurch die Verschlossenheit des Philosophen deutlich machen will.
Besonders interessant zu beobachten ist, wie unterschiedlich Situationen gesehen werden können. Dies macht der Autor deutlich, indem er zuerst einen Teil der Geschichte erzählt und dann Aufzeichnungen von Nietzsche oder Breuer einschiebt. Um die Emotionen zu betonen sind auch Briefe dazwischen. Besonders deutlich sieht man das unterschiedliche Erleben einer Situation zum Beispiel als Dr. Breuer sich folgende Notizen machte: „Zwecklos, mir noch etwas vormachen zu wollen. Bei unseren Begegnungen sitzen zwei Patienten sich gegenüber, von diesen zweien bin ich der dringlichere Fall. Seltsam, je mehr ich mir dies selbst eingestehe, desto einmütiger scheinen er und ich zusammenarbeiten zu können. Vielleicht haben auch die Eröffnungen Lou Salomés zu einer gewandelten Arbeitsweise beigetragen.
Ich habe sie ihm gegenüber natürlich mit keinem Wort erwähnt. Noch spreche ich darüber, dass ich unterdessen tatsächlich Patient geworden bin. Doch ich glaube, er spürt diese Dinge. Möglich, dass ich sie ihm auf unabsichtliche, wortlose Weise mitteile. Wer weiß? Etwa mittels der Stimme, des Tonfalls, der Gesten. Rätselhaft; ich sollte mich mit Freud darüber unterhalten, er interessiert sich sehr für solche Aspekte des menschlichen Verkehrs.“II Nietzsche hingegen schrieb in seinen persönlichen Aufzeichnungen folgendes: „Wie verführerisch ist doch ein>System<! Heute ließich mich vorübergehend verleiten! Ich vermutete hinter Josefs sämtlichen Schwierigkeiten unterdrückten Zorn, und ich habe ihm bei dem Versuche verausgabt, ihn aufzuwiegeln. Vielleicht jedoch bewirkt die lange Unterdrückung von Leidenschaften ihre Wandlung und Abschwächung.
... Er hält sich für >gut< fügt er doch niemandem Schaden zu - außer sichselbst und der Natur! Ich mußihn davon abbringen, einer von jenen zusein, die sich gutheißen, weil sie keine Krallen haben.
Seinem Großmute mag ich nicht trauen, ehe er nicht fluchen lernt. Er empfindet keinen Zorn! Muss er so sehr fürchten, verletzt zu werden? Willer aus diesem Grunde bescheiden ein kleines Glück umarmen? Und nenntes Tugend: ob es schon Feigheit heißt!...“III
Ich glaube an diesen beiden Textpassagen kann man erkennen, wie unterschiedlich beide die selbe Situation sehen. Irvine D. Yalom zeigt auf diese Weise ausgezeichnet wie leicht Missverständnisse entstehen können. Außerdem ist jeder von uns ständig in Situationen, die auf verschiedenste Weisen gedeutet werden können. Jeder von uns ist dabei einmal mehr Breuer, der versucht Signale zu erkennen und sie zu deuten, und einmal mehr Nietzsche, der ganz andere engstirnige Signale wahrnimmt, die sofort zu einer Verurteilung des anderen führen.
Man kann an Hand dieser verschiedenen Blickwinkel auch sehr gut die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen der Psychoanalyse und der Philosophie Nietzsches erkennen. Dies nicht in der Form, dass man stur Strukturen auswendig lernt sondern die Situationen miterlebt.
Ich habe diese Zitate in kursiv geschrieben, da im Originaltext, alle Notizen (die Briefe nicht) so geschrieben sind. Dies vermittelt für mich das Gefühl es handgeschrieben zu lesen, was Notizen ja auch sind. Durch diese Schriftformatierung und die Überschriften heben sich diese Texte deutlich von dem Rest ab und bleiben wahrscheinlich stärker im Gedächtnis. Dadurch, dass sie kursiv geschrieben sind wirken sie lebendiger, man bekommt das Gefühl man wäre direkt beim Schreiben dabei, wodurch die Emotionen beim Lesen noch verstärkt werden.
Es ist sehr interessant wie gut es Irvine D. Yalom gelungen ist die Stimmung des Wiens des fine de siecle zu reproduzieren. Er beschreibt sowohl die Einrichtung sehr gut als auch die Stadt. Als Wiener hat man beim Lesen nicht das Gefühl von einer fremden Stadt zu lesen. Dies finde ich persönlich sehr wichtig. Er beschreibt sowohl die authentischen Gassen, als auch die Pflastersteinstrassen, wie auch die Pferdekutschen im Regen. Meistens, wenn er Wetter beschreibt ist dieses düster - was sehr stark an die damals herrschende Stimmung erinnert. Diese Parallelen sind mit Sicherheit kein Zufall, da es besonders für amerikanische Autoren typisch ist, dass sie diese Parallelen ziehen.
Besonders faszinierend ist es, wie gut ihm die Umsetzung der Charaktere gelungen ist. Sie wirken wirklich so wie man sie sich vorstellen würde. Für mich schimmert nichts von der Persönlichkeit des Autors durch die Darsteller.
Irvine D. Yalom beschreibt ausführlich das Leben Breuers und streift dabei oft das Leben Freuds und Nietzsches, wodurch man einen Eindruck in das Leben dieser Darsteller hat. Durch dieses Buch habe ich jetzt ein viel besseres Verständnis für diese Zeit, und die im Roman vorkommenden Personen.
Der Autor streift mit seinem Werk auch das Problem des Antisemitismus, der zu dieser Zeit in Wien (und nicht nur in Wien) ein echtes Problem war. Dabei wird einem allerdings klar, dass es eigentlich nicht um „rassische“ Unterschiede geht, sondern eigentlich nur um Macht. Hierfür möchte ich ein Beispiel geben. Freud und Breuer reden oft über die Universität und wie es Freud dort geht. Der junge Freud hätte dort fast einen guten Posten bekommen, doch da er Jude war, musste ein weniger qualifizierter Arzt eingesetzt werden. Bei diesen Szenen hat man aber nicht das Gefühl, dass Juden als minderwertig gesehen werden würden. Es wird einem beim Lesen klar, dass es einfach nur um Macht ging. Der Antisemitismus konnte sich in der Wiener Universität (und dies trifft sicher nicht nur auf die Universität zu) nur durchsetzen, weil bestimmte Leute hinauf wollten und diese ihre Freunde und Verwandten einsetzten. Um diese an die Spitze zu bringen, wurde auch auf diese Art argumentiert. Dies ist wenn man sich den Wahlkampf eines Luegers anschaut leider traurige Wirklichkeit. Auch ihm ging es nicht darum, dass er Juden nicht mochte, man sollte sein bekanntestes Zitat „Wer ein Jude ist bestimme ich.“ nicht vergessen, sondern dass er regieren wollte und das mit allen Mitteln.
Dieses Buch kann man mit ruhigem Gewissen jedem empfehlen, der gerne einmal einen Einblick in die Psychologie und die Philosophie Nietzsches oder in das Wien der Jahrhundertwende bekommen möchte, oder einfach nur gerne liest, denn dieses Werk ist ein genialer Roman, der für jeden etwas in sich birgt. Außerdem ist er wirklich sehr lehrreich.
Quellenverzeichnis
Primärliteratur
Yalom, Irvine D., Und Nietzsche weinte, Ernst Kabel Verlag, Hamburg, Juni 1996
Sekundärliteratur
Die von Irvine D. Yalom selbst verfasste Biographie (auf Englisch) http://www.yalom.com/bionote.html
Bilderverzeichnis
Deckblatt (Klimt, Gustav)
http://www.wasserburg-inn.de/herbert-huber/IMAGES/Yalomunw.gif
Irvine D. Yalom
http://pages.vossnet.de/leselust/Bilder/yalomirvin.jpg
Friedrich Willhelm Nietzsche
http://www.nietzsche.de/images/nietzsche_photo_neu.gif
Josef Breuer
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.data.image.b/b758474a.jps
Sigmund Freud
http://freud.t0.or.at/freud/images/sigmund2.jpg
Lou Andreas-Salomé
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Leseprobe zu "Und Nietzsche weinte"?
Diese Leseprobe bietet einen umfassenden Überblick über das Buch "Und Nietzsche weinte". Sie beinhaltet eine Biographie des Autors Irvin D. Yalom, Beschreibungen der Hauptcharaktere, eine Zusammenfassung der Handlung, Anmerkungen des Autors, eine Kritik des Buches und ein Quellenverzeichnis. Es ist eine Vorschau auf die zentralen Themen, die im Roman behandelt werden.
Wer sind die Hauptcharaktere im Buch?
Die Hauptcharaktere sind:
- Friedrich Wilhelm Nietzsche: Ein Philosoph, der mit Verzweiflung kämpft.
- Dr. Josef Breuer: Ein Wiener Arzt in der Midlife-Crisis.
- Sigmund Freud: Ein junger Wissenschaftler, der sich mit Träumen beschäftigt.
- Lou Andreas-Salomé: Eine junge Philosophin, die Nietzsche um Hilfe bittet.
Was ist die Handlung des Romans?
Die Handlung dreht sich um Lou Andreas-Salomé, die Dr. Josef Breuer kontaktiert, um Friedrich Nietzsche von seiner Verzweiflung zu heilen. Breuer behandelt Nietzsche unter dem Vorwand, seine Migräne zu behandeln. Im Gegenzug behandelt Nietzsche Breuer gegen seine Midlife-Crisis. Durch diese ungewöhnliche Therapie tauschen die beiden Männer ihre Probleme aus und helfen sich gegenseitig, ihr Leben zu verändern.
Sind die Ereignisse im Roman historisch korrekt?
Die meisten Personen im Roman haben tatsächlich existiert und die Lebensumstände basieren auf Tatsachen. Allerdings haben sich Josef Breuer und Friedrich Nietzsche im wirklichen Leben nie getroffen. Der Autor hat historische Fakten mit Fiktion vermischt, um eine fesselnde Geschichte zu erzählen.
Was sind die Anmerkungen des Autors?
In seinen Anmerkungen erklärt Irvin D. Yalom, welche Teile des Romans auf Fakten beruhen und welche erfunden sind. Er geht auch auf die Frage ein, ob Breuer eine Affäre mit Bertha Pappenheim hatte und wie er Nietzsches Krankheitsbild recherchiert hat.
Was ist die Kritik des Buches?
Die Kritik hebt Yaloms fesselnden Schreibstil und die Fähigkeit hervor, das Wien der Jahrhundertwende authentisch darzustellen. Besonders interessant ist die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven auf dieselben Ereignisse, die zeigt, wie leicht Missverständnisse entstehen können.
Welche Quellen hat der Autor verwendet?
Yalom hat sich auf Primärliteratur (eigene Werke Nietzsches) und Sekundärliteratur (Biographien und wissenschaftliche Artikel) gestützt. Er erwähnt auch, dass er mit Philosophieprofessoren zusammengearbeitet hat, um den philosophischen Hintergrund korrekt darzustellen.
Welches Problem wird hier über Antisemitismus angesprochen?
Hier ist eine Situation von Freud geschildert, in welcher er wegen seines jüdischen Glaubens keine bessere Anstellung bekommt. Es wird beschrieben, dass es beim Antisemitismus in Wien weniger um "rassische" Unterschiede und mehr um Macht ging.
- Quote paper
- Klaus Csadek (Author), 2000, Yalom, Irvin D. - Und Nietzsche weinte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106893