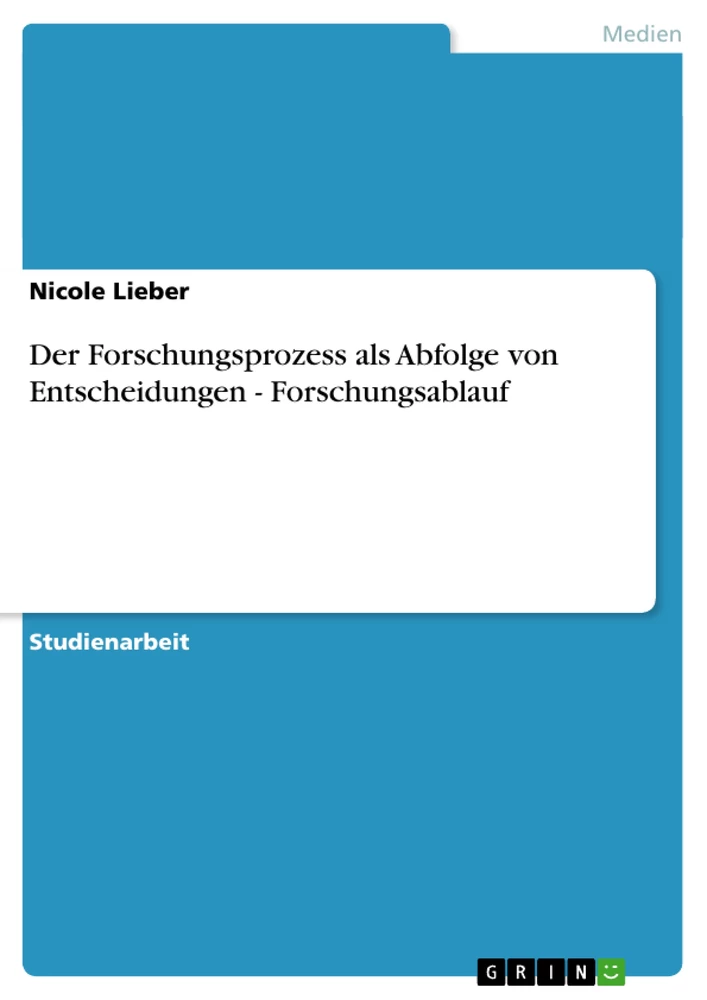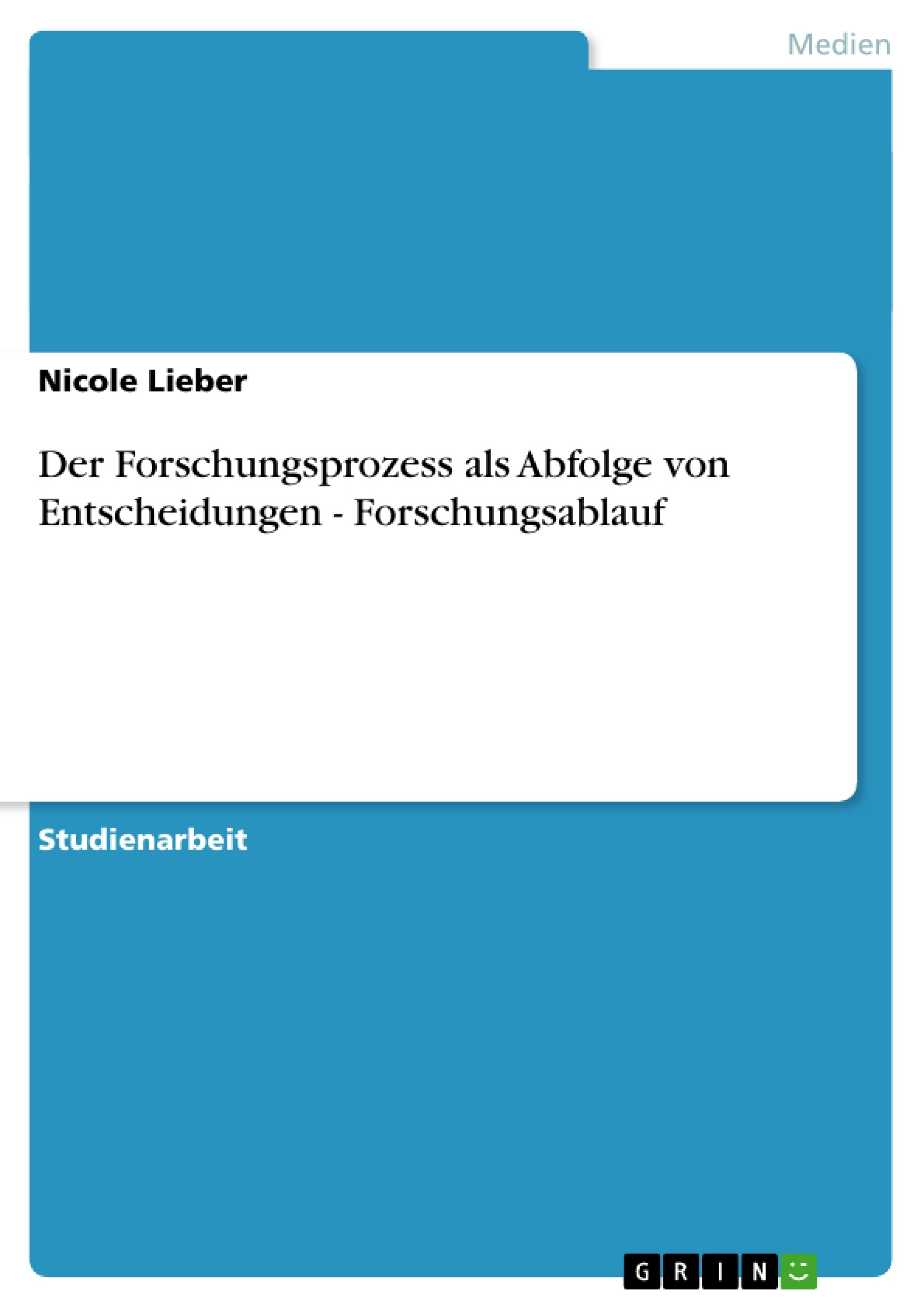Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
2. FORSCHUNGSPROZEß
3. ENTDECKUNGSZUSAMMENHANG
4. BEGRÜNDUNGSZUSAMMENHANG
4.1 KONZEPTSPEZIFIKATION
4.2 OPERATIONALISIERUNG
4.3 FORSCHUNGSDESIGN
4.4 AUSWAHL DER UNTERSUCHUNGSEINHEITEN
4.5 PRETEST
4.6 DATENERHEBUNG
4.7 DATENERHEBUNG
4.8 DATENANALYSE
5. VERWERTUNGSZUSAMMENHANG
6. VALIDITÄT, RELIABILITÄT, OBJEKTIVITÄT
7. ZUSAMMENFASSUNG
LITERATURVERZEICHNIS ANHANG: ABBILDUNGEN
1. Einleitung
Unsere Umwelt wird immer komplexer und undurchschaubarer, so daß es für uns Menschen schwieriger wird, Zusammenhänge zu verstehen und Erklärungen für alltägliche Phänomene zu finden.
Um so mehr spielt die empirische Sozialforschung in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Unser Alltag wird durch die Ergebnisse und Daten der Forschung geprägt, die uns die nötigen Erklärungen und Informationen bieten, um in der Gesellschaft zu existieren.
Gleichzeitig steigt aber auch das Mißtrauen und die Skepsis gegenüber der Forschung. Das Entstehen der Daten erscheint den Menschen undurchsichtig und ihrer Kontrolle entzogen. Umfragen und fragwürdige Ergebnisse von unseriösen Firmen schüren das Mißtrauen gegenüber der Forschung und seinen Ergebnissen.
Da die Ergebnisse solcher unseriösen Forschungsprojekte meist durch das Nichtan- wenden von theoretisch und experimentell begründeten Regeln entstehen (Schnell/Hill/ Esser 1995, S.5), möchte ich in meiner Hausarbeit darstellen, wie ein gut geplantes und nach dem Regelwerk der Sozialforschung durchgeführtes Forschungsprojekt auszusehen hat.
Mein Ziel ist es, den Ablauf der Forschung und das Entstehen der Daten zu beleuchten, und eine Übersicht und Zusammenfassung zu geben, die über die wichtigsten Entscheidungen und Probleme eines Forschungsprozesses informiert.
Es soll gezeigt werden, daß Forschung einerseits aus den Entscheidungen des Forschers hervorgeht, daß es sich aber nicht um einen willkürlichen Entscheidungsprozeß handelt, sondern daß Regeln und Normen, sowie der Untersuchungsgegenstand berücksichtigt werden müssen.
Des weiteren werden grundlegende und einführende Begriffe der Sozialforschung erklärt, verschiedene Modelle des Forschungsprozesses aufgezeigt und Beispiele genannt.
Meine Darstellung kann allerdings in den einzelnen Kapiteln keinen Vollständigkeitsanspruch erheben, da ein tieferes Eindringen in die einzelnen Forschungsschritte den Umfang dieser Hausarbeit bei weiten überschreiten würde.
2. Forschungsprozeß
Erste Hinweise auf die Charakteristiken eines Forschungsprozesses finden sich in der Definition des Begriffes 'empirische Sozialforschung'. Hier möchte ich mich an das Buch von PETER ATTESLANDER halten, der empirische Sozialforschung folgendermaßen definiert:
"Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung sozialer Erscheinungen." (Atteslander 1995, S. 13)
Dabei bedeutet 'systematisch', daß das Erkunden der Umwelt nach Regeln geschieht und daß der Forschungsverlauf nach bestimmten Voraussetzungen geplant werden muß. (Atteslander 1995, S.11/12)
In dieser Definition werden zwei wichtige Merkmale des Forschungsprozesses deutlich. Einerseits unterliegt jedes Forschungsprojekt einem Standard. Das bedeutet, daß der Forschungsprozeß kein willkürliches Handeln eines Forschers ist, sondern daß bestimmte Anforderungen erfüllt und Regeln eingehalten werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel das Einhalten der Kriterien Reliabilität, Objektivität und Validität. (s. Kapitel 6)
Andererseits aber hat jede Untersuchung seine spezielle, individuelle Art, die es zu berücksichtigen gilt. Es gibt für den Forschungsverlauf kein allgemeingültiges Patentrezept. (Kromrey 1994, S.55)
Demnach muß für jedes Forschungsprojekt je nach Untersuchungsgegenstand, finanzieller Mittel und Interesse ein angemessener Untersuchungsplan entwickelt werden. Aufgabe eines jeden Forschers ist es, diese beiden Charakteristika, den Standard, sowie die Individualität in den Forschungsprozeß zu integrieren.
Aufgrund der verschiedenen und vielfältig möglichen Forschungsansätze, Erhebungsverfahren und Analysemethoden, und der Tatsache, daß ein Forschungsprozeß eine Einheit darstellt, ist es schwierig ein allgemeines und detailliertes Modell für den Ablauf eines Forschungsprozess zu entwickeln. (Alemann 1977, S.147)
Trotzdem hat sich die empirische Sozialforschung auf ein bestimmtes Vorgehen bei der Untersuchung sozialer Realität geeinigt, so daß, obwohl jedes Forschungsprojekt anders verläuft, der Forschungsprozeß in wichtige und grundlegende Phasen unterteilt werden kann, die in einem systematischen Zusammenhang stehen. (Alemann 1977, S.57/58) Viele Autoren und Forscher verwenden deshalb Phasenmodelle, die den Forschungsprozeß verkürzt, strukturiert und vereinfacht darstellen. Einige wichtige Modelle sind im Anhang zu finden. (s. Anhang Abb.1 bis 7)
Natürlich erheben diese Modelle keinen Anspruch, den Forschungsprozeß vollständig abzubilden. Sie stellen eine Verkürzung dar. Auch die Reihenfolge der Phasen hat immer nur einen idealtypischen Charakter, das heißt, die Phasen laufen nicht immer linear ab, sondern sind miteinander verzahnt. Im realen Forschungsablauf finden Überschneidungen, Sprünge und Rückkopplungen zwischen den Forschungsschritten statt. (Kromrey 1994, S.58/59)
Deshalb sollte die Planung für ein Projekt immer flexibel erfolgen, so daß Vor- und Rücksprünge und eventuell die Zurücknahme von Entscheidungen möglich sind. (Diekmann 1995, S.171)
Da die einzelnen Phasen des Forschungsprozesses voneinander abhängig sind, das heißt, daß Fehler in früheren Schritten negative Auswirkungen auf weitere Schritte haben, darf der Forscher bei jeder Entscheidung, die späteren Phasen nicht aus dem Blickwinkel verlieren. (Selltiz 1972, S.16)
In jeder Forschungsphase werden verschiedene Arbeitsschritte unterschieden, sind eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen und Optionen zu wählen (z.B. Wahl der Instrumente, Wahl der Stichprobe usw.). Die Wahl der Optionen hängt ab vom Forschungsgegenstand, Forschungsziel, den Forschungsressourcen und von der Ein-schätzung des Forschers, auf die für das Forschungsziel bestgeeigneten Methode. (Diekmann 1995, S.165)
Diese getroffenen Entscheidungen haben erhebliche Auswirkungen auf das Forschungsergebnis und sind deshalb sorgfältig zu dokumentieren, um eine spätere Nachprüfbarkeit zu gewährleisten. (Kromrey 1994, S.59)
Ein Forschungsablauf läßt sich in drei große Abschnitte unterteilen, die eine Einheit im Forschungsprozeß bilden. Dies sind der Entdeckungs-, Begründungs- und Verwertungs- zusammenhang. Unter dem Entdeckungszusammenhang versteht man den Anlaß, der zu einem Forschungsprojekt geführt hat. (Friedrichs 1990, S.50) Näheres dazu im Kapitel 3. Der Begründungszusammenhang umfaßt die einzelnen methodischen Schritte, mit denen das gestellte Problem gelöst werden soll. (Friedrichs 1990, S.52/53) Es ist die Haupt-phase im Forschungsprozeß und umfaßt deshalb mehrere Zwischenschritte, die in den Abschnitten 4.1 bis 4.9 genauer erläutert werden. Unter dem Verwertungszusammen-hang versteht man die Effekte einer Untersuchung, die weitere Verwendung der Ergeb-nisse zur Lösung des Forschungsproblems. Dazu in Kapitel 5 nähere Ausführungen.
3. Entdeckungszusammenhang
Am Anfang eines jeden Forschungsprojektes steht die Klärung des Entdeckungszusammenhangs, im englischen 'context of discovery' genannt.
In dieser ersten Phase des Forschungsprozesses werden die für den weiteren Forschungsverlauf wichtigen Entscheidungen getroffen und die optimalen Bedingungen geschaffen. Die Phase ist der Konzeptualisierung einer Untersuchung gewidmet. Sie steuert alle weiteren Entscheidungen über Methode, Stichprobe, Auswertung und Verwertung. (Friedrichs 1990, S.54) Deshalb sollte sie in einer Untersuchung wichtig genommen und gründlich durchgeführt werden.
Da Forschung immer in einer Interessenkonstellation steht (Interessen des Forschers, des Auftraggebers), ist es wichtig Transparenz herzustellen. Die Grundmotivation für die Forschung, das Erkenntnisinteresse und das Vorverständnis für das Problem müssen offengelegt und die Erklärungsbedürftigkeit des Problems nachgewiesen werden. Wessen Interessen vertreten werden und für welchen Zweck die Ergebnisse dienen, muß der Forscher deutlich machen.
Jede Untersuchung beginnt mit der Festlegung des Forschungsgegenstandes. Ein For- schungsproblem muß ausgewählt, grob formuliert und von anderen Problembereichen abgegrenzt werden. Inwiefern ein Forschungsproblem schon vorgegeben und vorfor- muliert ist, hängt davon ab, ob es sich um eine von den Forschern selbst initiierte For- schung oder um Auftragsforschung handelt. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.8) Bei einer Auftragsforschung ist das Thema bzw. Forschungsproblem mehr oder weniger exakt durch den Auftraggeber vorgegeben. Der Spielraum des Forschers beschränkt sich bei der Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes meist auf eine engere Definition des Forschungsgegenstandes. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.8) Ist die Untersuchung von den Forschern selbstinitiiert, ist der Spielraum bei der Bestim- mung des Untersuchungsgegenstandes viel größer. Das Interesse ist hier ein Eigen- interesse des Forschers. Die konkrete Wahl für einen bestimmten Untersuchungs- gegenstand hängt von der jeweils aktuellen Forschungssituation, wie sie sich in der Fachliteratur zeigt, von dem Interesse und der Spezialisierung des Forschers ab. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.8)
Beispiel:
Eine Firma möchte wissen, wie es die Krankheitsrate seiner Mitarbeiter senken kann. Problem: Die Einflußfaktoren auf den Gesundheitszustand eines Menschen. Forschungsfrage: Wie wirkt sich das Freizeitverhalten auf Gesundheitszustand aus?
Das Forschungsziel unterscheidet sich mit jeder Forschungsuntersuchung und sollte in der Phase des Erkenntniszusammenhangs bestimmt werden. Der generelle Zweck von Forschung besteht laut CLAIRE SELLTIZ in dem Ziel: "durch die Anwendung wissen- schaftlicher Verfahren sinnvolle Antworten auf sinnvolle Fragen zu finden." (Selltiz 1972, S.9)
Im Allgemeinen lassen sich zwei oberste Ziele für die Forschung beschreiben. Einerseits wird mit Forschungsprojekten ein praktisches Ziel verfolgt, nämlich der Wunsch, etwas zu wissen, um etwas besser zu tun. So soll ein rationales und humaneres Leben der Menschen und eine Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen ermöglicht werden. Andererseits verfolgt man mit empirischer Forschung auch ein theoretisches Ziel, der Wunsch, etwas zu wissen, um des Wissens Willen. Dazu gehören das Konstruieren eines objektiv nachprüfbaren theoretischen Modells der Realität und die systematische Prüfung von Theorien. (Friedrichs 1990, S.14)
Diese Ziele sind natürlich zu allgemein gefaßt und müssen in jedem Forschungsprojekt spezifisch herausgearbeitet und festgelegt werden.
Ausgehend von den zwei großen Zielen der empirischen Forschung lassen sich soziale/ praktische Probleme von wissenschaftlichen Problemen unterscheiden. Während man unter sozialen Problemen, solche Probleme versteht, deren Bezug, das Funktionieren der Gesellschaft ist und durch deren Lösung soziale Veränderungen er- möglicht werden sollen, liegt der Ausgangspunkt bei wissenschaftlichen Problemen in dem Funktionieren der Forschung mit dem Ziel, zu Theorien sozialer Vorgänge zu kom- men. (Alemann 1977, S.60)
Nachdem der Forscher sich für ein Forschungsproblem entschieden hat, beginnt die Phase der Theoriebildung. Um einen aktuellen Überblick über den vorhandenen Wissensstand, vorangegangene Untersuchungen und Forschungsergebnisse zu bekommen, muß der Forscher sich einem intensiven Literaturstudium widmen. Er sollte analysieren, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse und Theorien schon zu dem Problem vorliegen und sich über Lösungsansätze informieren.
Läßt sich nach einer gründlichen Literaturanalyse keine bereits vorhandene Theorie finden, muß der Forscher eine neue Theorie entwickeln oder eine Theorie von einem verwandten Gegenstandsbereich übertragen. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.9)
In der Phase des Erkenntniszusammenhangs sollte sich der Forscher schon Gedanken um die Abgrenzung des Problems machen. Dabei sollte er sich entscheiden, auf welchen Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit er sich beschränken will, welche Gruppe schen, welche Zeiträume und Orte erfaßt werden sollen und ob Einzelfragen oder generell das Thema im Vordergrund stehen. Diese Problembegrenzung hat aber nur vorläufigen Charakter. Im Verlaufe des Forschungsprozesses wird sie noch verändert und exakter vorgenommen. (Atteslander 1995, S.34)
Die theoretische Vorbereitung ist das Kernstück eines Forschungsprojektes. Eine inten- sive Beschäftigung mit dem Gegenstand, die Vorstrukturierung des Gegenstandsbereichs und die grobe Formulierung der Forschungsfragen bilden die Basis einer jeden Forschung. Natürlich reicht eine gründliche Vorbereitung nicht aus, um relevante Ergebnisse zu erzielen. Fehler und Mängel in den weiteren Arbeitsschritten können gute theoretische Vorbereitungen vernichten. Dennoch steckt diese erste Phase "den maximalen Bereich des möglichen Erkenntnisgewinns" ab. (Mayntz/Holm/Hübner 1978, S.26)
4. Begründungszusammenhang
Jetzt komme ich zu der Hauptphase des Forschungsprozesses - dem Begründungszusammenhang oder 'context of justification'. Das Ziel dieser Phase ist es, den theoretischen Ansatz umzusetzen, das heißt, die zuvor aufgestellte(n) Hypothese(n) möglichst exakt und objektiv zu prüfen.
Es ist die Arbeit an und mit dem Gegenstandsbereich. Wie schon erwähnt, umfaßt diese Phase die einzelnen methodischen Schritte, mit denen das gestellte Problem gelöst werden soll. (Friedrichs 1990, S. 52/53)
Dazu gehören der Entwurf des Forschungsplans, die Wahl der Methode, der Untersuchungseinheiten und der Erhebungsinstrumente. (Atteslander 1995, S.68/69) Da die begriffliche Unterteilung dieser Phase bei den verschiedenen Autoren variiert, habe ich mich an die Einteilung von SCHNELL, HILL und ESSER gehalten, die sehr übersichtlich und verständlich ist. (siehe Anhang Abb.2/7)
Ich unterteile die Phase des Begründungszusammenhangs in folgende Arbeitsschritte:
Konzeptspezifikation (Kap. 4.1)
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Operationalisierung (Kap. 4.2)
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Forschungsdesign (Kap 4.3)
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Auswahl der Untersuchungseinheiten (Kap. 4.4)
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Pretest (Kap. 4.5)
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Datenerhebung (Kap. 4.6)
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Datenerfassung (Kap. 4.7)
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Datenanalyse (Kap. 4.8).
4.1. Konzeptspezifikation
Jetzt beginnt die eigentliche Phase der Problemformulierung. Jede empirische Untersuchung setzt eine Präzisierung der Aufgabenstellung und der zur Erklärung verwendeten Konzepte und Begriffe voraus. Man muß diese Begriffe von anderen Begriffen ab-grenzen und klären, welche Aspekte des theoretischen Begriffes berücksichtigt werden sollen. Diese Phase nennt man Konzeptspezifikation oder dimensionale Analyse. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.10)
Ziel dieses Vorgehens ist es, den Untersuchungsgegenstand in seine Aspekte zu zerlegen und zu strukturieren. Der Forscher sollte sich der Komplexität des Untersuchungs-gegenstandes bewußt werden und herausfiltern, welche Variablen eine Rolle spielen.
Dazu müssen bereits existierende Informationen über den Untersuchungsgegenstand zu- sammengetragen werden. In die Phase der Ideen- und Materialfindung gehören Litera- turanalyse, Expertenbefragung, Vorstudien und der Rückgriff auf vorhandene empirische Kenntnisse. Die gefundenen Informationen müssen systematisiert, und die für die Fragestellung besonders bedeutsamen Aspekte, zu denen später die Daten erhoben werden sollen, herausgefiltert werden. Man spricht auch davon, die "Dimensionen" der Wirklichkeit festzulegen und abzugrenzen. (Kromrey 1994, S.68, 84/85)
Hier zwei Beispiele für Begriffsdimensionen:
Das Freizeitverhalten läßt sich in die Dimensionen Unterhaltung/Kultur (Theater, Kino, Fernsehen, Bücher lesen usw.), Sport (Fitneßclub, Vereinssport, Joggen usw.) und Hobby (basteln, Gedichte schreiben, malen, Instrument spielen usw.) zerlegen.
Den Gesundheitszustand kann man in die Dimensionen Nicht-/Vorhandensein von Krankheiten, Empfinden von Glück/Unglück und soziales Wohlbefinden unterscheiden.
Hat der Forscher sich für die untersuchungsrelevanten Dimensionen entschieden, müssen für diese Dimensionen entsprechende Begriffe gefunden werden, die dann definiert werden. Unter Definition ist die Zuordnung sozialwissenschaftlicher Begriffe zu den als relevant angenommenen Dimensionen zu verstehen. Das bedeutet, daß geeignete sprachliche Symbole, die den Gegenstand abbilden, gewählt werden müssen. (Kromrey 1994, S.59)
Die Ergebnisse der dimensionalen Analyse bestimmen ganz entscheidend die Art und Qualität des potentiellen Ergebnisses der Forschung, da sie die Vielzahl der möglichen Erkenntnisse eingrenzen. Das heißt, daß: "Was jetzt ausgeblendet wird, darüber werden keine Forschungsresultate gewonnen." (Kromrey 1994, S.75) Deshalb sollte die beab- sichtigte Benutzung der Begriffe so präzise wie möglich beschrieben werden, so daß die Argumentation intersubjektiv nachprüfbar ist. (Kromrey 1994, S.98) Die Auswahlent- scheidung ist zu begründen, die Selektionskriterien offenzulegen und zu dokumentieren. Der Forscher sollte sich dabei fragen, was der Begriff in der Theorie bezeichnet, welche soziale Wirklichkeit er erfaßt und ob die Definitionen für die Forschungsfrage zweckmäßig sind. (Kromrey 1994, S.60/85)
Unter Verwendung der definierten Begriffe werden dann die forschungsleitenden Hypothesen aufgestellt, die am Ende des Forschungsprozesses verifiziert oder falsifiziert werden. Unter einer Hypothese sind Aussagen über Merkmalszusammenhänge zu verstehen. Das heißt: sie ist "eine Vermutungüber den Zusammenhang zwischen mindestens zwei Sachverhalten". (Kromrey 1994, S.41)
Diese Sachverhalte nennt man Variablen. Eine Variable bezeichnet ein Merkmal oder eine Eigenschaft von Personen oder Gruppen, Organisationen oder anderen Merkmals- trägern und kann verschiedenen Merkmalsausprägungen annehmen. (Diekmann 1995, S.100)
Beispiel:
Je mehr sportliche Aktivitäten in der Freizeit, um so weniger Krankheiten. Je mehr sportliche Aktivitäten in der Freizeit, um so mehr Krankheiten.
Die Variablen sind hier 'sportliche Aktivität' und 'Krankheit'. Die Variable 'sportliche Aktivität' kann die Merkmalsausprägungen: a) Joggen , b) Schwimmen, c) Boxen usw. annehmen, die Variable 'Krankheit a) krank und b) nicht krank.
4.2. Operationalisierung
Nach der Phase der Konzeptspezifikation hat der Forscher nun eine oder mehrere Hypo- thesen und deren definierten Begriffen. Die Definition der Begriffe sagt aber noch nichts darüber aus, wie diese Begriffe bzw. Merkmale gemessen werden sollen. (Diekmann 1995, S.182) Deshalb müssen den theoretischen Begriffen und Konstrukten, beobachtbare Sachverhalte zugeordnet werden, so daß Messungen möglich sind. Der Forscher braucht demnach "Indikatoren, die (ihm) das Vorliegen der mit den Begriffen bezeichneten Sachverhalten anzeigen, 'indizieren'". (Kromrey 1994, S.114)
Die Indikatoren müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Sie sollen eindeutig definiert sein, das heißt sie müssen für Forscher und Testperson unmißverständlich sein, sie sollen so beschaffen sein, daß sie die zu untersuchenden relevanten Aspekte beinhalten und sie sollen einen möglichst hohen Aktualitätsgrad haben, das heißt, die Testpersonen gut ansprechen. (Atteslander 1995, S.262)
Da die Wahl und Konstruktion von Indikatoren abhängig von der Erhebungsmethode ist, sollte jetzt spätestens die Entscheidung für die Erhebungsmethode (Befragung/ Interview, Experiment, Inhaltsanalyse, Beobachtung) getroffen werden. (Diekmann 1995, S.182)
Beispiel:
Die Variable Krankheit läßt sich nicht immer durch Beobachtung (Blässe, Amputation usw.) erfassen. Ein Indikator könnte zum Beispiel der Krankenbericht eines Arztes sein (abgesehen davon, daß dies rechtlich nicht möglich ist) bzw. die Antwort auf die Frage: Haben sie momentan eine Krankheit? Indem ich mich z.B. für die Frage entscheide, lege ich mich auf die Erhebungsmethode Befragung/ In- terview fest.
Um mit den Variablen arbeiten zu können, müssen diese in die mathematische Sprache übersetzt werden. Die geschieht durch das Anwenden von bestimmten Meß- und Skalierungsmethoden. (Atteslander 1995, S.262)
Demnach versteht die Sozialforschung unter Messen die "Zuordnung von Zahlen (Meßwerten) zu Objekten (Ausprägungen der Merkmale) gem äß festgelegten Regeln". (Schnell/Hill/Esser 1995, S.128)
Da man aber die Zahlen nach vielen unterschiedlichen Regeln einer Variable zuordnen kann, gibt es verschiedene Skalierungs- und Meßverfahren. Es muß das Verfahren gewählt werden, welches die Beziehungen der Meßwerte zueinander gemäß den Beziehungen der gemessenen Objekte abbildet, denn das Ziel der Messung ist eine 'strukturtreue Abbildung'. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.128/129)
Beispiel:
Das bedeutet: Wenn ich die Rangfolge der Größen der Studenten Klaus mit 1,52 m und Martin mit 1,72 und der Studentin Sabine mit 1,65 mit Zahlen darstellen will, dann muß die Rangabfolge der Zahlen der Rangabfolge der Realität entsprechen. Das würde heißen, daß ich Klaus die Zahl 1, Sabine die Zahl 2 und Martin die Zahl 3 zuordnen würde.
Man kann folgende Meßniveaus/Skalen unterscheiden.
Von einer Nominalskala spricht man, wenn durch die zugeordneten Zahlen nur Gleich- heit und Ungleichheit unterschieden werden soll. Die Zahlenwerte dienen der Bezeich- nung sich gegenseitig ausschließender Klassen/Kategorien und stellen somit eine Benennung dar. (z.B. Kontonummern, Geschlecht)
In welchem Alter sind Sie?
1. im erwerbsfähigen Alter
2. im nicht erwerbsfähigen Alter
3. keine Angabe
(Atteslander 1995, S.265) (Beispiel: Atteslander 1995, S.265)
Sollen neben Ungleichheit und Gleichheit auch die Rangfolge der Objekte bezüglich einer Eigenschaft dargestellt werden, dann verwendet man die Ordinalskala. Die zahlenmäßig festgelegte Rangfolge spiegelt aber nicht die Abstände der gemessenen Eigenschaft wider. (z.B. Schulnoten) (Atteslander 1995, S.265)
(Beispiel Atteslander 1995 S.266)
..Welcher Altersgruppe gehören Sie an?
1. bis 18 Jahre
2. 19 - 36 Jahre
3. 37 - 65 Jahre
4. über 65 Jahre
Bei einer Intervallskala werden zusätzlich zu den schon genannten Skaleneigenschaften auch die Abstände zwischen den Eigenschaften dargestellt. Allerdings existiert kein absoluter Nullpunkt, das heißt, daß die Verhältnisse der Zahlenwerte nicht gleich den Verhältnissen in der Realität entsprechen. (Atteslander 1995, S.265) (z.B.Temperatur nach Celsius: man kann nicht sagen:"10° sind doppelt so warm wie 5°")
In welchem Jahr sind Sie geboren? (Beispiel Atteslander 1995 S.266)
Geburtsjahr in die Klammer eintragen (...)
Handelt es sich um eine Ratioskala / Relationsskala, dann entsprechen die Größenverhältnisse der Zahlen auch den Verhältnissen der Merkmalsausprägungen. Es existiert ein absoluter Nullpunkt. (z.B. Länge, Zeit) (Atteslander 1995, S.265)
Wieviel Jahre sind Sie alt? (Beispiel Atteslander 1995
Alter in Jahren in die Klammern eintragen (..) S.266)
Für welchen Skalentyp/Meßverfahren sich der Forscher entscheidet, hängt von der Art der Daten, vom gewollten Aufwand, den Untersuchungszielen und von dem zu untersuchenden Merkmal ab.
Zusammenfassend kann man sagen, daß die Phase der Operationalisierung der Planung und Konstruktion des Meß- oder Erhebungsinstruments gewidmet ist. Diese Phase sollte sehr gewissenhaft und exakt durchgeführt werden, denn spätere Korrekturen in der Erhebungsphase sind sehr kostenaufwendig und mit erheblichen Mehraufwand verbunden. (Diekmann 1995, S.171)
4.3. Forschungsdesign
"Wann, wie, wo und wie oft die empirischen Indikatoren an welchen Objekten erfaßt werden" (Schnell/Hill/Esser 1995, S.203) sollen, wird in dem Arbeitsschritt der Bestimmung der Untersuchungsform/Forschungsdesign festgelegt. Kurz gesagt: Der Forscher muß die Art und Weise des Einsatzes vom Forschungsinstrument bestimmen.
Man kann drei Erhebungsarten, je nach zeitlichem Modus, unterscheiden: Querschnittdesign, Trenddesign und Paneldesign.
Von Querschnittdesign spricht man, wenn eine Eigenschaft einmalig bei einer bestimm- ten Untersuchungseinheit erhoben wird. Die Untersuchung bezieht sich auf nur einen Zeitpunkt und ist deshalb nicht geeignet, um Veränderungen darzustellen. (Diekmann 1995, S.267)
(Beispiel Diekmann 1995, S.268)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei Längsschnitterhebungen werden die Werte zu mehreren Zeitpunkten erhoben. Verwendet man für die verschiedenen Zeitpunkte die gleiche Stichprobe, dann spricht man von einem Paneldesign. Dieses Design ermöglicht das Nachvollziehen von Veränderungen auf der individuellen Ebene. Da aber die Stichprobe durch z.B. Sterblichkeit, Umzug, Nichterreichbarkeit oder Verweigerung gefährdet ist, erfordert diese Art der Erhebung eine sehr gute Adressenpflege. (Diekmann 1995, S.271)
(Beispiel Diekmann 1995, S.268)
Sind die Stichproben jeweils unterschiedlich, wenn es sich also um eine Abfolge von Querschnittserhebungen zum gleichen Thema handelt, nennt man dies Trenddesign. Damit können Veränderungen registriert werden, aber nur Veränderungen auf der Aggregatebene. (Diekmann 1995, S.286)
(Beispiel Diekmann 1995, S.269)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Neben dem zeitlichen Modus muß der Forscher sich auch entscheiden, ob die Untersuchung in einem Labor oder im Feld stattfinden soll.
Ein Labor ist speziell für die Zwecke der Untersuchung eingerichtet. Es ist eine künstlich geschaffene Umgebung, die es erlaubt, die Untersuchungsbedingungen zu standardisieren und zu kontrollieren. (Roth 1993, S.228)
Wenn man aber das Projekt in der natürlichen Umgebung, im alltäglichen sozialen Milieu des Untersuchungsobjekt vollzieht, spricht die empirische Sozialforschung von einem Felddesign. Es hat zwar den Nachteil, daß die Untersuchungsbedingungen nicht kontrolliert werden können, dafür befindet sich das Untersuchungsobjekt in seiner gewohnten Umgebung. (Roth 1993, S.228)
Mit dem Erhebungsdesign bestimmt der Forscher auch die Varianzkontrolle. Er entscheidet, ob eine Vergleichs- oder Kontrollgruppe vorhanden sein soll, und wie die Aufteilung von Untersuchungspersonen auf die Vergleichsgruppen erfolgen soll. (Diekmann 1995, S.289)
Für welche Untersuchungsart ein Forscher sich entscheidet, ist abhängig von den finanziellen Mitteln und der jeweiligen Erwünschtheit der Eigenschaften der entsprechenden Untersuchungsform. Als Ziel sollte der Forscher aber immer vor Augen haben, möglichst viele alternative Erklärungen durch Wahl des Forschungsdesign auszuschließen. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.10/11/203)
4.4. Auswahl der Untersuchungseinheiten
Da Vollerhebungen sehr teuer und aufwendig sind, erhebt man meist das Datenmaterial nicht für die ganze betreffende Gruppe (Grundgesamtheit/Population), sondern nur für einen Teil davon. Dieser Teil wird als Stichprobe oder im englischen als 'sample' bezeichnet. Dabei sollte die Stichprobe so ausgewählt werden, daß sie möglichst repräsentativ für die zugrundeliegende Gesamtheit ist. Das heißt, man benötigt Verfahren, die es erlauben gültige Aussagen für die Population zu machen, auch wenn man nur einen Teil dieser Population als Untersuchungsgegenstand auswählt. Ziel ist es, Rückschlüsse aus der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu ziehen. (Atteslander 1995, S.315) Um systematische Verzerrungen zu minimieren und repräsentative Stichproben auszuwählen, sollte der Forscher den Stichprobenplan sorgfältig auswählen.
Damit ein Forscher seine Untersuchung durchführen kann, muß er zunächst festlegen, auf welche Population oder auch Grundgesamtheit er seine Forschungsergebnisse be- zieht. Er muß die Population exakt definieren.. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.251) Im Anschluß daran muß bestimmt werden, in welcher Weise die Elemente der Grundge- samtheit ausgewählt werden sollen. Dies wird durch die Wahl eines Auswahl- /Stichprobenverfahren festgelegt. Mit Hilfe dieses Verfahrens werden dann die zu untersuchenden Elemente ausgewählt. Die Anzahl der ausgewählten Elemente nennt man Stichprobenumfang, dessen Größe von der Fragestellung und der erstrebten Genauigkeit der Schätzung abhängt. Im allgemeinen gilt bei einer Zufallsauswahl: je größer die Stichprobe, um so genauer die Schätzung. (Diekmann 1995, S.189)
Beispiel:
Firmenbefragung - alle Personen, die in der Firma X arbeiten, bilden die Grundgesamtheit, jeder Mitarbeiter ist ein Element der Grundgesamtheit, eine Auswahl von den Mitarbeitern ist eine Stichprobe.
Welche Arten von Stichprobenverfahren gibt es? (s. Anhang Abb.8)
Hier kann man zwei Hauptgruppen unterscheiden. Dies sind die Verfahren der Wahrscheinlichkeits-/Zufallsauswahl und der Quotenauswahl.
Bei einer Zufallsauswahl hat jedes Element der Population eine größer Null liegende angebbare Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe zu kommen. Je nach der Anzahl der Stufen, über die die Ziehung erfolgt, spricht man von einer 'Einfachen Zufallsauswahl' oder von einer 'Mehrstufigen Zufallsauswahl'. (Atteslander 1995, S.316)
Handelt es sich um systematische Verfahren, wird die Stichprobe nach vorgegebenen Regeln gezogen.
Man unterscheidet dabei zwischen 'Quotenverfahren' und 'Systematischer Auswahl'. Beim 'Quotenverfahren' teilt man die Grundgesamtheit in verschiedene Quoten, deren prozentuale Verteilung in der Bevölkerung bekannt sein muß. Anhand dieser Quoten oder auch Merkmalsverteilungen wird die beabsichtigte Stichprobe gezogen. (Atteslander 1995, S.319)
Bei einer 'systematischen Auswahl' greift man auf vorhandene fortlaufende Numerie- rungen, wie sie zum Beispiel bei Karteikarten oder Listen vorkommen, zurück und wählt dann nach bestimmten Regeln die Stichprobenelemente aus. (Atteslander 1995, S.319)
Beispiel:
Man kann die Firmenmitglieder nach Geschlecht unterteilen. Dazu verwendet man statistische Angaben: '54% der Bevölkerung sind Frauen, 46% sind Männer.' Nach diesen Angaben, werden die Elemente der Stichprobe ausgewählt: So werden in die Stichprobe 6 Männer und 4 Frauen genommen.
4.5. Pretest
Nachdem das Erhebungsinstrument ausgearbeitet wurde, muß dieses getestet werden, ob es gültige und zuverlässige Messungen erlaubt. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.10) Solch ein Pretest dient dem Zweck, Mängel zu entdecken und den zeitlichen Aufwand abzu-schätzen. Zeigen sich Probleme, muß das Erhebungsinstrument überarbeitet werden. Das heißt, die Arbeitsschritte der Konzeptualisierung, Operationalisierung, Bestimmung des Forschungsdesigns und Stichprobenauswahl sollten erneut durchgeführt und verbessert werden. Waren die Mängel und Fehler schwerwiegender, sollte nach den Verbesserungen ein erneuter Pretest erfolgen. (Diekmann 1995, S.190)
4.6. Datenerhebung
Hat sich das Erhebungsinstrument in dem Pretest bewährt, kann nun die eigentliche Datenerhebung mit der in den vorangegangenen Schritten gewählten Methode und dem Erhebungsinstrument erfolgen. Je nach Untersuchungsgegenstand und dem Ziel des Forschungsprojektes handelt es sich um eine Befragung (persönlich, telephonisch, schriftlich), Beobachtung, Experiment, Inhaltsanalyse oder um eine Kombination mehrerer Methoden. (s.Anhang Abb.9)
Die Durchführung muß protokolliert werden, um den Methodeneinsatz, die Ergebnisse und Fehler festzuhalten und die Intersubjektivität zu gewährleisten. Bevor die Methode angewandt wird, müssen die Mitarbeiter ausgewählt und geschult (z.B. die Interviewer), nötiges Material beschafft und, wenn nötig, die Testpersonen informiert werden. (Diekmann 1995, S.190)
4.7. Datenerfassung
Die durch den Einsatz der Methoden gewonnenen Daten müssen niedergeschrieben, aufbereitet und gespeichert werden, bevor sie im nächsten Arbeitsschritt analysiert werden können. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.12)
Dazu wird die Datensammlung strukturiert, gestrafft und verdichtet. Weiterhin werden die Daten auf Fehler kontrolliert, um diese zu bereinigen oder vom analysefähigen Daten-satz auszuschließen. (Diekmann 1995, S.546) Die kodierten Daten werden dann in ein analysefähiges Datenfile übertragen.
4.8. Datenanalyse
Erst durch die statistische Auswertung der Daten lassen sich Aussagen über die vorangestellten Hypothesen machen, denn "die erhobenen Daten 'sagen' von sich ausüber haupt nichts,...". (Schnell/Hill/Esser 1995, S.403)
Da jetzt ein analysefähiger Datensatz vorliegt, können die gesammelten Daten in Bezug auf die Fragestellung und die Hypothesen ausgewertet und interpretiert werden. Dazu ist eine Rückkopplung zwischen Theorie und empirischen Resultaten, die Suche nach Fehlern und die Diskussion der Methoden nötig. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.13) Um die Verteilungen einer Variable und Zusammenhänge zwischen zwei oder mehreren Variablen untersuchen zu können, verwendet man statistische Methoden (Tabellenanalysen, Korrelations- und Regressionsverfahren), meist unter Einsatz von Computern und speziellen Programmen. Dadurch kann man überprüfen, ob die in der Theorie vorhergesagten Beziehungen in den erhobenen Daten nachweisbar sind. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.12)
Welches statistische Analyseverfahren verwendet wird und welchen Umfang die Analyse einnimmt, ist abhängig vom Skalenniveau der Variablen und von der Art der Daten. (Diekmann 1995, S.170)
5. Verwertungszusammenhang
Nachdem die Datenerhebung vollzogen ist und die Daten analysiert wurden, so daß nun die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, ist die letzte Phase des Forschungsprojektes der Umsetzung der Forschungsergebnisse gewidmet. Die Ergebnisse müssen 'verwertet' werden, das heißt, sie sollten öffentlich gemacht und diskutiert werden, um zum wissenschaftlichen Fortschritt und zu praktischen Veränderungen des anfangs gestellten Problems beizutragen. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.13)
Dabei sollten die Ergebnisse in Zusammenhang mit der übergeordneten Fragestellung und dem gegenwärtigen Wissensstand gebracht werden.
Zur Verwertung eines Forschungsprojekts gibt es verschiedene Darstellungsformen. Unter anderem gehören dazu Publikationen (Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen), Öffentliche Vorträge, Pressemitteilungen, Forschungsbericht und Endbericht für den Geldgeber. Neben den Ergebnissen sollte eine Veröffentlichung auch die einzelnen methodischen Schritte, den theoretischen Bezugsrahmen, Kritik, Problemlösungen und neue Hypothesen in nachvollziehbarer Weise zur Diskussion bringen (Alemann 1977, S.137/138). Der Forscher sollte über den Forschungsverlauf reflektierend, sich mit folgenden Problemen auseinandersetzen. (Kromrey 1990, S.61/62)
- Können die berechneten Beziehungen zwischen den Daten in die Beziehungen zwischen den Dimensionen in der Realität zurückübersetzt werden?
- Können die Ergebnisse auf ähnliche Objekte oder auf eine größere Gesamtheit verallgemeinert werden? (Repräsentativität der Stichprobe)
- Sind die Daten zuverlässig gemessen/erhoben/aufbereitet worden? (Zuverlässigkeit)
- Sind die Indikatoren geeignet gewesen? (Gültigkeit der Operationalisierung)
- Wurden die vorher formulierten Hypothesen und Theorien bestätigt oder verifiziert??
- Was sind die Konsequenzen der Ergebnisse für die eingangs formulierte Frage- stellung?
Diese Fragen weisen auf das folgende Kapitel hin, das sich mit der Problematik Gültigkeit, Zuverlässigkeit auseinandersetzt.
6. Validität, Reliabilität, Objektivität
Wie schon in der Einleitung erwähnt, müssen Forschungsprojekte wissenschaftliche Standards erfüllen. Das heißt, daß die empirischen Messungen möglichst objektiv, zuverlässig und gültig sein müssen. Diese drei Eigenschaften, Objektivität, Reliabilität und Validität, nennt man die Gütekriterien einer Messung. Diese Kriterien zu erfüllen, muß das oberste Ziel aller Entscheidungen des Wissenschaftlers sein.
Unter Objektivität oder auch Intersubjektivität versteht man die Durchschaubarkeit, Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit einer Untersuchung. Ihr Grad gibt an, in welchem Ausmaß das Forschungsergebnis unabhängig von der subjektiven Sichtweise/ Person des Forschers, der das Projekt durchführt, ist. Eine vollständige Objektivität würde vorherrschen, wenn ein Erhebungsinstrument bei zwei verschiedenen Forschern die selben Ergebnisse messen würde. (Diekmann 1995, S.216)
Beispiel:
Benutzt Forscher A das Thermometer 1, um bei Sylvia Fieber zu messen, muß er die selbe Temperatur von 37,9° messen, die Forscher B mit Thermometer 1 bei Sylvia Fieber gemessen hat.
Reliabilität oder auch Zuverl äß lichkeit ist das zweite Kriterium, daß ein Forschungsprojekt erfüllen muß. Es dient zur Beurteilung der Brauchbarkeit des wissenschaftlichen Instrumentes. Der Grad der Reliabilität gibt an, inwiefern ein Instrument bei wiederholten Messungen unter gleichen Bedingungen immer die gleichen Resultate bringt. Es bestimmt die Stabilität der Meßwerte. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.141)
Beispiel:
Wenn der Forscher A mit dem Thermometer 1 zum Zeitpunkt 1, Fieber bei Sylvia mißt, und dies zum Zeitpunkt 2 und 3 usw. tut, dann ist das Thermometer 1 100% reliabel, wenn es zu jedem Zeitpunkt das selbe Ergebnis von 39,7° erzielt.
Validität oder auch Gültigkeit ist das stärkste Kriterium. Es steht für das Ausmaß, inwiefern das Instrument auch tatsächlich das mißt, was mit ihm festgestellt werden soll. Auch wenn ein Meßinstrument reliabel und objektiv ist, das heißt, daß es unabhängig vom Forscher und von der Situation die gleichen Ergebnisse erzielt, muß es noch lange nicht valide/gültig sein. (Schnell/Hill/Esser 1995, S.144)
Beispiel:
Das Thermometer 1 erzielt bei Forscher A und bei Forscher B, sowie zu jedem Zeitpunkt unter sonst gleichen Bedingungen immer das gleiche Ergebnis von 37,9°. Es mißt aber nicht die Temperatur, sondern die Hautfeuchtigkeit.
7. Zusammenfassung
In meiner Hausarbeit habe ich mich sehr intensiv mit den verschiedenen Darstellungen des Forschungsverlaufes von unterschiedlichen Autoren beschäftigt. Das war sehr verwirrend, denn jeder Autor verwendet eine andere Darstellungsweise, Übersichtlichkeit, Phasenbenennung und Genauigkeit.
Manche Punkte werden bei dem einen Autor erwähnt, bei dem anderen wiederum nicht, bei dem einen erfolgt die Einteilung der Phasen in die einzelnen Arbeitsschritte, bei dem anderen in eher grobe Phasen, manche Verfasser verwenden sehr einfache, übersichtliche (s.Anhang Abb.1) Modelle, andere wiederum sehr komplizierte. (s.Anhang Abb.6)
Da die Hausarbeit für mich eine Zusammenfassung des Grundstudiums und auch eine innere Gliederung des Bereiches empirische Sozialforschung, im engeren Sinne Kommunikationsforschung, darstellt, habe ich den Weg gewählt, ein Resümee aus den verschiedensten Büchern zu ziehen, und eine für mich übersichtliche Darstellung des Forschungsprozesses zu erstellen.
Trotz meiner sehr linearen Darstellungsweise der einzelnen Phasen, ist es wichtig immer in Gedanken zu haben, daß der Forschungsprozeß aus Rückkopplungen zu den vorange-gangenen Schritten, aus Überschneidungen und Vorüberlegungen zu den noch kommenden Schritten besteht. Man darf beim Vorgehen nicht vergessen, daß getroffenen Entscheidungen immer Auswirkungen auf den weiteren Verlauf haben, und daß deren spätere Zurücknahme oder Änderung sehr kostenaufwendig und zeitraubend ist.
Um der Wissenschaftlichkeit der empirischen Sozialforschung gerecht zu werden, müssen die in Kapitel 6 beschriebenen Kriterien erfüllt werden. Nicht der Auftraggeber sollte den Verlauf eines Forschungsprojektes bestimmen, sondern der Untersuchungs- gegenstand. Nicht die erwünschten oder erwarteten Resultate sollten den Maßstab einer Forschung bilden, sondern deren Objektivitäts-, Reliabilitäts- und Validitätsgrad. Um dies zu erreichen, ist es nötig, daß der Forscher während und am Ende des For- schungsprojektes, seine gesamten Entscheidungen in Frage stellt und kritisch überprüft, daß der Forschungsverlauf ausführlich beschrieben und anderen zugänglich gemacht wird. Nur so können wissenschaftliche Ergebnisse erzielt werden, die das Wissen erweitern und Probleme lösen können.
Im folgenden das von mir gezogene Resümee in einerübersicht:
Erkenntniszusammenhang
-Auswahl des Forschungsproblems
Auftraggeber/selbstinitiiert
Art des Forschungsproblems/Festlegung des Forschungsgegenstandes
Formulierung des Forschungsproblems
Forschungsinteresse
Forschungsziel
Relevanz des Problems
-Theoriebildung
Literaturanalyse
theoretischer Bezugsrahmen
alte Theorie/neue Theorie/
Begründungszusammenhang
-Konzeptspezifikation
Ideen- und Materialfindung
Dimensionen des Gegenstandes festlegen
Auswahl der relevanten Dimensionen
Begriffe definieren
Hypothesen aufstellen
-Operationalisierung
Indikatoren festlegen
Wahl der Meß - und Skalierungsmethode
-Forschungsdesign
zeitliche Modus der Erhebung (Längsschnitt-, Trend-, Paneldesign
Meßumgebung (Labor,Feld)
Varianzkontrolle(Vergleichsgruppe und deren Aufteilung)
-Stichprobe
Grundgesamtheit definieren
Auswahlverfahren wählen
-Pretest
-Datenerhebung
-Datenerfassung
Strukturierung der Daten
Verdichtung der Daten
Fehlerkontrolle
Speicherung
-Datenanalyse
Auswahl Analyseverfahren
statistische Auswertung
Rückkopplung zwischen Theorie und Resultat
Methodendiskussion
Verwertungszusammenhang
-praktische Umsetzung
-Veröffentlichung
Zeitschriften-, Buchveröffentlichungen
Vorträge
Forschungsbericht
Pressemitteilungen
Literaturverzeichnis
ALEMANN, Heine von: Der Forschungsprozeß. Eine Einführung in die Praxis der empirischen Sozialforschung. Stuttgart: Teubner, 1977.
ATTESLANDER, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin: WdeG, 1995.
DIEKMANN, Andreas: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbek: Ro, 1995.
FRIEDRICHS, Jürgen: Methoden empirischer Sozialforschung, Opladen: Westdt.Vlg., 14.Aufl.1990.
KROMREY, Helmut: Empirische Sozialforschung. Opladen: Leske+Budrich, 6.Aufl.,1994.
MAYNTZ, Renate/Kurt HOLM/ Peter HÜBNER: Einführung in die Methoden der empirischen Soziologie. Opladen Westdt. Verlag, 5. Aufl. 1978.
SCHNELL, Rainer/Paul B.HILL/Elke ESSER: Methoden der empirischen Sozialforschung. München, Wien: R.Oldenbourg, 5.vollständig bearb. und erw. Aufl.1995.
SCHRADER, Achim: Einführung in die empirische Sozialforschung. Stuttgart: Kohlhammer, 1971.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Forschungsprozess laut diesem Dokument?
Der Forschungsprozess wird als eine systematische Erfassung und Deutung sozialer Erscheinungen definiert. Er unterliegt einem Standard, der Anforderungen und Regeln beinhaltet (Reliabilität, Objektivität, Validität), aber berücksichtigt auch die Individualität jeder Untersuchung. Es gibt keinen allgemeingültigen Ablaufplan, sondern einen an den Forschungsgegenstand, die finanziellen Mittel und das Interesse angepassten Plan. Der Prozess wird in Entdeckungs-, Begründungs- und Verwertungszusammenhang unterteilt.
Was versteht man unter Entdeckungszusammenhang?
Der Entdeckungszusammenhang (context of discovery) ist der Anlass für ein Forschungsprojekt. Hier werden die grundlegenden Entscheidungen getroffen, die den weiteren Forschungsverlauf steuern. Transparenz hinsichtlich Interessen, Motivation und Vorverständnis für das Problem ist wichtig. Ebenso die Festlegung des Forschungsgegenstandes, Forschungsziels und die Durchführung einer Literaturanalyse zur Theoriebildung.
Was beinhaltet der Begründungszusammenhang?
Der Begründungszusammenhang (context of justification) ist die Hauptphase des Forschungsprozesses. Es handelt sich um die Umsetzung des theoretischen Ansatzes, die Überprüfung der Hypothesen. Dies beinhaltet: Konzeptspezifikation, Operationalisierung, Forschungsdesign, Auswahl der Untersuchungseinheiten, Pretest, Datenerhebung, Datenerfassung, Datenanalyse.
Was ist Konzeptspezifikation?
Konzeptspezifikation ist die Präzisierung der Aufgabenstellung und der verwendeten Konzepte und Begriffe. Dabei werden die Begriffe von anderen abgegrenzt und die relevanten Aspekte des theoretischen Begriffes bestimmt. Ziel ist es, den Untersuchungsgegenstand in seine Aspekte zu zerlegen und zu strukturieren.
Was bedeutet Operationalisierung im Forschungsprozess?
Operationalisierung bedeutet, den theoretischen Begriffen und Konstrukten beobachtbare Sachverhalte zuzuordnen, so dass Messungen möglich sind. Es werden Indikatoren benötigt, die das Vorliegen der mit den Begriffen bezeichneten Sachverhalten anzeigen. Hier wird die Entscheidung für eine Erhebungsmethode getroffen (Befragung/Interview, Experiment, Inhaltsanalyse, Beobachtung) und der Indikator dann der Messmethode angepasst.
Was ist Forschungsdesign?
Forschungsdesign legt fest, wann, wie, wo und wie oft die empirischen Indikatoren an welchen Objekten erfasst werden sollen. Es beinhaltet die Entscheidung für eine Erhebungsart (Querschnittdesign, Trenddesign, Paneldesign) und den Ort der Untersuchung (Labor oder Feld). Ebenso die Varianzkontrolle (Vergleichs- oder Kontrollgruppe).
Was ist bei der Auswahl der Untersuchungseinheiten zu beachten?
Da Vollerhebungen aufwendig sind, wird meist eine Stichprobe erhoben, die repräsentativ für die Grundgesamtheit sein sollte. Hier wird die Population definiert und ein Auswahl-/Stichprobenverfahren festgelegt (Zufallsauswahl, Quotenauswahl, systematische Auswahl). Die Anzahl der ausgewählten Elemente wird als Stichprobenumfang bezeichnet.
Was ist ein Pretest und wozu dient er?
Ein Pretest ist ein Test des Erhebungsinstruments, um sicherzustellen, dass es gültige und zuverlässige Messungen erlaubt. Er dient dazu, Mängel zu entdecken und den zeitlichen Aufwand abzuschätzen. Bei Problemen muss das Erhebungsinstrument überarbeitet werden.
Was passiert in der Phase der Datenerhebung?
Nach erfolgreichem Pretest erfolgt die eigentliche Datenerhebung mit der gewählten Methode und dem Erhebungsinstrument. Je nach Projekt kommt eine Befragung, Beobachtung, ein Experiment, eine Inhaltsanalyse oder eine Kombination von Methoden zum Einsatz. Die Durchführung wird protokolliert.
Was beinhaltet die Datenerfassung?
Die gewonnenen Daten werden niedergeschrieben, aufbereitet und gespeichert. Die Datensammlung wird strukturiert, gestrafft und verdichtet. Weiterhin werden die Daten auf Fehler kontrolliert und diese bereinigt. Die Daten werden dann in ein analysefähiges Datenfile übertragen.
Was geschieht in der Datenanalyse?
Durch statistische Auswertung der Daten können Aussagen über die aufgestellten Hypothesen gemacht werden. Es findet eine Rückkopplung zwischen Theorie und empirischen Resultaten statt, die Methoden werden diskutiert. Mit Hilfe statistischer Methoden (Tabellenanalysen, Korrelations- und Regressionsverfahren) kann man überprüfen, ob die vorhergesagten Beziehungen in den Daten nachweisbar sind.
Was ist der Verwertungszusammenhang?
Der Verwertungszusammenhang ist die letzte Phase des Forschungsprojektes. Die Ergebnisse werden öffentlich gemacht und diskutiert, um zum wissenschaftlichen Fortschritt und zu praktischen Veränderungen des anfangs gestellten Problems beizutragen. Die Ergebnisse werden in Zusammenhang mit der übergeordneten Fragestellung und dem Wissensstand gebracht.
Was bedeutet Objektivität, Reliabilität und Validität?
Objektivität (Intersubjektivität) bedeutet die Durchschaubarkeit, Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit einer Untersuchung. Reliabilität (Zuverlässigkeit) gibt an, inwiefern ein Instrument bei wiederholten Messungen unter gleichen Bedingungen die gleichen Resultate bringt. Validität (Gültigkeit) gibt an, inwiefern das Instrument tatsächlich das misst, was mit ihm festgestellt werden soll.
- Quote paper
- Nicole Lieber (Author), 1998, Der Forschungsprozess als Abfolge von Entscheidungen - Forschungsablauf, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106702