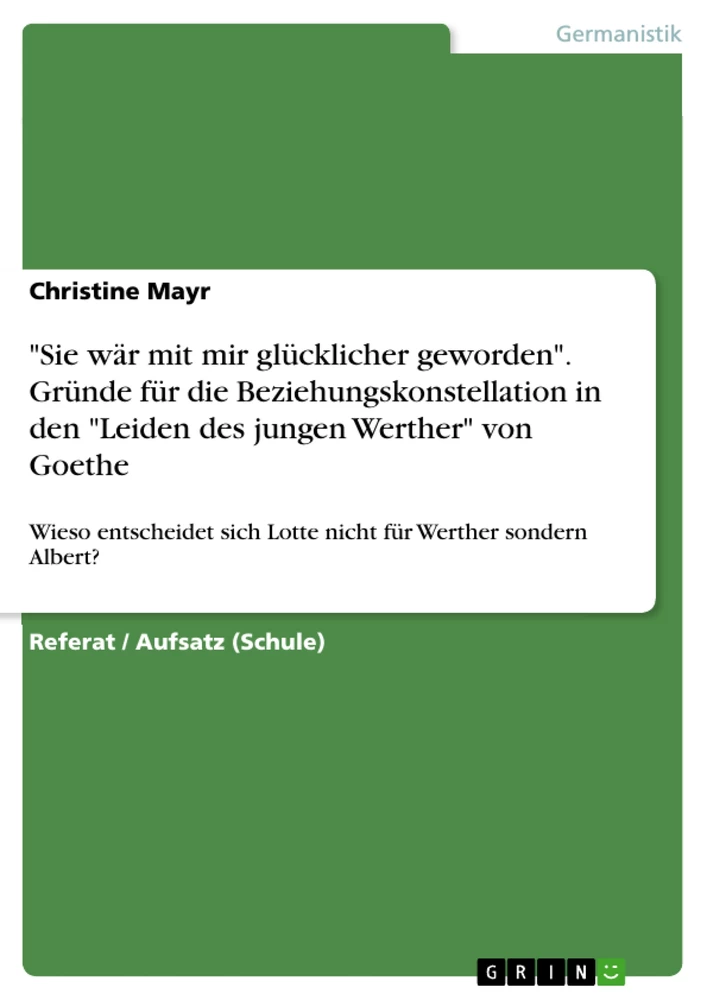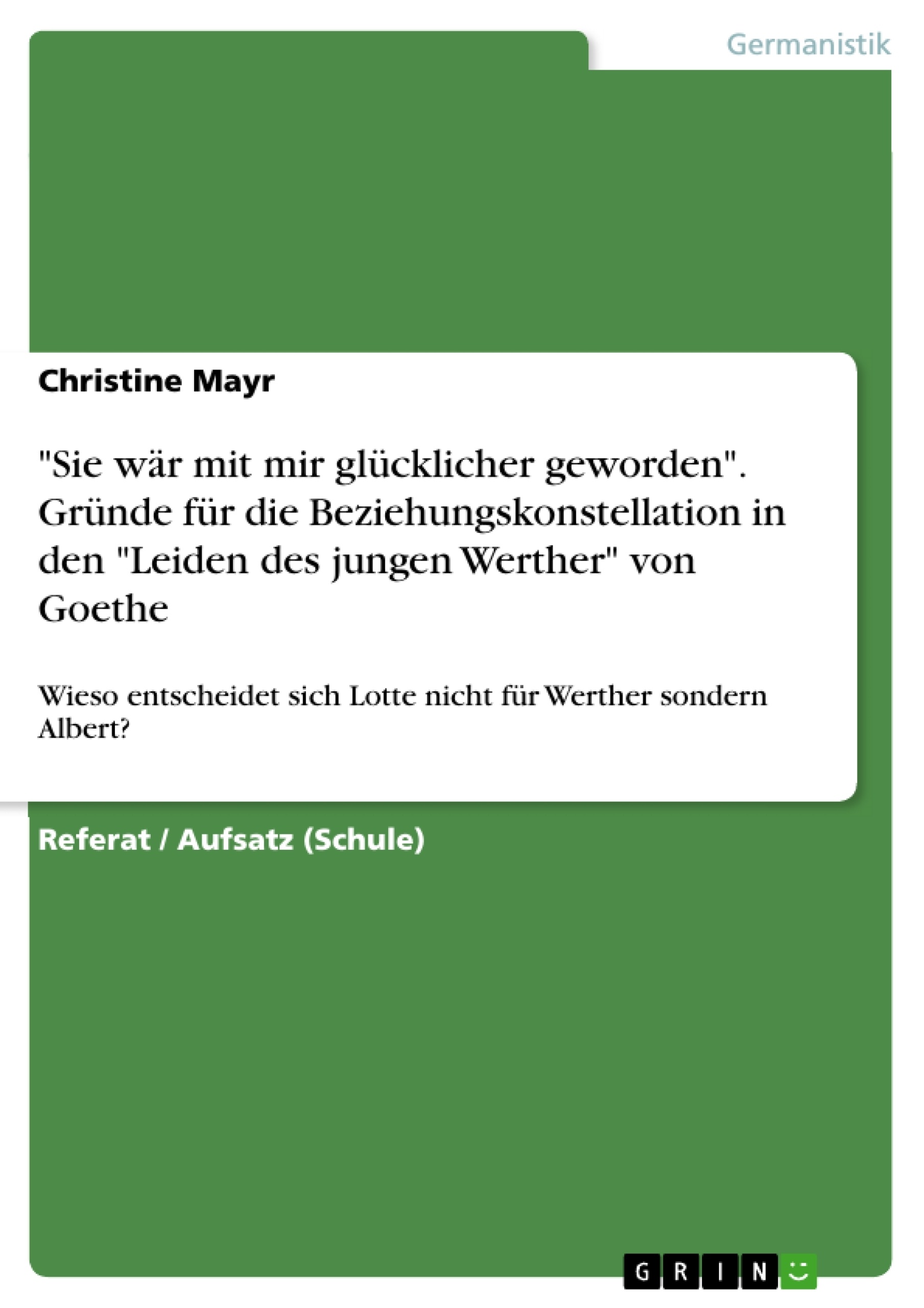Was treibt einen jungen Mann in den Selbstmord, wenn die Liebe seines Lebens unerreichbar scheint? In Johann Wolfgang von Goethes "Die Leiden des jungen Werther" wird der Leser in eine leidenschaftliche, gefühlvolle und letztlich tragische Welt entführt, in der die unerfüllte Liebe zu Lotte das Leben des jungen WertherMore and more completely consumes. Als ein Vertreter des Sturm und Drang, verkörpert Werther eine tiefe Sehnsucht nach gefühlvoller Erfüllung und natürlicher Harmonie, die in der bürgerlichen Gesellschaft seiner Zeit keinen Platz findet. Er idealisiert Lotte als eine Seelenverwandte, mit der er eine tiefe Verbindung in ihrer Liebe zur Literatur, zur Natur und zu Kindern spürt. Doch Lotte, hin- und hergerissen zwischen ihrer Zuneigung zu Werther und ihrer Verpflichtung gegenüber ihrem Verlobten Albert, wählt den Weg der bürgerlichen Vernunft und gesellschaftlichen Sicherheit. Albert, ein Mann von Festigkeit und Ansehen, bietet ihr ein Leben in geordneten Verhältnissen, das sie sich für sich und ihre Familie wünscht. Die Gemeinsamkeiten zwischen Lotte und Werther, ihre Seelenverwandtschaft und Werthers Idealisierung ihrer Person stehen im Kontrast zu Lottes Bedürfnissen nach Sicherheit, ihrem Pflichtgefühl gegenüber Albert und dem Wissen um Werthers emotionale Instabilität. Diese Analyse beleuchtet die Gründe für Werthers Überzeugung, dass Lotte an seiner Seite glücklicher wäre, sowie die gewichtigen Argumente, die Lottes Entscheidung für Albert untermauern. Es wird untersucht, wie Werthers romantische Vorstellung von Liebe eine Beziehung zu Lotte unmöglich macht und ihn letztendlich in die Verzweiflung treibt. Tauchen Sie ein in diese zeitlose Geschichte über Liebe, Verlust und die Konflikte zwischen Individuum und Gesellschaft, die bis heute Leser auf der ganzen Welt bewegt und die Frage aufwirft, ob wahre Liebe in einer Welt der Konventionen und Verpflichtungen überhaupt existieren kann. Entdecken Sie die psychologischen Tiefen der Charaktere und die gesellschaftlichen Zwänge, die ihr Handeln bestimmen, in einer literarischen Analyse, die neue Perspektiven auf Goethes Meisterwerk eröffnet. Erforschen Sie die philosophischen Aspekte von Liebe, Freiheit und Selbstaufgabe in einer bewegenden Erzählung, die den Leser bis zur letzten Seite in ihren Bann zieht und zum Nachdenken über die Bedeutung des Lebens anregt.
Gliederung:
A. Werther, als Vertreter des Sturm und Drang, und seine Auffassung von Liebe
B. Werthers Einschätzung, dass Lotte mit ihm glücklicher geworden wäre als mit Albert, und warum sich Lotte dennoch für Albert entscheidet
I. Gründe, die Werthers Einschätzung unterstützen
1. Gemeinsamkeiten zwischen Lotte und Werther
1.1. Tanzen
1.2. Literatur
1.3. Kinder
1.4. Liebe zur Natur
2. Idealisierung Lottes
3. Seelenverwandtschaft
II. Gründe für die Entscheidung Lottes dennoch bei Albert zu bleiben
1. Lotte braucht Sicherheit
1.1 Albert ist emotional gefestigt
1.2 Feste Anstellung Alberts
1.3 Albert ist gesellschaftlich gefestigt
2. Wunsch der Mutter
3. Pflichtgefühl Lottes gegenüber Albert
4. Werther ist zu labil
4.1. Emotional
4.2. Gesellschaftlich
C. Werthers Liebe zu Lotte ist chancenlos, da Werthers Auffassung von Liebe eine Beziehung unmöglich macht
Literaturverzeichnis
Ausführung:
„Die Leiden des jungen Werther“ wurden von Johann Wolfgang von Goethe 1774 in Form eines Briefromans geschrieben. In diesem Buch verfolgt man durch einen fiktiven Herausgeber, den Goethe die Briefe von Werther an seinen Freund Wilhelm hat sammeln und veröffentlichen lassen, das Leben Werthers über einen Zeitraum von 1 ½ Jahren. Goethe verarbeitete in seinem Werk autobiographische Erlebnisse. So ziehen sich eine unerfüllte Liebe Goethes und der Selbstmord eines seiner Kollegen, transponiert auf Werther, wie ein roter Faden durch das Buch. Besonders in Werthers Auffassung von Liebe wird seine Identität als gefühlsbetonter Vertreter des Sturm und Drangs klar. Wesendlicher Gesichtpunkt ist hierbei die Vorstellung Werthers, dass sich „in der Liebe [...] der natürliche Mensch [manifestiert], dem die der Natur entfremdete Gesellschaft ihr Arbeits- und Wirtschaftsethos entgegensetzt. Während der Liebende seiner Natur freien Lauf lässt, ist der Bürger damit beschäftigt seine Natur zu unterdrücken“ (Siepmann, S. 46). Werther ist der Auffassung, dass ein Mensch erst durch die Liebe seine ganze Möglichkeiten entfalten und zu einem höheren Selbstwertgefühl gelangen kann. Er ist der festen Überzeugung, dass in der Liebe die tiefsten Gefühle eines Menschen kommunikationsfähig sind und dass die Liebe in Gegensatz zur „bürgerlichen Vernunft“ (Siepmann, S. 46) steht. Diese grundlegenden Überzeugungen führen im Buch zu der unerfüllten Liebe zu Lotte. Die „bürgerliche Vernunft“ (Siepmann, S. 46) wird durch Lottes Verlobten Albert vertreten. Lotte steht zwischen den beiden Männern, und entscheidet sich letztendlich für Albert.
Werther sagt im Brief vom 29. Julius „sie wäre mit mir glücklicher geworden als mit ihm“ (29.Julius). Diese These begründet er mit verschiedenen Argumenten, die im folgenden erläutert werden.Daneben werden die Gründe für Lottes Entscheidung, dennoch bei Albert zu bleiben dargestellt.
Einer der Gründe für seine These sind die vielen Gemeinsamkeiten, die Werther zwischen sich und Lotte entdeckt.
Dazu gehören zum Beispiel das „Vergnügen am Tanze“ (16.Juny). Die Gemeinsamkeit zeigt sich beim ersten Kennenlernen auf dem Ball, als Lotte, die „eine leidenschaftliche Tänzerin [ist], deren Begeisterung zum Tanz keine Grenzen gesetzt sind“
(http://alou.mordor.sk/germanistika/dieleidendesjungenwerther.htm) erst mit ihrem Tanzpartner tanzt. Als sie aber erkennt, das auch Werther sehr gut „walzen“ (16.Juny) kann, tanzt sie auch mit ihm. Werther ist fasziniert von Lotte, deren „ganzer Körper, eine Harmonie, so sorglos, so unbefangen“ (16.Juny) ist, als sie anfängt zu Tanzen. Das Tanzen bereitet Lotte sichtlich Vergnügen, denn ihre Augen waren „voll vom wahrsten Ausdrucke des offenen reinen Vergnügens“ (16.Juny). „Und so wie vor Lotte die Welt beim Tanzen zu schwinden scheint, so schwindet sie auch vor Werther“ (Siepmann, S.47). In dieser Situation sieht Werther Lotte zum ersten Mal als „liebenswürdigste[s] Geschöpf“ (16.Juny). Er fühlt sich von diesem Augenblick an stark zu ihr hingezogen. Auch Werthers Liebe zur anspruchsvollen Literatur wird von Lotte geteilt. So schreibt Edgar Hein in seiner Interpretation „ Lotte liest gern, auch Romane im empfindsamen Stil der Zeit, aber sie ist von wählerischem Geschmack“ (Hein, S.64).
„Bereits auf der Fahrt zum Ball kommt es bei einem Gespräch über Literatur zu einem tiefen Einverständnis der beiden“ (Siepmann, S.47)
Als auf dem Ball ein Gewitter die Gesellschaft heimsucht, steht Lotte mit Werther am Fenster und spricht, „ergriffen von dem Naturschauspiel“ (Hein, S.64), den Namen „Klopstock“ (16.Juny) aus. Werther ist von der Nennung dieser „Losung“ (Rothmann, S.27) so gerührt, dass er sich „auf ihre Hand [neigt] und sie unter den wonnevollsten Tränen“ (16.Juny) küsst. Die Reaktion beider auf das Naturschauspiel zeigt, dass ihr „Natur- und Kunsterleben“ (Große, S.217) in diesem Moment weitgehend übereinstimmen. Große schließt aus der Tatsache, dass Lotte gerade in dieser Situation dieses „Losungswort“ (Große, S.217) nennt, dass Werther und Lotte „gleich empfingen und empfindsam sind“ (Große, S.217). Am deutlichsten wird dies aber bei ihrem letzten Zusammentreffen. Siepmann schreibt darüber: „In der Lektüre von Ossians Gesängen fühlen sie ihr gemeinsames Elend“ (Siepmann, S.48). Gleiche Empfindungen haben Lotte und Werther auch für Kinder. Hein ist der Meinung, dass „die Kinderliebe Werthers [...] eines der wichtigsten Randmotive des Romans“ ist (Hein, S.67). An verschiedenen Stellen des Romans wird Werthers Verbundenheit zu den Kindern deutlich. So schreibt er Wilhelm am 29. Juny: „meinem Herzen sind die Kinder am nächsten auf der Erde“ (29.Juny). Am 8.Juli vergleicht sich Werther sogar direkt mit Kindern indem er sagt: „Oh, was ich ein Kind bin“ (8.Juli) Auch die Kinder sind Werther sehr zugetan. „Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt [...] Sonntags fehlt ihnen der Kreuzer nie“ (27.May) Ein besonders gutes Verhältnis hat Werther zu Lottes jüngeren Geschwistern.
Selbst als der „Medikus“ (29.Juny) Werther aufgrund seines Umgangs mit Lottes Geschwistern tadelt, lässt er sich „durch nichts stören, und baut[e] den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen [hatten]“ (29.Juny). Lotte, deren Mutter in frühen Jahren gestorben ist hat ihr am Sterbebett „ihr Haus und ihre Kinder übergeben“ (10.Aug.). Sie sorgt sich um ihre Geschwister mit dem „Ernste einer wahren Mutter“ (10.Aug.). Sie lebt „in den diesseitigen Bedingtheiten ihrer Familie“ (Hein, S.65) und versorgt den Haushalt ihres Vaters und ihrer Geschwister, „denen sie liebevoll die tote Mutter ersetzt“ (http://www.bos.fr.bw.schule.de/goethe1.htm). Damit zeigt sich, das sich sowohl Werther als auch Lotte in Gegenwart von Kinder sehr wohl fühlen.
Auch in der freien Natur fühlen sich beide wohl. Werther bezeichnet die Natur als „paradisisch“ (12.May). „Sie repräsentiert [für Werther] eine alles umfassende Harmonie“ (Siepmann, S.52). Werther ist von der Natur so überwältigt, das er „nicht zeichnen“ (10.May) kann. Besonders im Brief vom 10. May wird deutlich, das er sich wünscht „die Trennung zwischen sich und der Natur aufzuheben“ (Siepmann, S.52). Er wünscht sich ein Teil der Natur zu sein, und ruft so „in seinem Enthusiasmus aus, dass er zum Marienkäfer werden möchte“ (Siepmann, S.52). Für Werther bildet die Natur den direkten Gegenpol zu Zwang und Zivilisation. „Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen ringsumher eine unaussprechliche Schönheit“ (4.May). Er sieht in ihr die Quelle der Sicherheit. „Hier [In der Natur] fühlt sich Werther geborgen und vergisst sogar Sorgen und Ängste“ (http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/natur.html).
Genauso geht es Lotte. Sie besitzt die Fähigkeit sich der Natur völlig hinzugeben, und dies verbindet sie mit Werther. So ist sie zum Beispiel von dem Gewitter, das die Gesellschaft auf dem Ball heimsucht, nicht verängstigt sondern vielmehr fasziniert. Sie asoziiert bestimmte Situationen in der Natur mit bestimmten Ereignissen. Zum Beispiel sagt Lotte am 10.Sep: „Niemals gehe ich im Mondenlichte spazieren, niemals dass mir nicht der Gedanke an meine Verstorbenen begegnete“ (10.Sep.). Auch dies lässt eine tiefe Verbundenheit mit der Natur erkennen. Werther entdeckt wie gesagt viele Gemeinsamkeiten zwischen sich und Lotte.
Dies ist jedoch nicht der einzige Grund für seine Annahme, dass Lotte mit ihm glücklicher geworden wäre als mit Albert. Lotte ist für ihn nicht die Frau die sie in Wirklichkeit darstellt, sondern er sieht sie viel mehr als „ein vollkommenes Geschöpf“
(http://hausarbeiten.de/rd/archiv/deutsch/deutsch-text1311.shtml). „Werther sieht in Lotte die Verkörperung natürlich weiblicher Eigenschaften“ (http://hausarbeiten.de/rd/archiv/deutsch/deutsch- text1311.shtml). Einerseits das „tanzlustige Mädchen“ (http://hausarbeiten.de/rd/archiv/deutsch/deutsch-text1311.shtml) auf dem Ball, andererseits aber auch die „empfindungsfähige Frau“ (http://hausarbeiten.de/rd/archiv/deutsch/deutsch-text1311.shtml), der beim Zitieren von Ossians Gedichten die Tränen in die Augen kommen. Doch vor allem sieht er sie in der Rolle der liebenden Mutter. Oft ist er so überwältigt von ihr, dass er sie nicht einmal beschreiben kann.
So sagt er „Und doch bin ich nicht im Stande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist, genug sie hat all meinen Sinn gefangen genommen“ (16.Juny).
Als er Lotte zum ersten Mal gesehen hat, war sie umringt von ihren jüngeren Geschwistern, „unter denen sie gerade Brot verteilt“ (Siepmann, S.47). „[mir] fiel [...] das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen hatte“ (16.Juny). Für Werther symbolisiert diese Handlung „eine typisch idyllische Situation“ (Siepmann, S.47). Lotte ist für ihn eine Frau, die ihre „Unschuld und Naivität“ (Siepmann, S.47) bewart hat. Er charakterisiert sie darüber hinaus als „ein Mädchen, deren Seele ganz Güte [...], Liebling, Freundin, Beistand ihrer Mutter, die zweite Mutter des Hauses [...], deren stets liebwirkende Seele jedes Herz unwiderstehlich an sich reißt“ (Hein, S.64). Auch Lottes Aussehen bezaubert ihn. Immer wieder betont er Lottes schwarze Augen, wie auch im Brief vom 16.Juny, als er sagt: „Wie ich mich [...] in ihren schwarzen Augen weidete, wie die lebendigen Lippen und die frischen munteren Wangen meine ganze Seele anzogen [...]“ (16.Juny). Er beschreibt sie außerdem als liebenswürdig, charmant, hübsch, überdurchschnittlich, freundlich und hilfsbereit beschrieben. Dies zeigt sich zum Beispiel an ihrer Fürsorge für Kranke: „Sie ist immer um ihre sterbende Freundin, und ist immer dieselbe, immer das hilfsbereite holde Geschöpf, das, wo sie hinsieht, Schmerzen lindert und Glückliche macht“ (6.Juli). Werther sieht sie jedoch auch als Frau die bei „so viel Einfalt [...] so viel Verstand“ (16.Juny) hat, bei „so viel Güte [...] so viel Festigkeit“ (16.Juny) und welcher eine „Ruhe der Seele bei wahrem Leben und der Tätigkeit“ (16.Juny) zu Teil ist.
Dies zeigt das er durchaus auch ihre intellektuellen Eigenschaften schätzt: „Ich [Werther] fand soviel Charakter in allem was sie sagte, ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen [...]“ (16.Juny). Im Laufe des Romans steigert sich Werthers Liebe zu Lotte zu „religiöser Verehrung“ (Hein, S.65): „Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart“ (Hein, S.64). Das gleiche zeigt sich des weiteren daran, dass er „die halbe Nacht“ (Der Herausgeber an den Leser) vor ihren Blumen kniet und dass seine Kleider durch ihre bloße Berührung „geheiligt“ (Der Herausgeber an den Leser) sind.
Werther betrachtet Lotte auch häufig als eine „Seelenverwandte“
(http://www.krref.krefeld.schulen.net/referate/deutsch/r0846t00.htm).
Vor allem ist dies ist eine Schlussfolgerung aus der Tatsache, dass Lotte beim Ball unter Tränen den Namen „Klopstock“ erwähnt. Für Werther kommt dies „fast einem Liebesgeständnis gleich“ (Siepmann, S. 48). Im Laufe des Buches ist Werther „Lotte ein guter Freund und Gesprächspartner geworden“ (http://www.dldjw.de/charwerther.html) und sie vertraut ihm voll und ganz. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass sie ihn „auf ihre Geschwister aufpassen“
(http://www.dldjw.de/charwerther.html) lässt. Da Lotte ihm immer erlaubt, sie zu besuchen und etwas mit ihr zu unternehmen, fühlt sich Werther in seiner Liebe zu ihr bestätigt. Dabei ist Lottes Zuneigung Werther gegenüber vielmehr rein platonisch zu sehen. Sie sieht die Beziehung zu Werther mehr als ein Abenteuer und eine Abwechslung zu ihrem normalerweise eintönigen Leben an.
Werther missversteht ihr Zuneigung, die sich mit Ausdrücken wie „Lieber Werther“ ( 21.Nov.) äußert.
Dies alles sind Gründe, die Werther dazu veranlassen zu denken, dass Lotte mit ihm glücklicher geworden wäre als mit Albert. Doch es gibt auch gewichtige Gründe dafür, dass sich Lotte dennoch für Albert, und somit gegen Werther, entscheidet.
Ein entscheidender Punkt hierbei ist Lottes Wunsch nach Sicherheit.
Albert ist ein charakterfester und strebsamer junger Mann, dessen Lebensart sehr viel ernsthafter und geregelter als Werthers ist. Besonders schätzt Lotte Alberts „Eigenschaften wie Ruhe, Souveränität und Treue“ (http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/lotte.html). Auch von Werther wird er als „braver, lieber Kerl“ (30.Juli) geschildert, dem er selbst „Achtung nicht versagen“ (30.Juli) kann. Werther bewundert an ihm „seine gelassenen Außenseite“ (30.Juli) und gesteht ihm trotzdem „viel Gefühl“ (30.Juli) zu. Albert zeigt „Mitleid, Sympathie und Einfühlung. Sein Herz jedoch muss hinter das Sittengesetz zurücktreten“ (Hein, S.67) „Lotte weiß, dass Albert ein ehrenhafter Mann ist und dass er sie aufrichtig und von Herzen liebt und sie niemals hintergehen würde und immer für sie und ihre "Kinder" da sein wird“ (http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/menschenbild.html). Auch seine Ehrlichkeit und sein Respekt gegenüber Lotte wird von Werther im Brief vom 30.Juli bemerkt. Im Gegensatz zu Werther ist Albert ein „selbstsicherer“, „starker“, „fleißiger“, „planender“ und „solider“ (http://www-user.uni-bremen.de/~kpagel/html/verhaeltnisse.html) Mensch, den man durchaus als Vertreter der Aufklärung bezeichnen kann.
In der Diskussion mit Werther über den Selbstmord vertritt er eine „Vernunftposition“ (Siepmann, S.81), und erweist sich somit als ein Mann mit „gesundem Menschenverstand“ (Siepmann, S.81), was wiederum für die Vertretung der Aufklärung spricht.
Des weiteren hat Albert, im Gegensatz zu Werther, eine feste Anstellung bei Hof, um die ihn Werther des öfteren beneidet. „Oft beneid ich Alberten, den ich über die Ohren in Akten begraben sehe“ (22.Aug.). Da er bei Hofe „ein Amt mit artigem Auskommen“ (10.Aug.) hat, kann er Lotte eine finanzielle Absicherung bieten, die sie, allein schon aus Sorge um ihre Geschwister, benötigt. Siepmann schreibt: „Er scheint seinen Geschäften mit Sorgfalt und Fleiß nachzugehen und dabei Erfolg zu haben“ (Siepmann, S.81).
Durch seine Anstellung bei Hof, wo er „sehr beliebt“ (10.Aug.) ist, ist er zusätzlich auch noch in der Gesellschaft fest integriert. Lotte braucht „einen festen Rahmen, der ihr Rückhalt bieten kann“
(http://alou.mordor.sk/germanistika/dieleidendesjungenwerther.htm) und Albert kann ihr dieses „geregeltes Leben“
(http://alou.mordor.sk/germanistika/dieleidendesjungenwerther.htm) ermöglichen. Durch ihn „entspricht sie einem bürgerlichen Lebensideal“ (Siepmann, S.80). Als Werthers Freundin würde sie Gefahr laufen in „ein kritisches Verhältnis zu dieser bürgerlichen Welt“ (Siepmann, S.80) zu geraten. Sein gutes Verhältnis zur Gesellschaft zeichnet sich durch „eine gewisse Freundlichkeit und Großzügigkeit“ (Soepmann, S.81) aus. Dies gilt vor allem gegenüber Werther, dem Freund seiner Verlobten. Es zeigt sich besonders an Werthers Geburtstag: „Heute ist mein Geburtstag, und in aller Frühe empfange ich ein Päckchen von Alberten“ (28.Aug.).
Er hält bewusst „jeden Anflug von Eifersucht“ (Hein, S.66) zurück, und macht sich „den Nebenbuhler“ (Hein, S.66) zum Freund. Insgesamt beschreibt Hein Albert als einen „Mann des Gesetzes, der Form und der Gelassenheit, der aber doch von Gefühlskälte weit entfernt ist, wie der Schluss des Romans zeigt“ (Hein, S.67): „Der Alte folgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht’s nicht“ (Der Herausgeber an den Leser). Ein weiterer wichtiger Grund für Lottes Entscheidung zugunsten Albert, ist der entsprechende Wunsch ihrer Mutter. Beim letzten Treffen zwischen Werther Albert und Lotte erinnert sich Lotte an den Wunsch ihre Mutter: „Und wie sie [die Mutter] dich [Albert] ansah und mich, mit dem getrösteten ruhigen Blicke, das wir glücklich sein, zusammen glücklich sein würden“ (10.Sep.). Als Albert ihrer Mutter daraufhin um den Hals fiel, sie küsste und sagte: „ wir sind’s! Wir werden’s sein“ (10.Sep.), war das Versprechen gemacht, und der Gedanke daran, das Albert auch nach ihrem Tod für Lotte da sein würde, „tröstete ihre Mutter“
(http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/menschenbild.html). Für Lotte ist ihr Mutter eine „Heilige“ (10.Sep.) und sie verehrt sie über alle Massen. Lotte hat ein sehr inniges, herzliches und warmes Verhältnis zu ihrer Mutter. Sie liebte ihre Mutter über alles und wird sich auch immer nur in Liebe an sie erinnern. Sie würde gern so sein wie sie und nimmt sie sich als Vorbild. Lotte bezeichnet sie als "schön, sanft, munter und fleißig" (http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/lotte.html) und strebt selbst nach diesen Eigenschaften. Am 10. September wünscht sich Lotte, dass ihre Mutter ihre „Eintracht“ (10:Sep.) sehen könnte.
Sie bittet sie um Verzeihung, falls sie ihren Geschwistern die Mutter nicht ausreichend ersetzt, beteuert aber, dass sie alles tue was in ihrer Macht stehe um ihnen die Mutter zu ersetzen: „Verzeih’s mir Teuerste, wenn ich ihnen [den Kindern] nicht bin, was du ihnen warst. Ach! Tu ich doch alles was ich kann, sind sie doch gekleidet, genährt, ach und was mehr ist als das alles, gepflegt und geliebet“ (10.Sep.). Dies zeigt wie Ernst sie die letzten Wünsche ihrer Mutter nimmt, die ihr am Totenbett ihre Kinder und das Haus übergeben hatte, und die sich auch gewünscht hatte, dass Lotte mit Albert glücklich wird. Sie fühlt sich ihr gegenüber verpflichtet und tut alles um dieser Pflicht zu genügen. Doch sie hat nicht nur gegenüber ihrer Mutter ein starkes Pflichtgefühl, sondern auch ihrem Verlobten Albert gegenüber. Dieser hat „ihr in der schwersten Zeit, dem Leiden und Sterben ihrer Mutter“ (http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/menschenbild.html) beigestanden. Auch danach war er immer für sie da und hat sie getröstet. So sagt Albert am 10.September zu Lotte, als sie emotional sehr aufgebracht über den Verlust ihrer Mutter spricht: „es greift sie zu stark an, liebe Lotte, ich weiß ihre Seele hängt an diesen Ideen, aber ich bitte sie -„ (10.Sep.). Doch neben dem emotionalen Halt den Albert Lotte gibt, „fühlt sie sich [ihm] durch ihre Verlobung und Hochzeit verpflichtet bzw. verbunden“
(http://alou.mordor.sk/germanistika/dieleidendesjungenwerther.htm) . Ihre Ehe mit Albert ist für sie ein Zeichen der „Verbundenheit“ (http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/lotte.html) nicht nur vor Gott, sondern auch vor ihren Mitmenschen.
Der letzte und vielleicht wichtigste Grund, warum Lotte sich für Albert, und somit gegen Werther entscheidet, ist Werthers Labilität. Werther sagt selbst am 30.Juli: „seine [Alberts] gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab“ (30.Juli). Lotte sieht Werther von Anfang an als „glühender Verehrer“ (Siepmann, S.79) und ist fest der Meinung, dass Werther „für sie als Ehemann nie in Frage kommen könnte“ (Siepmann, S.79). Dies begründet sich auch auf Werthers „Mangel an Bürgerlichkeit“ (Siepmann, S.79) und „seine radikale Anlehnung bürgerlicher Lebensformen“ (Siepmann, S.79). Werther ist ein „unsicherer“ „Gefühlsmensch“ , der „eher unruhig und lebhaft“
(http://www-user.uni-bremen.de/~kpagel/html/verhaeltnisse.html), als gelassen und ausgeglichen ist. Er ist ein „Träumer“
(http://www-user.uni-bremen.de/~kpagel/html/verhaeltnisse.html), der unter einem ausgeprägten „Minderwertigkeitskomplex“ (http://www-user.uni-bremen.de/~kpagel/html/verhaeltnisse.html) leidet. Dies kann man unter anderem aus der Tatsache schließen, dass bei ihm „eine gewisse Ziellosigkeit“ (Siepmann, S.77) auffällt, wenn man Werthers Beschäftigung oder seine gesellschaftlichen Bindungen betrachtet.
Werther kann und will sich in keine Gesellschaftsschicht eingliedern und übt im Roman Kritik an jeder einzelnen.
Zum Beispiel bezeichnet er den Adel als „völlig geistlos“, der „im wesendlichen daran interessiert ist, sich vom Bürger abzugrenzen“ (Siepmann, S.61), und hat ein Bild vom Bürgertum „das keinerlei Ansprüche auf die Ausbildung und Verwirklichung aller Fähigkeiten zu erkennen gibt, stattdessen in einem System der Arbeitsteilung seinen vor allem ökonomischen Interessen nachgeht“ (Siepmann, S.62). Seine Vorstellung einer idealen Gesellschaft ist ein patriarchalisches Zusammenleben, in der „freie Kommunikation“ und eine „Realisierungschance“ (Siepmann, S.62) gegeben sind. Dies wird im Brief vom 21.Juny deutlich: „Es ist nichts, das mich so mit einer stillen, wahren Empfindung ausfüllt, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott sei Dank, ohne Affektation in meine Lebensart verweben kann“ (21.Juny). So kann man sagen, dass Werther orientierungslos durch die gesellschaftlichen Schichten irrt, ohne sich einer wirklich zuordnen zu können.
Insgesamt gesehen ist Werthers Liebe zu Lotte also von Anfang an chancenlos. Die Beziehung, die Werther zu Lotte hat, ist keine wirkliche Liebe, vielmehr ist Lotte ein „Objekt seiner Sehnsucht“ (http://www-user.uni-bremen.de/~kpagel/html/verhaeltnisse.html) nach Sicherheit, Liebe und Verständnis. Es ist von Anfang an eine einseitige Liebe, die allenfalls durch Lottes Schwärmerei erwidert wird. Doch für Werther ist Lotte eine ideale Person. Sie verkörpert die „ältere, natürliche Frau, von der er häufig schwärmt“
(http://alou.mordor.sk/germanistika/dieleidendesjungenwerther.htm)
Dazu kommt die Tatsache, das Lotte durchaus „von einer ähnlichen Kleinbürgerlichkeit und Durchschnittlichkeit gekennzeichnet ist, wie sie Werther in seinen ersten Briefen kritisiert“ (Siepmann, S.50). Eine Ehe mit Lotte würde ihm somit die Beschränktheit dieses Lebens auferlegen, die er so stark ablehnt. Er würde dadurch gerade diese Eigenschaften verlieren, die Lotte so an ihm schätzt. „Übrig blieben nur noch Langeweile, Beschränktheit und Monotonie“ (Siepmann, S.50), welches genau die Dinge sind, welche er vor allem an Albert kritisiert. Abschließend ist noch zu sagen, das Werthers Grundeinstellung zur Liebe eine Beziehung mit Lotte unmöglich macht, denn für ihn liebt nur der Mensch wirklich, der voll und ganz in der Liebe aufgeht. „Eine solche Gefühlsintensität kann aber nur kurze Zeit durchgehalten werden, ist auf die Dauer nicht lebbar“ (Siepmann, S.50).
Literaturverzeichnis:
Literatur:
- Wiethölter, Waltraud (Herausgeber): Johann Wolfgang von Goethe „Die Leiden des jungen Werthers“, Orginalausgabe, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998
Sekundärliteratur:
- Große, Wilhelm: Kommentar. In: Johann Wolfgang Goethe „Die Leiden des jungen Werthers“, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998
- Hein, Edgar: „Die Leiden des jungen Werther“, Interpretation, Oldenbourg, München 1991
- Krywalski, D; Margraf, A; Roedig, C (Herausgeber): Kennwort 11 Ein literaturgeschichtliches Arbeitsbuch, Schroedel, Hannover 1992
- Rothmann, Kurt: Johann Wolfgang von Goethe „Die Leiden des jungen Werther“, Erläuterungen und Dokumente, Reclam, Stuttgart 1991
- Siepmann, Thomas: Johann Wolfgang von Goethe „Die Leiden des jungen Werther“, Lektürehilfen, Klett, Stuttgart 1991 Multimedia:
- Interactive Media Devision (Herausgeber): Microsoft Encarta 98, Enzyclopädie, Microsoft, Redmond 1998
Internet:
- http://alou.mordor.sk/germanistika/dieleidendesjungenwerther.htm
- http://hausarbeiten.de/rd/archiv/deutsch/deutsch-text1311.shtml
- http://home.germany.net/100-117926/deutsch7.htm
- http://www.bos.fr.bw.schule.de/goethe1.htm
- http://www.dldjw.de/charwerther.html
- http://www.hausarbeiten.de/
- http://www.krref.krefeld.schulen.net/referate/deutsch/r0846t00.htm
- http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/lotte.html
- http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/natur.html
- http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/werther.html
- http://www.spickzettel.de/cgi-bin/data/fetch.pl?id=2754&ids=340+2754+2304+503+4637+4901+5146+4355+6642
- http://www.spickzettel.de/cgi-bin/data/fetch.pl?id=340&ids=340+2754+2304+503+4637+4901+5146+4355+6642
- http://www-user.uni-bremen.de/~kpagel/html/verhaeltnisse.html
Auszüge aus verschiedenen Webseiten:
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in „Die Leiden des jungen Werther“?
„Die Leiden des jungen Werther“ ist ein Briefroman von Johann Wolfgang von Goethe, der die Geschichte von Werther und seiner unerfüllten Liebe zu Lotte erzählt. Werther ist ein Vertreter des Sturm und Drang, und seine Auffassung von Liebe steht im Mittelpunkt der Geschichte. Das Werk verarbeitet autobiographische Erlebnisse Goethes, insbesondere eine unerfüllte Liebe und den Selbstmord eines Kollegen.
Welche Gründe hat Werther für seine Annahme, dass Lotte mit ihm glücklicher wäre als mit Albert?
Werther glaubt, dass Lotte mit ihm glücklicher wäre, weil sie viele Gemeinsamkeiten haben, darunter die Freude am Tanzen, die Liebe zur Literatur, die Zuneigung zu Kindern und die Verbundenheit zur Natur. Er idealisiert Lotte und sieht sie als seine Seelenverwandte.
Welche Gründe hat Lotte, sich dennoch für Albert zu entscheiden?
Lotte entscheidet sich für Albert, weil sie Sicherheit sucht. Albert ist emotional gefestigt, hat eine feste Anstellung und ist gesellschaftlich etabliert. Außerdem hatte ihre Mutter den Wunsch, dass sie mit Albert glücklich wird. Lotte fühlt sich Albert gegenüber verpflichtet und hält Werther für zu labil.
Inwiefern ist Werthers Auffassung von Liebe ein Hindernis für eine Beziehung mit Lotte?
Werthers Auffassung von Liebe, die auf intensiven Gefühlen und einer Ablehnung bürgerlicher Konventionen basiert, macht eine Beziehung zu Lotte unmöglich. Er idealisiert Lotte und übersieht ihre tatsächlichen Bedürfnisse und Wünsche.
Welche Rolle spielt Albert in der Geschichte?
Albert ist Lottes Verlobter und späterer Ehemann. Er repräsentiert die bürgerliche Vernunft und Stabilität. Werther bewundert ihn zwar, sieht ihn aber auch als Hindernis für seine Liebe zu Lotte.
Welche Bedeutung hat die Natur in dem Roman?
Die Natur spielt eine wichtige Rolle als Gegenpol zu Zwang und Zivilisation. Werther findet in der Natur Trost und Harmonie. Auch Lotte hat eine tiefe Verbundenheit zur Natur, was eine ihrer Gemeinsamkeiten mit Werther ist.
Wie wird Lotte im Roman dargestellt?
Lotte wird als ein liebenswertes, warmherziges und verantwortungsbewusstes Mädchen dargestellt, das sich um ihre jüngeren Geschwister kümmert und ein starkes Pflichtgefühl hat. Sie wird jedoch auch als bürgerlich und konventionell beschrieben, was im Gegensatz zu Werthers Idealbild steht.
Was sind die Hauptthemen des Romans?
Die Hauptthemen des Romans sind unerfüllte Liebe, die Auseinandersetzung zwischen Gefühl und Vernunft, die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft und die Suche nach Identität und Sinn im Leben.
Welche Rolle spielen die Kinder im Roman?
Die Kinderliebe Werthers wird als ein wichtiges Randmotiv des Romans beschrieben. Werther hat ein sehr gutes Verhältnis zu Lottes jüngeren Geschwistern und verbringt gerne Zeit mit ihnen. Dies zeigt seine natürliche und unbeschwerte Seite.
Was bedeuten die Ossian Gesänge in Bezug auf Werther und Lotte?
Das gemeinsame Lesen von Ossian Gesängen führt zu der Feststellung, dass Werther und Lotte ihr gemeinsames Elend fühlen und sich somit in ihrer "Seelenverwandtschaft" bestätigen.
Was ist die Symbolik hinter dem Namen Klopstock?
Die Nennung des Namens "Klopstock" durch Lotte während eines Gewitters, das sie gemeinsam beobachten, wird von Werther als eine Art Liebesgeständnis gedeutet, da er Klopstock als einen bedeutenden Dichter und Ausdruck ihrer gemeinsamen Wertvorstellungen betrachtet.
Was sind einige der Internet-Quellen, die in diesem Text zitiert werden?
Einige der Internet-Quellen, die zitiert werden, sind:
- http://alou.mordor.sk/germanistika/dieleidendesjungenwerther.htm
- http://hausarbeiten.de/rd/archiv/deutsch/deutsch-text1311.shtml
- http://home.germany.net/100-117926/deutsch7.htm
- http://www.bos.fr.bw.schule.de/goethe1.htm
- http://www.dldjw.de/charwerther.html
- http://www.hausarbeiten.de/
- http://www.krref.krefeld.schulen.net/referate/deutsch/r0846t00.htm
- http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/lotte.html
- http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/natur.html
- http://www.lmg.pf.bw.schule.de/AG/Werther/werther.html
- http://www.spickzettel.de/cgi-bin/data/fetch.pl?id=2754&ids=340+2754+2304+503+4637+4901+5146+4355+6642
- http://www.spickzettel.de/cgi-bin/data/fetch.pl?id=340&ids=340+2754+2304+503+4637+4901+5146+4355+6642
- http://www-user.uni-bremen.de/~kpagel/html/verhaeltnisse.html
- Quote paper
- Christine Mayr (Author), 2002, "Sie wär mit mir glücklicher geworden". Gründe für die Beziehungskonstellation in den "Leiden des jungen Werther" von Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106638