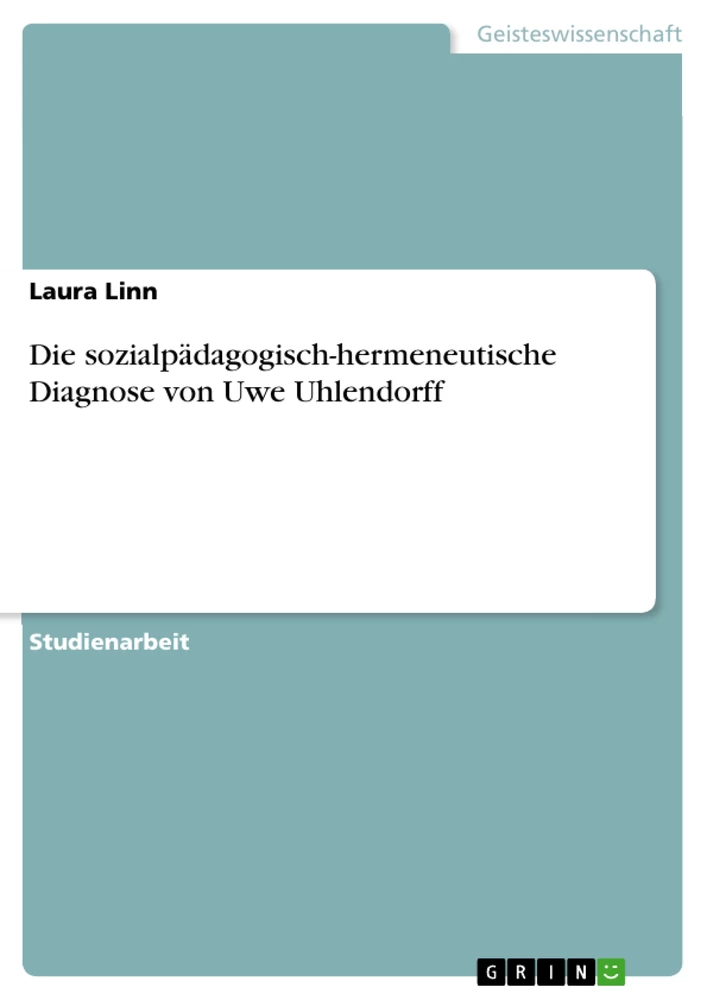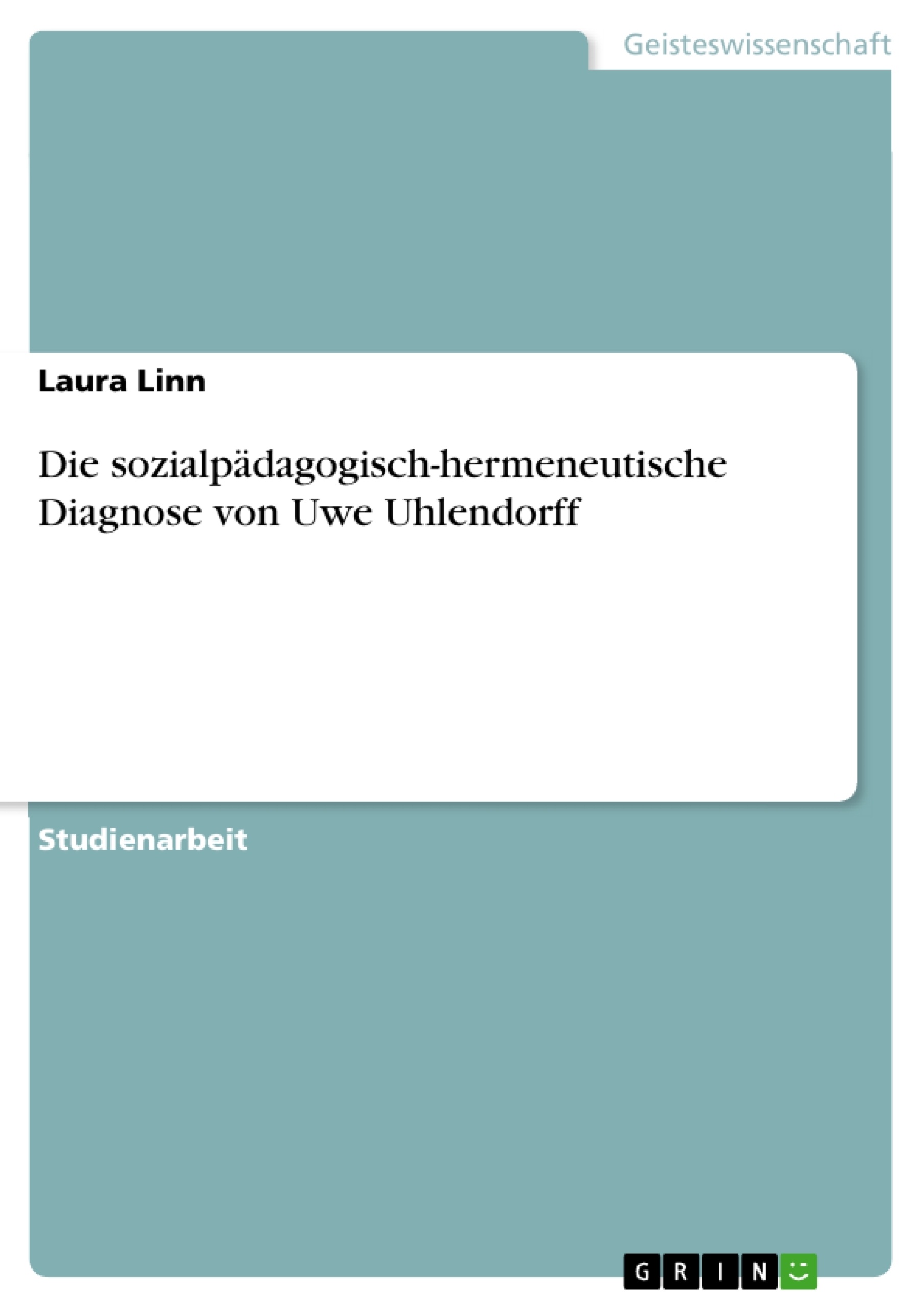In dieser Arbeit wird auf den Nutzen von Diagnosen in der Jugendhilfe und auf die spezifischen Merkmale sozialpädagogisch-hermeneutischer Diagnosen eingegangen, um im Anschluss den Zusammenhang dieser Diagnoseform mit Wahrnehmungs-, Wirklichkeits- und Realitätskonzepten aufzuzeigen und die Möglichkeiten, die hieraus, in Hinblick auf die Bedeutung von Sprache, resultieren, herauszuarbeiten. Die vorliegende Ausarbeitung bezieht sich auf unsere Präsentation vom fünften Juni 2020 zum Thema der sozialpädagogisch-hermeneutischen Diagnose nach Uwe Uhlendorff. Anders als in der Präsentation, werden die Entstehungsgeschichte der Diagnose in der Jugendhilfe und die historische Entwicklung des Begriffs an dieser Stelle nicht erneut skizziert.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Diagnose in der Sozialen Arbeit
- Diagnosen in der Jugendhilfe
- Die Besonderheiten von Diagnosen in der Jugendhilfe
- Die sozialpädagogisch-hermeneutische Diagnose
- Warum sozialpädagogisch-hermeneutische Diagnosen?
- Das Vorgehen beim Stellen von sozialpädagogisch-hermeneutischen Diagnosen
- Realität und Wirklichkeit
- Was ist Realität? Oder: Was ist wirklich?
- Die Erzeugung von sozialer Wirklichkeit durch Sprache
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der sozialpädagogisch-hermeneutischen Diagnose nach Uwe Uhlendorff. Sie analysiert den Nutzen von Diagnosen in der Jugendhilfe und untersucht die spezifischen Merkmale dieser Diagnoseform. Darüber hinaus wird der Zusammenhang mit Wahrnehmungs-, Wirklichkeits- und Realitätskonzepten beleuchtet, wobei der Fokus auf die Bedeutung von Sprache gelegt wird.
- Die Rolle der Diagnose in der Sozialen Arbeit
- Spezifische Merkmale der sozialpädagogisch-hermeneutischen Diagnose
- Der Zusammenhang von Diagnose und Sprachkonzepten
- Die Konstruktion von Wirklichkeit durch Sprache
- Die Bedeutung von Diagnostik im Kontext der Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit behandelt die Diagnose in der Sozialen Arbeit, wobei die kontroverse Diskussion um ihren Nutzen im Fokus steht. Es werden kritische Perspektiven, die die Anwendung von Diagnosen in der Jugendhilfe als problematisch ansehen, vorgestellt und mit Argumenten für die Notwendigkeit von Diagnosen in der Jugendhilfe konfrontiert. Die Bedeutung von Diagnosen für die Ableitung von Hilfearten sowie für die Legitimierung öffentlicher Gelder wird diskutiert.
Im zweiten Kapitel werden die Besonderheiten von Diagnosen in der Jugendhilfe beleuchtet. Es wird die Notwendigkeit berücksichtigt, alle drei Dimensionen der Fallarbeit („Fall von“, „Fall für“, „Fall mit“) zu berücksichtigen und gleichzeitig den Arbeitsprozess von Anamnese, Diagnose, Intervention und Evaluation einzuhalten. Die Bedeutung der Perspektive der Betroffenen und die Notwendigkeit, ihnen Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Sozialpädagogisch-hermeneutische Diagnose, Jugendhilfe, Diagnostik, Sprache, Wirklichkeitskonstruktion, Ressourcen, Selbstbestimmung, Hilfeplanung, Fallarbeit, Fachkräfte, Klient_innen, Intervention, Evaluation.
- Arbeit zitieren
- Laura Linn (Autor:in), 2020, Die sozialpädagogisch-hermeneutische Diagnose von Uwe Uhlendorff, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1064818