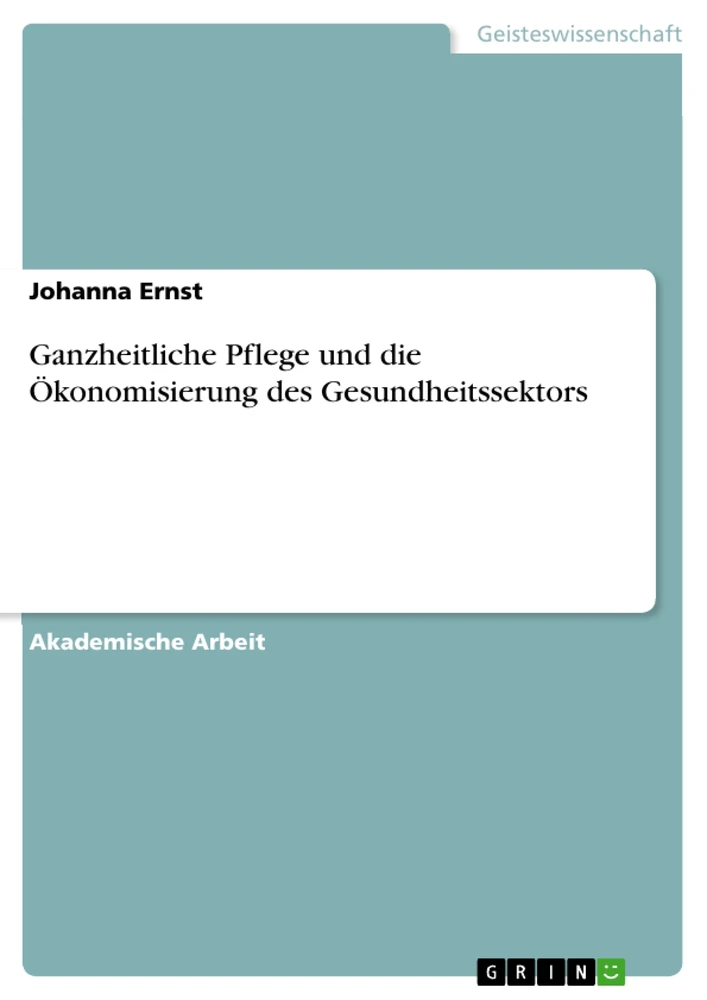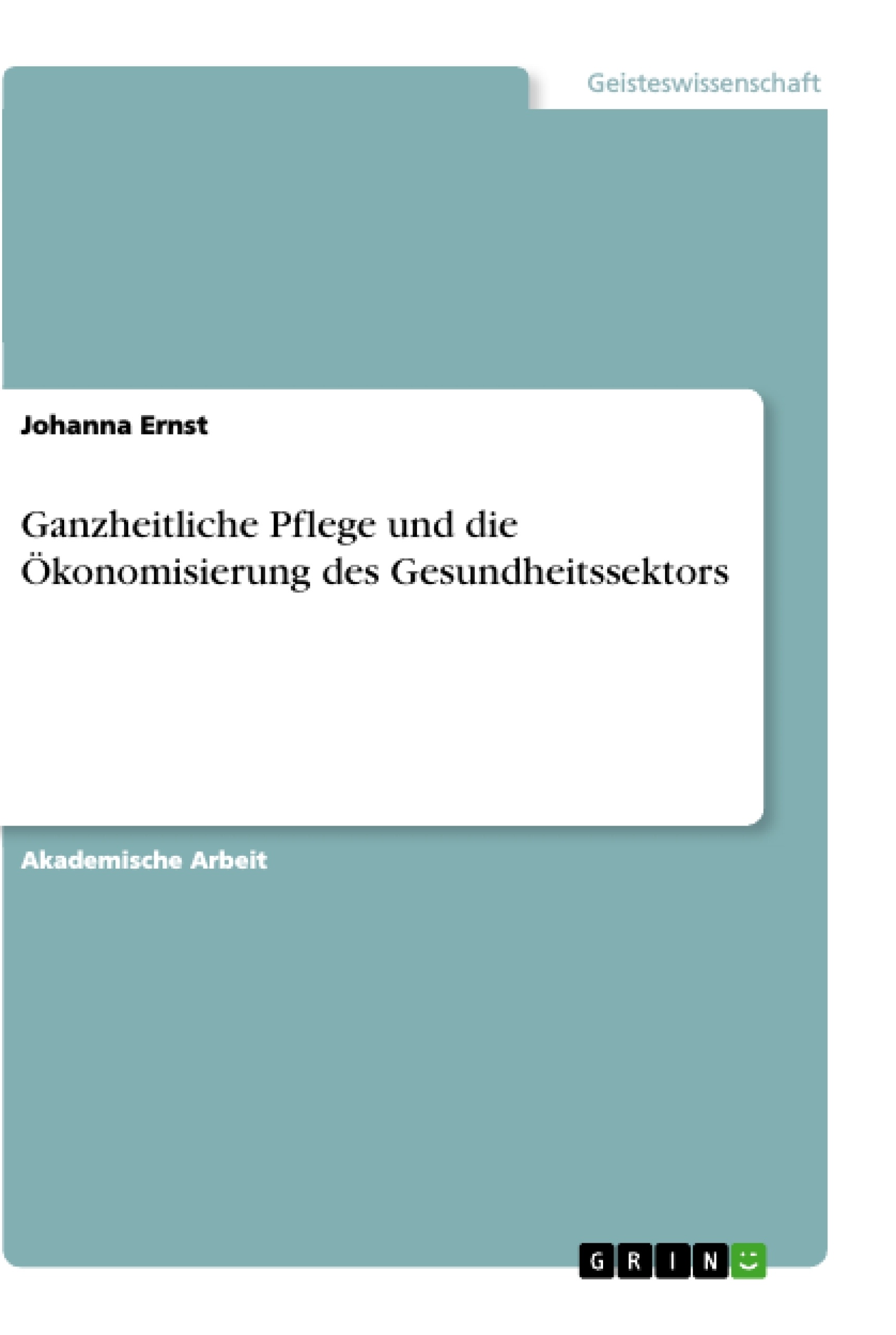Diese Arbeit befasst sich mit notwendigen Umbrüchen im Gesundheitswesen. Um im Verlauf der Arbeit die Bedingungen einer würdevollen Gestaltung von Pflegearbeit durch die Berücksichtigung und Anerkennung der Konzepte des subjektivierenden Arbeitshandelns sowie der Emotions- und Gefühlsarbeit unter Einsatz der Arbeitsorganisation der ganzheitlichen Pflege vorzustellen, soll einführend erklärt werden, welche Charakteristika Pflegetätigkeit in Deutschland beinhaltet.
Die Pflegebranche innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zählt im Jahr 2011 circa eine Million beschäftigte Personen. Ungefähr ein Drittel entfallen hierbei auf die ambulanten Pflegedienste und zwei Drittel auf die stationäre Pflege.
In der Altenpflege erweist sich der Titel eines Online-Artikels des Magazins „Der Spiegel“ „Wir laufen auf eine Katastrophe zu“ für die Beschreibung der Beschäftigungssituation dieses Bereichs als besonders passend. In der Altenpflege sowie in der Pflege in Krankenhäusern kämpfe man mit Missständen, doch für die Altenpflege habe die Agentur für Arbeit jetzt einen flächendeckenden Mangel an Fachkräften gemeldet.
Ein anderer Artikel des Online-Magazins „Was sich Pfleger wirklich wünschen“ beschäftigt sich mit den Wahlversprechen der Parteien bezüglich dieser Beschäftigungsproblematik. Der Forderung nach mehr Lohn wird von den meisten Parteien bis auf CDU und FDP versucht nachzugehen. Nach den Aussagen der interviewten Pfleger ergibt sich, der Mangel an Pflegekräften und die hohe Personalfluktuation, neben einer schlechten Bezahlung außerdem aus folgenden Kritikpunkten: lange Arbeitszeiten sowie entweder sehr frühe oder sehr späte Schichten, Aggressivität seitens Patienten und körperliche sowie psychische Belastungen. Die von den Parteien versprochenen Verbesserungen wie eine Unterstützung der Ausbildung von Pflegekräften durch beispielsweise die Ausweitung von Studienmöglichkeiten sehen diese jedoch als zweitrangig an, um einer Aufwertung ihres Berufsfeldes näher zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das Beschäftigungsproblem der Pflege im öffentlichen Diskurs
- 2. Charakteristika von Pflegetätigkeit
- 2.1 Beschreibung der Eigenschaften von Pflegetätigkeiten nach Christel Kumbruck
- 2.2 Problematik des decent work: Wie können wir menschenwürdige Pflegearbeit erreichen?
- 2.3 Interaktionsarbeit
- 2.3.a) Emotionsarbeit
- 2.3.b) Gefühlsarbeit
- 2.3.c) Subjektivierendes Arbeitshandeln
- 2.3.d) Gefühls- und Emotionsarbeit als professionelle Tätigkeiten
- 3. Interaktionsarbeit in der Pflege
- 3.1 Warum ist Interaktionsarbeit gerade innerhalb der Pflege ansässig?
- 3.2 Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und subjektivierendes Arbeitshandeln innerhalb der Pflegetätigkeiten am Beispiel einer Altenpflegerin
- 3.3 Emotionsarbeit in der Pflege
- 3.4 Gefühlsarbeit in der Pflege
- 3.5 Subjektivierendes Arbeitshandeln in der Pflege
- 3.6 Die positiven Auswirkungen des subjektivierenden Arbeitshandeln auf die Arbeitsbedingungen in der Pflege
- 4. Arbeitsorganisationsformen zur Etablierung von Gefühlsarbeit, Emotionsarbeit und subjektivierenden Arbeitshandeln
- 4.1 Funktionspflege
- 4.2 Ganzheitliche Pflege
- 4.3 Wie kann es zu einer praktischen Etablierung von Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und subjektivierendem Arbeitshandeln innerhalb der Pflege kommen?
- 5. Ökonomisierungs und Rationalisierungstendenzen der Pflege
- 5.1 Detaillierte Beschreibung der einzelnen Ökonomisierungsbewegungen
- 5.1.a) Verschlankung
- 5.1.b) Kommodifizierung
- 5.1.c) Externalisierung
- 5.1 Detaillierte Beschreibung der einzelnen Ökonomisierungsbewegungen
- 6. Ausblick: Kann sich das Konzept der ganzheitlichen Pflege durchsetzen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Pflegebranche in Deutschland, insbesondere den Fachkräftemangel und die Ökonomisierung des Sektors. Ziel ist es, die Charakteristika von Pflegetätigkeit zu beleuchten und den Stellenwert von ganzheitlicher Pflege im Kontext von Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und subjektivierenden Arbeitshandeln zu analysieren. Die Arbeit fragt nach Möglichkeiten, menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der Pflege zu schaffen und zu evaluieren, ob ganzheitliche Pflegemodelle dazu beitragen können.
- Das Beschäftigungsproblem in der Pflegebranche
- Charakteristika von Pflegetätigkeit und Interaktionsarbeit
- Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und subjektivierendes Arbeitshandeln in der Pflege
- Ganzheitliche Pflege als Arbeitsorganisationsform
- Ökonomisierung und Rationalisierungstendenzen im Gesundheitssektor
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das Beschäftigungsproblem der Pflege im öffentlichen Diskurs: Das Kapitel beleuchtet den gravierenden Fachkräftemangel in der deutschen Pflegebranche, insbesondere in der Altenpflege. Es stützt sich auf Artikel aus dem Spiegel und anderen Medien, die den Mangel an Fachkräften, die hohen Arbeitsbelastungen, die schlechten Bezahlung und die daraus resultierende hohe Fluktuation beschreiben. Die mangelnde Anerkennung des Berufs und der Wunsch nach mehr Menschlichkeit in der Pflege werden als zentrale Kritikpunkte hervorgehoben. Die Arbeit führt in das Thema ein und begründet die Notwendigkeit einer genaueren Betrachtung der Arbeitsbedingungen in der Pflege.
2. Charakteristika von Pflegetätigkeit: Dieses Kapitel beschreibt die spezifischen Merkmale von Pflegetätigkeiten. Basierend auf Kumbruck wird Pflege als Interaktionsarbeit definiert, die durch soziale Interaktionen zwischen Pflegekräften und Pflegebedürftigen geprägt ist. Die Fürsorgerationalität betont die Wichtigkeit vermischter Tätigkeiten für das Wohlbefinden der Patienten. Die Variabilität der Interaktionen macht eine Kategorisierung und Vereinheitlichung der Pflegetätigkeit schwierig und unterstreicht die Komplexität des Berufsfeldes.
3. Interaktionsarbeit in der Pflege: Dieses Kapitel vertieft die Bedeutung der Interaktionsarbeit in der Pflege. Es werden die Aspekte der Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und des subjektivierenden Arbeitshandelns im Kontext von Pflegetätigkeiten am Beispiel einer Altenpflegerin analysiert. Die positiven Auswirkungen des subjektivierenden Arbeitshandelns auf die Arbeitsbedingungen werden herausgestellt. Hier wird die Verbindung zwischen der individuellen Erfahrung der Pflegekraft und der Gestaltung der Arbeitsbedingungen hergestellt.
4. Arbeitsorganisationsformen zur Etablierung von Gefühlsarbeit, Emotionsarbeit und subjektivierenden Arbeitshandeln: Das Kapitel befasst sich mit verschiedenen Organisationsformen in der Pflege, insbesondere mit der Funktionspflege und der ganzheitlichen Pflege. Es untersucht, wie durch geeignete Arbeitsorganisationen die Aspekte von Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und subjektivierendes Arbeitshandeln besser berücksichtigt und etabliert werden können. Der Fokus liegt auf der Frage, welche Organisationsstrukturen die Arbeitsbedingungen verbessern und eine menschenwürdigere Pflege ermöglichen.
5. Ökonomisierungs und Rationalisierungstendenzen der Pflege: Dieser Abschnitt analysiert die ökonomischen und rationalisierenden Tendenzen im Gesundheitssektor, die die Pflege beeinflussen. Die Verschlankung, Kommodifizierung und Externalisierung von Prozessen werden detailliert beschrieben, ihre Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und die Qualität der Pflege werden diskutiert. Der Zusammenhang zwischen den ökonomischen Zwängen und den Herausforderungen der Pflegearbeit wird deutlich gemacht.
Schlüsselwörter
Pflege, Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel, Ganzheitliche Pflege, Interaktionsarbeit, Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit, Subjektivierendes Arbeitshandeln, Ökonomisierung, Rationalisierung, menschenwürdige Arbeitsbedingungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Herausforderungen in der Pflegebranche
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Herausforderungen der deutschen Pflegebranche, insbesondere den Fachkräftemangel und die Ökonomisierung des Sektors. Sie untersucht die Charakteristika von Pflegetätigkeit, den Stellenwert ganzheitlicher Pflege und Möglichkeiten zur Schaffung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das Beschäftigungsproblem in der Pflege, Charakteristika von Pflegetätigkeit und Interaktionsarbeit (inkl. Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und subjektivierendes Arbeitshandeln), ganzheitliche Pflege als Arbeitsorganisationsform, sowie Ökonomisierungs- und Rationalisierungstendenzen im Gesundheitssektor.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Kapitel 1 beleuchtet den Fachkräftemangel; Kapitel 2 beschreibt die Charakteristika von Pflegetätigkeit; Kapitel 3 analysiert Interaktionsarbeit in der Pflege; Kapitel 4 behandelt Arbeitsorganisationsformen (Funktionspflege und ganzheitliche Pflege); Kapitel 5 untersucht Ökonomisierungs- und Rationalisierungstendenzen; Kapitel 6 bietet einen Ausblick auf die Durchsetzbarkeit ganzheitlicher Pflege.
Welche Konzepte werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die Konzepte der Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und des subjektivierenden Arbeitshandelns im Kontext der Pflege. Sie analysiert, wie diese Konzepte durch verschiedene Arbeitsorganisationsformen (z.B. ganzheitliche Pflege) berücksichtigt und etabliert werden können.
Welche Rolle spielt die ganzheitliche Pflege?
Die ganzheitliche Pflege wird als ein möglicher Ansatz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Schaffung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen in der Pflege untersucht. Die Arbeit evaluiert, ob und wie sie dazu beitragen kann, den Herausforderungen der Branche zu begegnen.
Wie werden Ökonomisierung und Rationalisierung betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von Ökonomisierung und Rationalisierung (Verschlankung, Kommodifizierung, Externalisierung) auf die Arbeitsbedingungen und die Qualität der Pflege. Der Zusammenhang zwischen ökonomischen Zwängen und den Herausforderungen der Pflegearbeit wird deutlich gemacht.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen in der Pflege eine zentrale Herausforderung darstellt. Die Implementierung ganzheitlicher Pflegemodelle wird als ein vielversprechender Ansatz diskutiert, um diesem Ziel näherzukommen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Relevante Schlüsselbegriffe sind: Pflege, Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel, Ganzheitliche Pflege, Interaktionsarbeit, Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit, Subjektivierendes Arbeitshandeln, Ökonomisierung, Rationalisierung, menschenwürdige Arbeitsbedingungen.
- Quote paper
- Johanna Ernst (Author), 2017, Ganzheitliche Pflege und die Ökonomisierung des Gesundheitssektors, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1064653