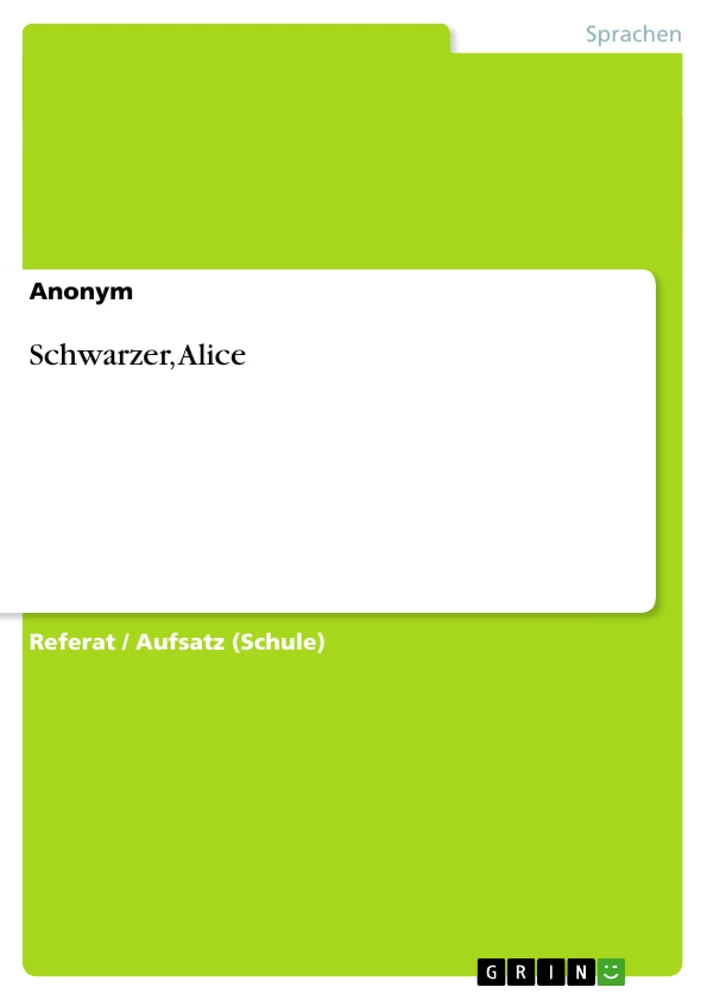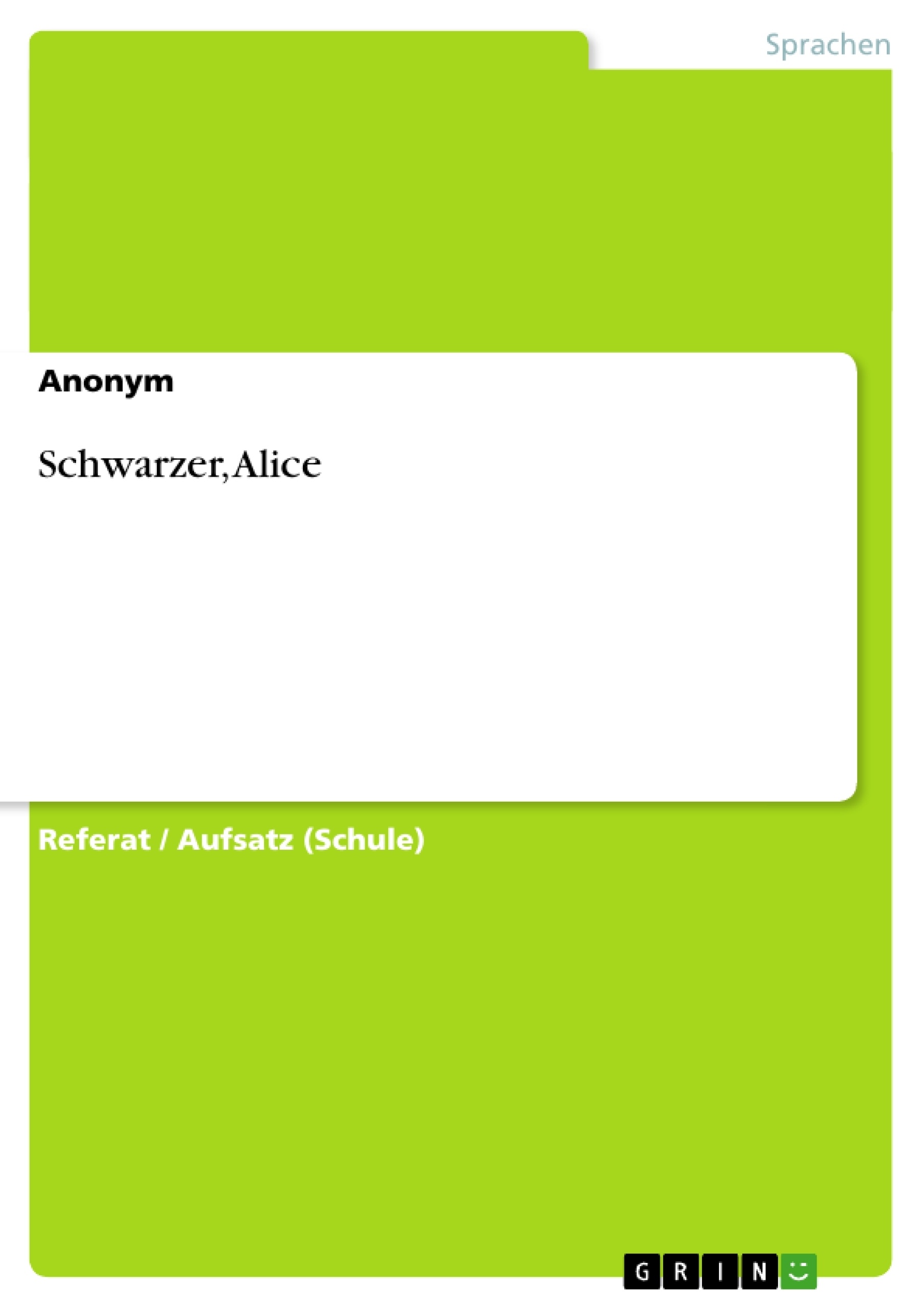Portrait
,,Noch bestehen wir ja alle aus dem alten Stoff. Und leben in einer Welt, in der Männer die reale Macht haben, Frauen dafür zwei Drittel, wenn nicht drei Viertel der Arbeit in Haus und Erwerb, ein Zehntel des Lohns und ein Hundertstel des Besitzes. Dem braucht man nichts mehr hinzuzufügen: Das sind die Verhältnisse" (Alice Schwarzer, SZ Magazin, Oktober 1991).
Alice Schwarzer wurde oft als ,,frustrierte Tucke" (SZ) oder ,,Hexe mit dem stechenden Blick" (Bild) beschimpft. Sie hat diese bösen und persönlichen Verleumdungen weggesteckt und wundert sich heute, dass sie nicht in der Klapsmühle gelandet ist.
Inzwischen hat sich die einst verhöhnte, verspottete und kämpferische ,,Chef-Emanze" jedoch zur medial allgegenwärtigen Entertainerin gewandelt. Sie ist heute ein gerngesehener Talkgast in diversen Sendungen und ist qualifiziert
dafür. Sie fährt sogar im Kölner Rosenmontagszug mit, obwohl Karnevalsgesellschaften unter Feministinnen doch als Prototyp der Männerbünde gelten. Schwarzer sieht in den Aktivitäten lediglich eine Möglichkeit, eine Seite von sich zu zeigen, die sie schon immer gehabt habe, die aber in der kämpferischen Auseinandersetzung von ihr vernachlässigt bzw. von den Gegnern übersehen wurde.
Inhaltsverzeichnis
1.) Portrait
2.) Biographie
3.) Der kleine Unterschied und seine großen Folgen
4) Resumée
5) Literaturverzeichnis
Portrait
„Noch bestehen wir ja alle aus dem alten Stoff. Und leben in einer Welt, in der Männer die reale Macht haben, Frauen dafür zwei Drittel, wenn nicht drei Viertel der Arbeit in Haus und Erwerb, ein Zehntel des Lohns und ein Hundertstel des Besitzes. Dem braucht man nichts mehr hinzuzufügen: Das sind die Verhältnisse“ (Alice Schwarzer, SZ Magazin, Oktober 1991).
Alice Schwarzer wurde oft als „frustrierte Tucke“ (SZ) oder „Hexe mit dem stechenden Blick“ (Bild) beschimpft. Sie hat diese bösen und persönlichen Verleumdungen weggesteckt und wundert sich heute, dass sie nicht in der Klapsmühle gelandet ist.
Inzwischen hat sich die einst verhöhnte, verspottete und kämpferische „Chef- Emanze“ jedoch zur medial allgegenwärtigen Entertainerin gewandelt. Sie ist heute ein gerngesehener Talkgast in diversen Sendungen und ist qualifiziert dafür. Sie fährt sogar im Kölner Rosenmontagszug mit, obwohl Karnevals- gesellschaften unter Feministinnen doch als Prototyp der Männerbünde gelten. Schwarzer sieht in den Aktivitäten lediglich eine Möglichkeit, eine Seite von sich zu zeigen, die sie schon immer gehabt habe, die aber in der kämpferischen Auseinandersetzung von ihr vernachlässigt bzw. von den Gegnern übersehen wurde.
Ihrem Ziel, der Gleichberechtigung von Mann und Frau auf allen Ebenen, ist sie weiterhin treu. Doch sie kämpft jetzt mit anderen Mitteln. „ Humor wie Ironie, immer schon Kampfmittel der Unterdrückten, sind für mich noch wichtiger geworden“ (KR, März 1992).
In 20 Jahren haben Frauen die Jahrtausende währende Männerherrschaft ganz schön ins Wanken gebracht. Die Freiheiten für die einzelne Frau sind ungleich größer geworden, als sie es vor einer Generation waren. Auch wenn die Männer- welt zurückschlägt. Dass Männer ihre Macht mit allen Mitteln verteidigen, dafür hat sie Verständnis. Die Auseinandersetzung sieht sie als sportiven Wettstreit. Kein Verständnis hat sie , wenn Frauen die Ziele der Frauenbewegung verraten. Schwarzers Ansicht von zurückschlagenden Männern trägt jedoch schon Züge einer geheimbündlerischen Verschwörung. Männer sind schon lange nicht mehr
so dumm, sich selbst gegen den Feminismus zu äussern, dafür schicken sie die Frauen.
Dass Alice Schwarzer das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde, hat sie jedoch nicht als Trick der Männergesellschaft, sie zu vereinnahmen, empfunden. Sie weiß, welche politische Bedeutung eine solche Auszeichnung hat, wenn eine Frau sie bekommt. Frauen haben bestenfalls eine Ehre zu verlieren, dass sie Ehre bekommen, ist selten.
BIOGRAPHIE
1942: Alice Schwarzer kommt am 03.12.1942 als ungewolltes, uneheliches Kind von Erika Schwarzer in Wuppertal-Eberfeld zur Welt und wird vor allem von den Großeltern und einer Tante erzogen.
1957: Nach dem Abschluss der Volksschule besucht sie die nächsten zwei Jahre die Handelsschule in Eberfeld. Dann beginnt sie eine kaufmännische Lehre in Wuppertal.
1960: Schwarzer geht nach Düsseldorf und arbeitet als Sekretärin. Anschließend siedelte sie nach München über, wo sie Büroarbeiten in einem Verlag erledigt.
1963-1966: Umzug nach Paris. Mit Gelegenheitsjobs finanziert sie sich ein Sprachenstudium an der Alliance Francaise und an der Sorbonne in Paris. Rückkehr in die BRD. Bei der Aufnahmeprüfung zur Journalistenschule fällt Schwarzer durch.
1966-1968: Journalistisches Volontariat bei den „Düsseldorfer Nachrichten“. Während dieser Zeit beschäftigt sie sich unter anderem mit dem Schicksal lediger Mütter, den Arbeitsbedingungen von Prostituierten und der sozialen Lage weiblicher Teilzeitkräfte.
1969: Nach einer kurzzeitigen Mitarbeit bei der Illustrierten „Moderne Frau“ wird Schwarzer Reporterin der Zeitschrift „Pardon“ in Frankfurt/Main. Nach einem halben Jahr zieht sie wieder zurück nach Paris. Ohne eine feste Anstellung will sie als freie Korrespondentin arbeiten.
Ab 1970: Alice Schwarzer engagiert sich in der Frauenbewegung zunächst in Frankreich und später in der Bundesrepublik. Mit der Zeit gehört sie zum harten Kern des „Mouvement de liberation des femmes“ (MLF), einer Art Netzwerk, das die verschiedenen französischen feministischen Gruppen und Strömungen zu- sammenfasst. Schwarzer übernimmt viele Positionen der französischen Femi- nistinnen: So lehnt sie jeden Ansatz zur Frauenbefreiung, der mit der „Natur“ der Frau oder der Differenz zwischen den Geschlechtern operiert, ab. Schwarzer wird zu den „feministes radicales“ gezählt, die sich zwar als „Links gerichtet“ verstehen, aber den Kampf gegen das Patriarchat vor den Kampf gegen den Kapitalismus stellen.
In Zusammenhang mit einem Interview mit Jean Paul Sartre begegnet Schwarzer erstmals der Philosophie von Simone de Beauvoir deren Buch „Das andere Geschlecht“ als Grundlagenwerk der Neuen Frauenbewegung gilt. 1972 wird das erste von sechs langen Interviews, die Schwarzer innerhalb von zehn Jahren mit Simone de Beauvoir führt, veröffentlicht.
1970-1974: Studium der Psychologie und Soziologie an der Pariser Universität Vincennes. Gleichzeitig arbeitet Schwarzer als freie politische Korrespondentin für Funk, Fernsehen und Printmedien in Paris.
ab 1971: Dem Vorbild französischer Frauen folgend initiiert Alice Schwarzer den „stern“-Artikel „Ich habe abgetrieben“, in dem sich 374 Frauen selbst der Abtreibung bezichtigen. Der Artikel führt zu einer breit angelegten Kampagne gegen den Paragraphen 218 und wird als Anfangspunkt der Neuen Frauenbe- wegung in der Bundesrepublik angesehen. Veröffentlichung ihres ersten Buches „Frauen gegen den Paragraphen 218“. Schwarzer pendelt zwischen Frankreich und der Bundesrepublik hin und her. Sie engagiert sich nun auch verstärkt in der deutschen Frauenbewegung und gehört zu den Mitbegründerinnen der „Aktion 218 Köln“. Schwarzer nimmt im März 1972 an der Bundesfrauenkonferenz in Frankfurt/Main teil, wo sie in der Arbeitsgruppe, die sich mit den Strategien der Frauenbewegung beschäftigt, mitarbeitet.
1973-75: Veröffentlichung des Buches „Frauenarbeit- Frauenbefreiung“. Darin thematisiert sie Probleme von Gratisarbeit im Haushalt, der Erziehung und der Unterbezahlung von Frauen im Beruf. Lehrauftrag an der Universität Münster. Schwarzer referiert im Fachbereich Soziologie über den „Stellenwert der Sexualität in der Emanzipation der Frau“. Anschluss an eine Gruppe Berliner Frauenrechtlerinnen, die kurz vor der Verabschiedung des neuen Abtreibungs- gesetzes die „Aktion letzter Versuch“ koordiniert. März: Ein von Schwarzer initiierter Aufruf der MedizinerInnen zur Solidarisierung mit den Paragraph 218- Gegnerinnen wird im Spiegel veröffentlicht. Eine „Panorama“-Sendung, bei der Schwarzer die Autorin ist, wird abgesetzt. In der Sendung werden Ärzte, die bereit sind Abtreibungen vorzunehmen, vorgestellt und eine bisher kaum bekannte Abtreibungsmethode gezeigt. Die Absetzung der Sendung wird als Eingriff in die Pressefreiheit bewertet und löst einen Zensurskandal in der ARD aus. Eine Woche später wird der Abtreibungsfilm im 3. Programm von NDR und Radio Bremen ausgestrahlt.
1975: Erste Veröffentlichung des „Frauenkalender“, der seither jährlich erscheint. Zu den fünf Herausgeberinnen zählt auch Alice Schwarzer. Sie zieht nach Berlin in eine Frauen-Wohngemeinschaft. Kurz darauf diskutiert Schwarzer mit Esther Vilar („Der dressierte Mann“) in einer Sendung. Mit diesem spektakulären Fern- sehauftritt gilt Schwarzer zunehmend als „Aushängeschild“ der Neuen Frauenbe- wegung. Veröffentlichung von „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“ Oktober: Schwarzer startet eine Diskussionsreise durch die Bundes-republik unter dem Titel „Die Frau in der Diskussion“ oder „Wer hat Angst vor Alice Schwarzer“.
1976/1977: Gründung der „Alice Schwarzer Verlags-GmbH“ mit Sitz in Köln.
Gesellschafterin und Geschäftsführerin ist Alice Schwarzer. Kurz darauf wird die Firma in „Emma Frauenverlags-GmbH“ umbenannt. Mitbegründerin und Herausgeberin der bundesweit erscheinenden autonomen feministischen Zeitschrift “Emma“, die unter dem Motto „von Frauen für Frauen“ steht.
1983-1987: Mitbegründerin des „Hamburger Instituts für Sozialforschung“.
Initiatorin und Vorstandsvorsitzende des „FrauenMediaTurm“- Das feministische Archiv und Dokumentationszentrum“ in Köln. Mitglied des PEN-Club. In der „Emma“ beginnt eine Anti-Porno-Kampagne, die der Entwürdigung und Er- niedrigung der Frauen durch pornographische Darstellungen entgegenwirken soll. Sie wird Gründungsmitglied des Kölner Presse-Club.
1991/1992: Die Stadt Wuppertal zeichnet Schwarzer mit dem Von-der-Heydt-
Preis, als „Vorkämpferin der deutschen Frauenbewegung“ aus. Auszeichnung mit der Kurt-Nevern-DuMont-Medaille der Westdeutschen Akademie für Kommunikation.
1992-2000: Schwarzer moderiert Im Fernsehen des Hessischen Rundfunks die Talkshow „Zeil um Zehn“. Veröffentlichung des Buches „Eine tödliche Liebe“. Veröffentlichung der Biographie der „Zeit“-Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff mit dem Titel „Ein unwiderständiges Leben“. Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz. Der Deutsche Staatsbürgerinnen-Verband ernennt Schwarzer zur „Frau des Jahres 1997“.Veröffentlichung der Biographie Romy Schneider „Mythos und Leben“. Veröffentlichung der Schrift „Simone de Beauvoir. Rebellin und Wegbereiterin“. Veröffentlichung des Buches „ Der große Unterschied. Gegen die Spaltung von Menschen in Männern und Frauen“.
2. „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“
In dem erstmals 1975 erschienen Buch „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“ von Alice Schwarzer werden ausführliche Gespräche mit Frauen unterschiedlicher sozialer Herkunft, unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Familienstandes geführt und kommentiert.
Schwarzer löste mit dieser Dokumentation eine Unzahl an Reaktionen aus und bekam sehr viel Post von Frauen, die sich in den Protokollen wiederfanden und die sich ermutigt fühlten, ihre Situation zu verändern. Aus heutiger Sicht wirken Schwarzers Feststellungen mitunter vereinfachend und dogmatisch- damals musste aber, um wachzurütteln, wohl diese Sprache gewählt werden. Doch, wenn man sich richtig erinnert, damals war es Frauen gerade erstmals gestattet, auch ohne Einwilligung des Ehemannes berufstätig zu sein.
Frauen erkennen sich in den Protokollen wieder. Sie sind entsetzt, erleichtert und wütend zugleich. Entsetzt, weil andere das aussprechen, was sie selbst sich oft nicht eingestehen können und wollen. Erleichtert, weil sie nicht länger allein sind, weil andere Frauen ähnliche Probleme haben. Und wütend, weil ihre Unterdrückung und Ausbeutung Absicht derer ist, die davon profitieren. Viele Männer machen es sich einfach, sie sagen, bei ihnen und ihrer Frau (Freundin)sei alles ganz anders. Einige aber sind erschüttert über den Preis, den sie für ihren „kleinen Unterschied“ zahlen müssen. Am schlimmsten ist es da, wo Frauen und Männer dank des Unterschieds füreinander geschaffen sind: in der Sexualität. Nach Problemen wie Abtreibung, Berufsarbeit und Hausarbeit ist die Sexualität der Angelpunkt der Frauenfrage. Sexualität ist zugleich Spiegel und Instrument der Unterdrückung der Frauen in allen Lebensbereichen. Hier liegen Unterwerfung, Schuldbewusstsein und Männerfixierung von Frauen verankert. Hier steht das Fundament der männlichen Macht und der weiblichen Ohnmacht. Doch weitaus tragischer ist der Part der Frauen. Frauen haben Probleme mit der Zeit und ständige Angst. Zeit, weil Frauen nie Zeit und immer zu tun haben, immer hetzen müssen, zur Arbeit, zu wartenden Kindern und Männern. Angst, weil Frauen Angst vor ihren Männern haben, denn sie sind emotional, sozial und meist auch ökonomisch von ihnen abhängig.
Viele sprechen nur von der Ausbeutung der „proletarischen Frau“ und halten der sogenannten „bürgerlichen Frau“ vor, sie sei privilegiert, führe ein faules Leben und beute Männer aus. Die primäre Ausbeutung der Frauen wie Hausarbeit, Kindererziehung, Männersanierung und frauenspezifische Berufsarbeit fällt durch das existierende Klassenraster hindurch.
In welchem Ausmaß auch die Probleme dieser sogenannten bürgerlichen Frauen Fragen auf Leben und Tod sind, zeigen alle Protokolle: schwere Krankheiten und psychische Störungen, Selbstmordgedanken und -versuche gehören zu ihrem Alltag. Typisch ist auch die Haltung des Ehemanns. Auf Ausbruchversuche von Frauen reagieren Männer meist mit Gewalt. Entweder mit körperlicher, oder da, wo die Frauen sich das nicht mehr bieten lassen, mit psychischer Gewalt (Erpressung mit Kindern etc.). Das ist unabhängig von der sozialen Schicht (Polizei- und Justizberichte zeigen, dass bürgerliche Männer nicht weniger, sondern höchstens kaschierter prügeln als proletarische).
Nicht nur Zeitmangel und Überarbeitung hindern Frauen an der gesellschaftlichen Teilnahme. Mehr noch scheinen es die Ehemänner zu sein, die nicht vertragen können, dass ihre Frauen eigene Interessen haben und ihnen am Feierabend nicht zur Verfügung stehen. Außerdem verstärkt alle Eigeninitiative die Selbständigkeit der Frauen und schwächt so ihre Abhängigkeit von Männern. Diese Abhängigkeit aber wird von den meisten Männern mit physischer oder psychischer Gewalt am sozialen und politischen Engagement gehindert.
Da nützt der schönste Beruf nichts, wenn er von Männernormen, die Frauen fremd sind, beherrscht wird, und wenn Frauen privat und professionell weiter vor allem nach unserer „Weiblichkeit“ beurteilt werden- und schon sich selbst danach beurteilen. Wenn Frauen schon nicht in allen Bereichen kuschen, wenn sie es schon wagen, beruflich erfolgreich zu sein, werden sie von ihren Männern nicht selten zur Kasse gebeten: sie haben diese Männer dann weitgehend mitzuernähren, die belastenden Seiten der „Männerrolle“ zu übernehmen, ohne von den negativen Seiten der „Frauenrolle“ lassen zu können.
Frauen werden im Namen der Liebe ausgebeutet! Das nennen sie Liebe, wenn sie ihm mit 17 die hemdenbügelnde Mutter ersetzt, wenn sie ihn heiratet, weil sie ja doch schon alle Arbeit tun, wenn sie schuftet um dem Mann das Studium zu finanzieren und ihm lebenslang die Schuhe zu putzen. Eine sehr einseitige Sache, die Liebe von Müttern und Frauen. Und die Frauen sind nicht einmal sauer, wenn dann so ein Mensch, dem sie 20 Jahre lang sklavisch gedient hat, nicht eine Sekunde zögern würde, seinen Gratis-Service mit dem Gesetz zu erzwingen. Wenn er nach diesen Jahren Gemeinsamkeit nicht denn Bruchteil einer Sekunde an ihr Wohl denkt, sondern nur an seines.
Nicht der biologische Unterschied, aber seine ideologischen Folgen müsste restlos abgeschafft werden! Denn Biologie ist nicht Schicksal, sondern wird erst dazu gemacht. Männlichkeit und Weiblichkeit sind nicht Natur, sondern Kultur. Sie sind die in jeder Generation erzwungene Identifikation mit Herrschaft und Unterwerfung. Nicht Penis und Uterus machen Menschen zu Männern und Frauen, sondern Macht und Ohnmacht.
Nichts weder Rasse noch Klasse, bestimmt so sehr ein Menschenleben wie das Geschlecht. Und dabei sind Frauen und Männer Opfer ihrer Rollen- aber Frauen sind immer noch die Opfer der Opfer. Angst, Abhängigkeit, Misstrauen und Ohnmacht der Frauen sind groß. Nicht einzelne versuchen, einer Mehrheit von zufriedenen Frauen den Männerhass einzureden, sondern diese einzelnen gestehen ihn nur ein. Sie wollen nicht länger darüber hinweglügen.
Die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind heute eindeutig Machtbeziehungen, dass auch die weibliche Sexualität nur wieder Ausdruck weiblicher Ohnmacht sein kann. Daran liegt es, dass auch wünschenswerte Freiheiten wie Verhütung oder legaler Schwangerschaftsabbruch Frauen manchmal noch unfreier machen können; sie schlagen als Bumerang auf die Frauen zurück.
Mann-Frau-Beziehungen sind Herrschaftsverhältnisse. Frauen sind unterlegen, Männer überlegen. Diese Machtstrukturen spiegeln sich in der Sexualität. Die herrschenden sexuellen Normen, und damit die Sexualität selbst, sind Instrument zur Etablierung dieser Machtbeziehungen zwischen Mann und Frau. Nur wenn Frauen Männern privat nicht mehr ausgeliefert sind, nur wenn das Dogma der Vorrangigkeit der Heterosexualität infrage gestellt wird, haben Frauen die Chance zu einer eigenständigen, nicht auf Männer fixierte Entwicklung. Erst dann können sie Beziehungen in Freiheit wählen. Langfristig haben dabei beide Geschlechter zu gewinnen, kurzfristig aber haben Frauen vor allem ihre Ketten und Männer ihre Privilegien zu verlieren.
Alle, die von Gleichheit reden, obwohl Ungleichheit die Geschlechterbeziehungen bestimmt, machen sich täglich neu schuldig. Sie sind nicht an einer Veränderung, nicht an der Vermenschlichung von Männern und Frauen interessiert, sondern an der Beibehaltung der herrschenden Zustände, denn sie profitieren davon. Die Ausbeutung der Frauen hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht gelindert, sondern verschärft. Frauen arbeiten mehr denn je zuvor. Nur die Formen dieser Ausbeutung sind manchmal subtiler, schwerer fassbar geworden. Das, was offiziell unter Emanzipation verstanden wird, bedeutet für Frauen oft nicht mehr, als dass „aus Sklavinnen freie Sklavinnen“ wurden.
RESUMÉE
Die psychische Abhängigkeit vom Mann ist frappierend. Es hat einer Gehirnwäsche von Jahrtausenden bedurft, um den Frauen den Glauben an ihre eigene Minderwertigkeit, den Glauben an das „stärkere Geschlecht“ und diese tiefen Zweifel in ihnen selbst einzupflanzen.
Psychoanalyse und Psychologie wurden zu den Verkündern der „Wahrheit“ der menschlichen „Natur“ und schufen ein unwidersprochenes Bild der „weiblichen Natur“.
Mädchen werden schon von klein auf in ihre Rollen gedrängt. Männliche Babys werden länger gestillt und später erst zur Sauberkeit erzogen als weibliche Babys. Das Bedürfnis, das Kind zu zähmen, ist stärker, wenn es sich um Mädchen handelt. Ein Junge ist, obwohl er klein und wehrlos ist bereits Symbol einer Autorität, der die Mutter selbst unterworfen ist.
In der Kindheit sind Mädchen verwirrt durch den Zwang zur weiblichen Rolle. Jungen spielen mit Autos und Mädchen müssen mit Puppen spielen. Später in der Teenagerzeit ist die anerzogene Unterschiedlichkeit bereits unüberwindbar tief. Mädchen knutschen mit Jungen, weil es alle tun, weil es das Ansehen hebt; aber gleichzeitig empfinden sie es als fremd. Noch sind Mädchen Freundinnen und keine Rivalinnen. Sie haben emotionale Beziehungen zueinander und nicht selten auch sexuelle. Später beugt sich die Mehrheit den aufgezwungenen Normen. Alle Mädchen finden sich hässlich und dumm und warten auf ihren Traummann, ihre Kinder und ihr Haus.
Simone de Beauvoir:„Man kommt nicht als Frau auf die Welt, man wird dazu gemacht“
Mit dieser Aussage wird belegt, dass Menschen entweder eindeutig Mann oder eindeutig Frau sind. Schlicht Menschsein genügt nicht. Wer nicht in eine der beiden Schubladen passt, fällt heraus. Das biologische Geschlecht dient vom ersten Tag an als Vorwand zum Drill zur „Weiblichkeit“ oder „Männlichkeit“. Da gibt es kein Entkommen.
Einmal müssen Frauen gegen das System angehen und zum zweiten gegen die Männer. Frauen müssen außer Haus arbeiten, denn damit können sie wirklich unabhängig sein. Dann können sie sich auch scheiden lassen ,wenn sie wollen, denn jetzt können sie sich selbst und ihre Kinder ernähren.
Es ist zwar nicht etwas Besonderes von der Weiblichkeit zu erwarten, dass sich interessante, poetische eben weibliche Werte entwickeln. Es ist eine Tatsache, dass die universelle Kultur, die Zivilisation und die allgemein gültigen Werte von Männern geschaffen wurden. Frauen sollten sich die von den Männern geschaffenen Werte aneignen und sie nicht ablehnen. Das ist die Aufgabe der Frauen, denn man darf die Welt der Männer nicht ablehnen, da sie gleichzeitig die Welt überhaupt ist. Uns das ist schließlich gleichzeitig auch die Welt der Frauen.
LITERATURVERZEICHNIS
Schwarzer, Alice: Der „kleine Unterschied“ und seine großen Folgen, Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 18. Aufl. November 2001
Schwarzer, Alice: Mit Leidenschaft, Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, Oktober 1985
Hopfner, Johanna und Leonhardt, Hans-Walter: Geschlechterdebatte: eine Kritik, Bad Heilbrunn, Klinkhardt 1996
Rendtorff, Barbara und Moser, Vera (Hrsg): Geschlecht und Verhältnisse in der Erziehungswissenschaft, eine Einführung, Leske & Budrich, Opladen 1999
Internet
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes über Alice Schwarzer?
Der Text ist eine Art Sprachvorschau, die ein Porträt, eine Biographie, eine Diskussion über den "kleinen Unterschied und seine großen Folgen", ein Resümee und ein Literaturverzeichnis enthält. Er analysiert Alice Schwarzers Leben, Werk und ihren Einfluss auf die Frauenbewegung.
Was wird im Portrait von Alice Schwarzer behandelt?
Das Porträt beschreibt Alice Schwarzer als eine oft kritisierte, aber kämpferische Figur der Frauenbewegung. Es beleuchtet ihre Wandlung von einer radikalen Feministin zu einer medial präsenten Persönlichkeit und ihre fortwährende Hingabe an die Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Welche Ereignisse werden in Alice Schwarzers Biographie hervorgehoben?
Die Biographie listet wichtige Lebensereignisse auf, von ihrer Geburt als uneheliches Kind über ihre Ausbildung und journalistische Tätigkeit bis hin zu ihrem Engagement in der Frauenbewegung, der Gründung von "Emma" und Auszeichnungen für ihr Lebenswerk. Sie deckt die Jahre von 1942 bis 2000 ab.
Was ist das zentrale Thema des Abschnitts "Der kleine Unterschied und seine großen Folgen"?
Dieser Abschnitt behandelt das gleichnamige Buch von Alice Schwarzer und analysiert die darin geführten Gespräche mit Frauen unterschiedlicher Hintergründe. Er untersucht die Unterdrückung von Frauen in verschiedenen Lebensbereichen, insbesondere in Bezug auf Arbeit, Sexualität und Beziehungen.
Welche Rolle spielt Sexualität in der Diskussion um die Gleichberechtigung?
Sexualität wird als Spiegel und Instrument der Unterdrückung der Frauen dargestellt. Der Text argumentiert, dass herrschende sexuelle Normen Machtbeziehungen zwischen Mann und Frau etablieren und die weibliche Ohnmacht verstärken.
Welche Schlüsse werden im Resumée gezogen?
Das Resumée betont die psychische Abhängigkeit der Frauen vom Mann und die anerzogene Minderwertigkeit. Es kritisiert die Prägung von Mädchen in stereotype Rollenbilder und fordert Frauen auf, sich dem System und den Männern entgegenzustellen, um Unabhängigkeit zu erlangen.
Welche Quellen werden im Literaturverzeichnis aufgeführt?
Das Literaturverzeichnis enthält Werke von Alice Schwarzer, insbesondere "Der kleine Unterschied und seine großen Folgen" und "Mit Leidenschaft", sowie weitere Bücher zur Geschlechterdebatte und Bildungsforschung.
Was ist die Bedeutung des Paragraphen 218 in Bezug auf Alice Schwarzers Arbeit?
Alice Schwarzer initiierte den "stern"-Artikel "Ich habe abgetrieben", in dem sich Frauen selbst der Abtreibung bezichtigen. Dieser Artikel führte zu einer Kampagne gegen den Paragraphen 218 und gilt als Ausgangspunkt der Neuen Frauenbewegung in Deutschland. Schwarzers erstes Buch, "Frauen gegen den Paragraphen 218", befasste sich auch mit diesem Thema.
Was ist die Rolle von "Emma" in Schwarzers Leben?
Alice Schwarzer ist Mitbegründerin und Herausgeberin der feministischen Zeitschrift "Emma", die sich an ein weibliches Publikum richtet und als bedeutendes Sprachrohr der autonomen Frauenbewegung gilt.
Was ist die zentrale Aussage des Textes zum Thema Gleichberechtigung?
Der Text argumentiert, dass Frauen in vielen Bereichen immer noch unterdrückt und ausgebeutet werden und dass die Beziehungen zwischen Mann und Frau oft Machtbeziehungen sind. Er plädiert für eine Abschaffung der ideologischen Folgen des biologischen Unterschieds und für eine größere Unabhängigkeit der Frauen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2002, Schwarzer, Alice, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106349