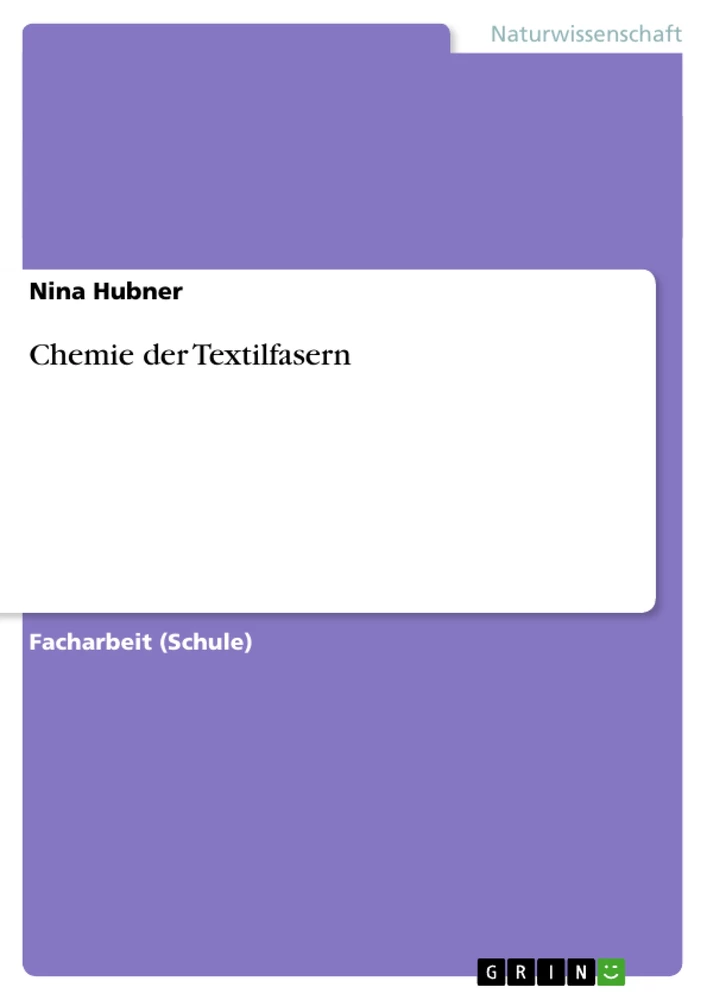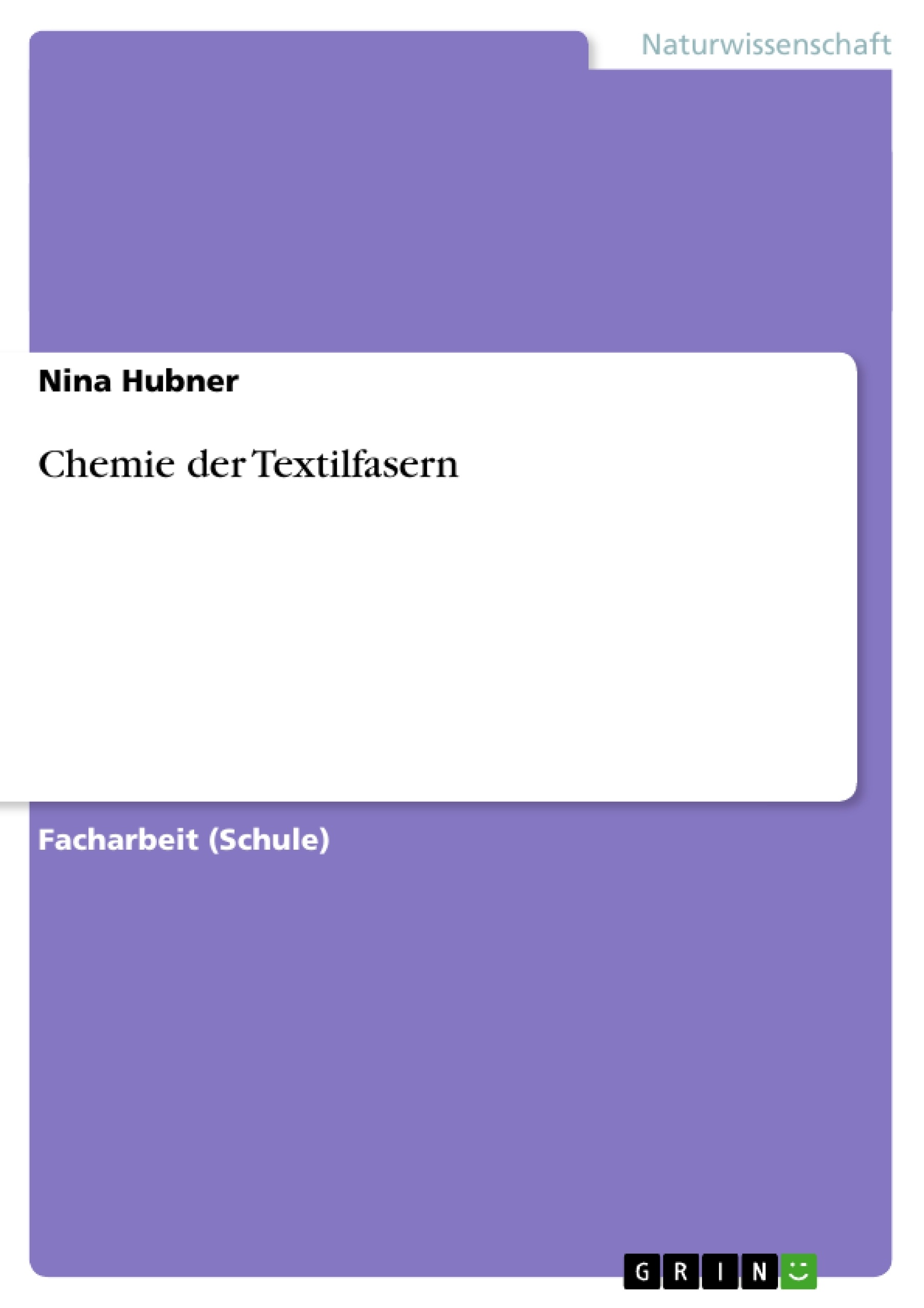Entdecken Sie die faszinierende Welt der Textilfasern, von den bescheidenen Anfängen, als Blätter notdürftig als Kleidung dienten, bis hin zur hochmodernen Chemie, die unsere heutige Textilindustrie prägt. Diese tiefgreifende Untersuchung entwirrt die komplexen Strukturen und Eigenschaften von Natur- und Chemiefasern und bietet einen detaillierten Einblick in ihre Gewinnung, Zusammensetzung und Verwendung. Tauchen Sie ein in die Chemie der Pflanzenfasern, einschliesslich Baumwolle, Flachs und Hanf, und erfahren Sie mehr über die Rolle von Cellulose, Hemicellulosen, Pektin und Lignin in ihren Zellwänden. Erkunden Sie die Welt der tierischen Fasern, von der edlen Wolle bis zur schimmernden Seide, und entdecken Sie die Geheimnisse ihrer einzigartigen Eigenschaften. Wagen Sie einen Blick in die Welt der Chemiefasern, sowohl aus natürlichen Polymeren gewonnen als auch synthetisch hergestellt, und verstehen Sie die Prozesse der Polymerisation, Polykondensation und Polyaddition. Ein vergleichender Überblick über die Eigenschaften der verschiedenen Fasern ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Textilien zu treffen, während ein detaillierter Abschnitt über die Wollbeschaffung Einblicke in diesen wichtigen Aspekt der Textilherstellung bietet. Ob Student, Textildesigner oder einfach nur neugieriger Leser, diese umfassende Ressource bietet ein unschätzbares Verständnis für die Fasern, die unsere Welt kleiden, und verbindet historische Bedeutung mit modernster wissenschaftlicher Erkenntnis. Tauchen Sie ein in die mikroskopische Welt der Fibrillen und Makromoleküle und entschlüsseln Sie die Geheimnisse, die in jeder einzelnen Faser verborgen liegen. Lassen Sie sich von der Vielfalt und Komplexität der Textilfasern überraschen und erweitern Sie Ihr Wissen über die Materialien, die unser tägliches Leben prägen. Diese Reise durch die Welt der Textilien offenbart die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit in der Textilindustrie und beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Chemie, Technologie und Tradition bei der Herstellung unserer Kleidung und Textilien. Erfahren Sie, wie sich die Textilherstellung im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, von den ersten Versuchen mit natürlichen Materialien bis hin zu den hochmodernen Verfahren der heutigen Zeit, und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die wissenschaftlichen Prinzipien, die hinter jedem einzelnen Faden stecken.
Inhalt
Vorwort
Geschichte der Textilfasern
Chemie der Textilfasern
I. Naturfasern
1. Pflanzliche Fasern
a) Samenfasern
b) Bastfasern
c) Hartfasern
2. Tierische Fasern
a) Wolle und Haare
b) Seiden
3. Mineralische Fasern
II. Chemiefasern
1. Aus natürlichen Polymeren erzeugt
a) Cell ulose
b) Eiweiß
2. Synthetisch erzeugt
a) Polymerisationsprodukte
b) Polykondensationsprodukte
c) Polyadditionsprodukte
3. Auf anorganischer Basis beruhend
III. Eigenschaften der Fasern im Vergleich
Beschaffung der Wolle
Anhang
Literaturangaben
Erklärung
Vorwort
Diese Arbeit gibt vor allem über den chemischen Aufbau der gebräuchlichsten Textilfasern Auskunft. In den Text sind lediglich einige Formeln eingefügt. Die zu der Arbeit gehörenden Plakate ermöglichen eine genauere Vorstellung des Aufbaus und Aussehens der Fasern.
Mein Dank geht im Speziellen an Herrn Wagner, der mir bei den Versuchen behilflich war, an Herrn Keck der Firma Clariant, der mir Fachliteratur zu dem Thema besorgte und an Frau Weiler aus Grasset/Burgkirchen, die mich über Schafwolle aufklärte und mir Wolle zur Verfügung stellte.
Geschichte der Textilfasern
Nahrung, Behausung und auch Kleidung: Seit jeher die dringendsten Bedürfnisse des Menschen. Ganz simpel begann die „Textilherstellung“, indem Blätter um den Leib gewickelt wurden, die mit Knochen, Ästchen oder Baumnadeln festgesteckt waren. Bald darauf erfanden die Menschen eine Technik, die sich „Reihung“ nennt, wobei man gleichartige Blätter zu einem Schurz zusammenlegte und diese mit einer Sehne oder Ranke durchzog. Ein Grasrock entstand durch Verknoten von Gräsern („Knüpfen“). Mit der Zeit fand man heraus, welche Tiersehnen, Ranken oder binsenbzw. hanfartige Pflanzenteile sich am besten zur Textilherstellung eigneten und sammelte diese gezielt ein. In den kälteren Teilen der Welt griff der Mensch auf Tierfelle zurück, die er zurechtschnitt und mit Tiersehnen zusammennähte. Dann begann man aus Tierhaaren, v. a. Wolle, durch Filzen oder Walken, also stampfen in Urin oder Walkerde, eine feste zusammenhängende Masse zu fertigen. Mit der Erfindung des Spinnens, zunächst von Wolle, konnte man längere bzw. endlose Fäden erzeugen, die das Weben möglich machten. Diese Technik wurde immer weiter ausgefeilt und findet bis heute Anwendung in der Herstellung unserer Textilwaren. Erst in neuester Zeit benutzt man neben den natürlich vorkommenden Fasern auch auf chemischem Wege hergestellte Fasern, die künstlichen und synthetischen Fasern, um Stoffe zu fertigen.
Chemie der Textilfasern
I. Naturfasern
Naturfasern sind Fasern, die der Mensch aus der Natur als Ganzes gewinnen kann. Sei es aus Pflanzen, von Tieren oder sogar aus anorganischen Materialien.
Die in der Textilindustrie genutzten Fasern sind in der Regel organische Fasern. Sie bestehen, Naturfasern genau so wie Chemiefasern, zum Größten Teil aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff.
1. Pflanzliche Fasern
Pflanzliche Fasern nennt man auch natürliche bzw. native Cellulosefasern. Man unterscheidet zwischen Samen-, Hartund Bastfasern. Die Fasern befinden sich jeweils in den Samen, in/an der Frucht bzw. in der Bastschicht des Stengels oder des Blattes.
Zu den Samenfasern gehören die Baumwolle und Kapok. Die Kokosfaser ist ein Vertreter der Fruchtfasern. Flachs, Hanf, Ramie und Jute zählt man zu der Gruppe der Bastfasern.
Cellulose, zu deren Aufklärung der Chemiker H. Staudinger ganz wesentlich beigetragen hat, ist der Hauptbestandteil der pflanzlichen Zellwand. Cellulosefasern bestehen ganz oder zum Großteil aus Cellulose, welche aus dem 1,4- b -glycosidisch verknüpftem Disaccharid Cellobiose aufgebaut ist. Durch vollständige Hydrolyse mit mäßig
konzentrierter Säure erhält man ausschließlich b -D-Glucose (Drehwert: + 18,7°). Nach kurzer Zeit hat sich aber durch den Vorgang der Mutorotation ein Gleichgewicht aus a - und b -Glucose mit dem optischen Drehwehrt + 52,7° eingestellt. Der Polymerisationsgrad der Fadenmoleküle schwankt in weiten Grenzen (1500 – 5000 Glucoseeinheiten), wie man durch Molekülmassenbestimmung (zwischen 500.000 und 1.500.1 u) feststellen kann. Etwa 30 dieser Makromoleküle sind wiederum zu bündelartigen Elementarfibrillen ( o / ca. 3 nm), die durch Wasserstoffbrücken zusammengehalten werden, zusammengefasst und kristallin geordnet. Eine Elementarzelle des Gitters enthält 4 Glucosebzw. 2 Cellobioseeinheiten.
In der Zellwand von Pflanzen sind diese Elementarfibrillen zu größeren Bündeln, den sogenannten Mikrofibrillen zusammengelagert, welche untereinander netzartig verflochten sind.
Manche Pflanzenfasern wie Flachs oder Baumwolle bestehen fast ausschließlich aus Cellulose. Holz, einer der wichtigsten Celluloselieferanten, enthält hingegen neben der Cellulose auch einige Begleitstoffe wie Hemicellulosen, Pektin oder Lignin, deren Aufgabe es ist, die Elementarfibrillen in den Mikrofibrillen zu „verkleben“.
Hemicellulosen sind Polysaccharide, v. a. Xylan, die durch Säuren leichter spaltbar sind als Cellulose. Auch in Laugen sind sie besser löslich. So können sie auf chemischem Wege entfernt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Pektin ist ein Makromolekül aus 1,4- b -glycosidisch verknüpften Galakturonsäurebausteinen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lignin, auch „Holzstoff“ genannt, besteht aus substituierten Phenylpropaneinheiten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
a) Samenfasern
Die Baumwollfaser soll als Vertreter der Samenfasern genauer behandelt werden. Fast 60 % der Weltproduktion kommt aus den Südstaaten der USA. Die Baumwollpflanze (Gossypium) wächst als Strauch, der nur 25 cm aber auch 2 m hoch werden kann. Sie gehört zur Familie der Malvengewächse.[1]
Die zwischen 18 und 50 cm lange Baumwollfaser, eine einzellige Faser, besteht zu etwa 91 % aus Cellulose. Der Rest sind ca. 6-8% Wasser und Begleitstoffe.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter umfasst. Es enthält Informationen über Textilfasern, insbesondere deren chemischen Aufbau und Geschichte.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen sind die Geschichte der Textilfasern, die Chemie der Textilfasern (einschließlich Naturfasern und Chemiefasern), der Vergleich der Eigenschaften der Fasern und die Beschaffung von Wolle.
Welche Arten von Naturfasern werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt pflanzliche Fasern (Samenfasern, Bastfasern, Hartfasern), tierische Fasern (Wolle, Haare, Seide) und mineralische Fasern.
Welche Arten von Chemiefasern werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt Chemiefasern, die aus natürlichen Polymeren erzeugt werden (Cellulose, Eiweiß), synthetisch erzeugte Fasern (Polymerisationsprodukte, Polykondensationsprodukte, Polyadditionsprodukte) und Fasern auf anorganischer Basis.
Was ist Cellulose und welche Rolle spielt sie bei pflanzlichen Fasern?
Cellulose ist der Hauptbestandteil der pflanzlichen Zellwand. Cellulosefasern bestehen ganz oder zum Großteil aus Cellulose, welche aus dem 1,4-β-glycosidisch verknüpftem Disaccharid Cellobiose aufgebaut ist.
Was sind Samenfasern und welche Beispiele werden im Dokument genannt?
Samenfasern sind pflanzliche Fasern, die sich in den Samen befinden. Beispiele sind Baumwolle und Kapok.
Was sind Bastfasern und welche Beispiele werden im Dokument genannt?
Bastfasern sind pflanzliche Fasern, die sich in der Bastschicht des Stengels oder des Blattes befinden. Beispiele sind Flachs, Hanf, Ramie und Jute.
Was wird über die Baumwollfaser gesagt?
Die Baumwollfaser, als Vertreter der Samenfasern, wird genauer betrachtet. Sie besteht zu etwa 91 % aus Cellulose, der Rest sind ca. 6-8% Wasser und Begleitstoffe.
Welche Dankesworte werden im Vorwort ausgesprochen?
Im Vorwort bedankt sich der Autor bei Herrn Wagner für die Hilfe bei den Versuchen, bei Herrn Keck der Firma Clariant für die Fachliteratur und bei Frau Weiler aus Grasset/Burgkirchen für Informationen und Wolle.
- Quote paper
- Nina Hubner (Author), 2002, Chemie der Textilfasern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106146