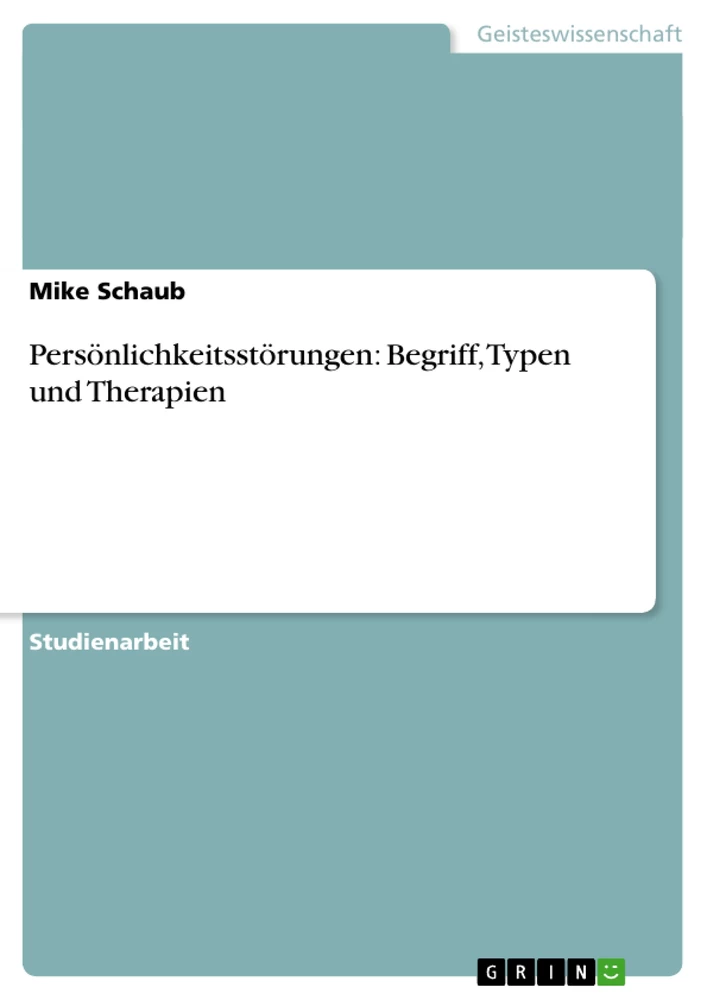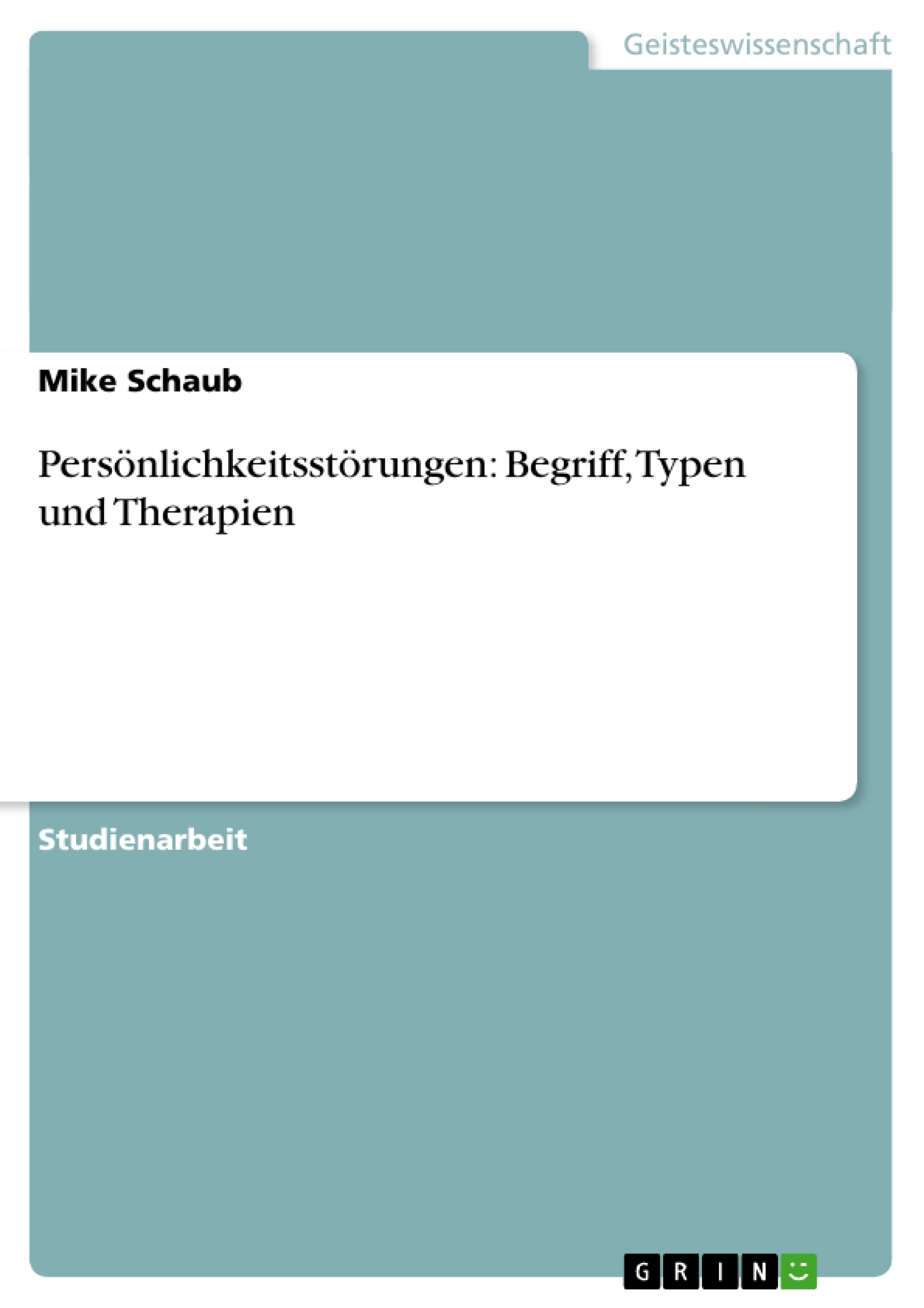Stellen Sie sich vor, Sie navigieren durch das Labyrinth der menschlichen Psyche, stets auf der Suche nach Antworten auf das komplexe Rätsel der Persönlichkeit. Doch was geschieht, wenn diese Persönlichkeit von starren Mustern und tief verwurzelten Verhaltensweisen geprägt ist, die Leiden verursachen und das Leben beeinträchtigen? Dieses Buch taucht tief in die Welt der Persönlichkeitsstörungen ein, ein Bereich, der oft von Missverständnissen und Stigmatisierung umgeben ist. Es bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Typen von Persönlichkeitsstörungen, von der paranoiden über die schizoide bis hin zur Borderline- und narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Anhand klarer Definitionen und anschaulicher Beispiele werden die komplexen Diagnosekriterien nach ICD-10 und DSM-IV verständlich erläutert. Dabei wird nicht nur auf die spezifischen Merkmale der einzelnen Störungen eingegangen, sondern auch auf die Herausforderungen bei der Differentialdiagnose und die möglichen Überschneidungen zwischen verschiedenen Kategorien. Im Fokus stehen die subjektiven Leidenszustände der Betroffenen sowie die sozialen und beruflichen Einschränkungen, die mit diesen Störungen einhergehen können. Das Buch beleuchtet auch die vielfältigen Therapieansätze, von psychoanalytischen und interpersonellen Ansätzen bis hin zur kognitiven und dialektisch-behavioralen Therapie, und gibt einen Einblick in die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten. Es ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Therapeuten, Studierende der Psychologie und alle, die sich ein tieferes Verständnis für die komplexen Facetten der menschlichen Persönlichkeit und ihrer Störungen aneignen möchten. Es werden Strategien zur Förderung von Resilienz und Bewältigungskompetenzen aufgezeigt. Ein besonderes Augenmerk gilt der Bedeutung von Empathie und Akzeptanz im Umgang mit Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. Das Buch ermutigt zu einem differenzierten Blick auf diese oft stigmatisierte Gruppe und plädiert für eine individualisierte und ressourcenorientierte Herangehensweise in der Behandlung. Es ist ein Plädoyer für mehr Verständnis und Mitgefühl im Umgang mit den Herausforderungen, die Persönlichkeitsstörungen mit sich bringen. Erfahren Sie mehr über die Epidemiologie, den Verlauf und die allgemeinen sowie spezifischen Therapieansätze, einschliesslich der dialektisch-behavioralen Therapie nach Linehan, sowie medikamentöse Therapieoptionen. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für alle, die ihr Wissen über psychische Gesundheit erweitern und einen konstruktiven Beitrag zur Unterstützung von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen leisten möchten. Es werden neue Perspektiven eröffnet und Wege aufgezeigt, wie man Vorurteile abbauen und eine inklusive Gesellschaft fördern kann, in der Menschen mit Persönlichkeitsstörungen ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen können.
1 Inhaltsverzeichnis
2 EINLEITUNG
2.1 DEFINITIONEN
2.1.1 Persönlichkeit
2.1.2 Persönlichkeitsstörung
2.1.3 Persönlichkeitsstörungen in der ICD-10 und im DSM-IV
3 TYPEN VON PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN
3.1 PARANOIDE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG (301.00, F60.0)
3.2 SCHIZOIDE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG (301.20, F60.1)
3.3 SCHIZOTYPISCHE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG (301.22, F21)
3.4 DISSOZIALE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG (301.7, F60.2)
3.5 BORDERLINE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG (301.83, F60.31)
3.6 HISTRIONISCHE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG (301.50, F60.4)
3.7 NARZISSTISCHE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG (301.81, F60.8)
3.8 ÄNGSTLICH (VERMEIDENDE) PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG (301.82, F60.6)
3.9 DEPENDENTE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG (301.6, F60.7)
3.10 ZWANGHAFTE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG (301.4, F60.5)
3.11 PASSIV-AGGRESSIVE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG
3.12 KOMBINATION VON PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN
4 EPIDEMIOLOGIE
5 VERLAUF
6 ALLGEMEINE THERAPIEANSÄTZE
6.1 EIN PSYCHOANALYTISCHER ANSATZ
6.2 DER INTERPERSONELLE THERAPIEANSATZ DER PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN
6.3 BECKS KOGNITIVE THERAPIE DER PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN
7 SPEZIFISCHE THERAPIEANSÄTZE
7.1 DIALEKTISCH BEHAVIORALE THERAPIE VON LINEHAN
8 MEDIKAMENTÖSE THERAPIEN
9 DISKUSSION
10 ZUSAMMENFASSUNG
11 ANHANG
11.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS
11.2 LITERATURVERZEICHNIS
2 Einleitung
Viele Therapeuten scheuen sich davor, Persönlichkeitsstörungen zu behandeln. Die scheinbar unendlich anmutende, mit schnellen Schwankungen verlaufende Genese führt vielerorts zu einem allgemeinen Therapiepessimismus. Dem muss entschieden entgegengehalten werden. Gezielte und regelmässige Supervision für die behandelnden Therapeuten ist nur ein gutes Rezept dazu. Auch ständige Information und Aufklärung über den neuesten Stand der Forschung können dabei helfen, die Scheu vor Persönlichkeitsstörungen einzudämmen. Die folgende Arbeit soll, im Rahmen der dreitägigen Hausarbeit, als Beitrag zum letzt genannten Punkt verstanden werden.
2.1 Definitionen
2.1.1 Persönlichkeit
Um die pathologischen Formen besser verstehen zu können, muss zuerst aufgezeigt werden, wie der Begriff der Persönlichkeit entstanden ist.
In der Persönlichkeitspsychologie existieren grundsätzlich zwei verschiedene Ansatzweisen. Im Idiographischen Ansatz wird die Unvergleichbarkeit der Individuen als Inhalt von Persönlichkeit definiert. Das Ziel dieses Ansatzes ist, die Persönlichkeit in ihrer Einmaligkeit möglichst vollständig zu erfassen. An diesem Ansatz orie ntieren sich tiefenpsychologische, kognitive und sozial-kognitive Modelle. Die Erwartungs-mal-Wert-Modelle orientieren sich ebenfalls am Idiographischen Ansatz, haben jedoch die individuelle funktionale Bedeutung des Verhaltens als Ziel. Der Nomothetische Ansatz richtet sich nach den naturwissenschaftlichen Gesetzen. Er verfolgt grundsätzlich zwei Ziele. Erstens versucht er möglichst allgemeingültige, auf alle Personen anwendbare Beschreibungsmerkmale zu definieren. Diese Beschreibungsmerkmale werden dazu benutzt, um Konstrukte auf einer höheren Abstraktionsebene zu definieren. Mit Hilfe der Konstrukte werden dann Unterschiede zwischen Personen beschrieben. Zweitens versucht der Nomothetische Ansatz die erfassten Unterschiede zwischen den Personen zu erklären.
Historisch gesehen unterteilt Hippokrates (Asendorpf, S. 128) als erster die Persönlichkeit in vier Dimensionen. Er benennt vier Temperamentstypen. Kretschmer seinerseits (1921; vgl. Asendorpf S. 124) unterscheidet in seiner Phrenologie Persönlichkeitstypen aufgrund ihres physischen Äusseren. C. G. Jung (1923) untersche idet in seinem Typenkonzept den introvertierten und den extravertierten Typ. Nach Eysenck (1951), der die Ideen von Jung und Hippokrates faktorenanalytisch analysierte, kam es im Laufe der technischen Entwicklung zu einer
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Die faktorenanalytisch ermittelten Dimensionen der Persönlichkeit aus dem Big-Five-Modell. Links stehen die auf Deutsch übersetzten Dimensionen und rechts deren untergeordneten Eigenschaften (aus Asendorpf, 1996, S. 121).
Explosion in der Persönlichkeitsforschung. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde es aufgrund methodischer Schwierigkeiten (Konsistenzproblem, Interaktionsdebatte, etc.) sowie der Erschöpfung von Forschungsstrategien ruhiger um die Persönlichkeits- forschung.
Im Gegensatz zur Persönlichkeitsforschung in der Psychologie, entflammte die Forschung zu den Persönlichkeitsstörungen erst richtig in den letzten zehn Jahren. Historisch eine Grenze zwischen Persönlichkeitsforschung und Forschung über die Typen der Persönlichkeitsstörungen zu ziehen bereitet Schwierigkeiten. Letzten Endes bleibt alles eine Frage der gesellschaftlichen Norm. Sie definiert, was unter einer pathologischen oder gesunden Persönlichkeit verstanden wird. Deshalb verschiebt sich die Grenze zwischen Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörung je nach Gesellschaft, Autor des Persönlichkeitskonzepts und Zeitpunkt des Erscheinens. Folglich muss eine Definition der Persönlichkeitsstörung stark an normativen Gesichtspunkten anknüpfen.
2.1.2 Persönlichkeitsstörung
Nebst dem Normaspekt sollte eine Definition der Persönlichkeitsstörung den subjektiven Leidensaspekt beinhalten. Persönlichkeitsstörungen sind dem Subjekt oft schmerzhaft bewusst. Besonders, wenn es aufgrund der Störung zu sozialen und beruflichen Einschränkungen kommt. Eine weitere Eigenschaft der Persönlich- keitsstörung besteht in ihrer langandauernden Anamnese. Hier einige Definitionen aus gängigen Lehrbüchern:
Davison (1998, S. 773) definiert die Persönlichkeitsstörung nach amerikanischem Vorbild wie folgt:
„Heterogene Störungsgruppe auf Achse II im DSM, die als langanhaltende, unflexible und fehlangepasste Persönlichkeitszüge angesehen werden, die zu Beeinträchtigungen im sozialen und beruflichen Leben führen.“
Tölle (1999, S. 112) stellt den persönlichen Leidenszustand in den Vordergrund:
„Von Persönlichkeitsstörung spricht man, wenn eine Persönlichkeitsstruktur durch starke Ausprägung bestimmter Merkmale so akzentuiert ist, dass sich hieraus ernsthafte Leidenszustände und/oder Konflikte ergeben. Die Abweichung vom gesunden Seelenleben besteht weniger in dem Merkmal an sich, als in dessen Prägnanz und Dominanz. Selbstunsicherheit ist zum Beispiel kaum einem Menschen ganz fremd, sie ist eine ubiquitäre psychische Erscheinung und in gewissem Masse dem Menschen hinderlich und störend bemerkbar. Man spricht dann von selbstunsicherer oder sens itiver Persönlichkeitsstörung.“
Eine Umfassende Definition liefern Dittmann und Stiegitz:
„Persönlichkeitsstörungen sind tief verwurzelte und lang anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren und unangepassten Reaktionen in verschiedenen persönlichen und sozialen Lebenssituationen zeigen. Bezug genommen wird dabei auf eine Durchschnittsnorm, die von der Mehrheit der betreffenden Bevölkerung oder kulturellen Gruppe gebildet wird. Die Abweichungen zeigen sich besonders im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in den Beziehungen zu anderen. Normabweichend ist dabei nicht so sehr die Qualität der einzelnen Merkmale des Verhaltens und Erlebens, sondern vielmehr ihre Akzentuierung, die Ausprägung und vor allem ihre
Dominanz, was sich sowohl in mangelnder sozialer Anpassung als auch in subjektiven Beschwerden ausdrückt (1996; zit. nach Freyberger, 1996, S. 218).“
2.1.3 Persönlichkeitsstörungen in der ICD-10 und im DSM-IV
Im DSM-IV sind die Persönlichkeitsstörungen als eigenständige Gruppe auf Achse II kodiert. Eine wesentliche Eigenschaft der zweiten Achse besteht darin, dass die auf ihr aufgeführten Störungen ihren Beginn in der Kindheit oder in der Adoleszenz haben. Weiter werden im DSM-IV die Persönlichkeitsstörungen auf drei Cluster aufgeteilt. In der ICD-10 werden die Persönlichkeitsstörungen unter F6, bei Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgeführt. In der vorliegenden Arbeit sollen in Anlehnung an DSM-IV nur die spezifischen Persönlichkeitsstörungen, respektive die kombinierten Formen und sonstigen Persönlichkeitsstörungen (F60- 61), in der ICD-10 erläutert werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
* Located elswhere in the classification
Abb. 2: Vergleich der Konzepte der Persönlichkeitsstörungen nach Loranger (1997).
Persönlichkeitsstörungen bleiben insgesamt unscharf definiert und sind laufend Bestandteil wissenschaftlicher Diskussionen. Loranger (1997, S.5) führt eine Tabelle an, welche die Unterschiede zwischen den Konzepten der Persönlichkeit sstörungen in der ICD-10 und im DSM-III-R sowie zwischen deren ursprünglichen Unterscheidung von Schneider auflistet (s. Abb. 2). Trotzdem lohnt es sich, wie es im Folgenden deutlich werden wird, der Vollständigkeit halber beide Diagnosesysteme in Betracht u ziehen. Denn die komplizierte Entwicklung der verschiedenen Typen der Persönlichkeitsstörungen manifestiert sich - wie vielleicht bei keiner anderen Diagnoseklasse - in den unterschiedlichen Diagnosekriterien, sowie in den unterschiedlich verwendeten Begriffen der ICD und DSM.
3 Typen von Persönlichkeitsstörungen
Allgemein müssen nach den ICD-10 (1999, S. 227) die unten aufgelisteten Grundkriterien für alle Typen von Persönlichkeitsstörungen erfüllt sein:
- Deutliche Unausgeglichenheit in den Einstellungen und im Verhalten in mehreren Funktionsbereichen, wie Affektivität, Antrieb, Impulskontrolle, Wahrnehmen und Denken, sowie in den Beziehungen zu anderen.
- Das auffällige Verhaltensmuster ist andauernd und gleichförmig und nicht auf Episoden psychischer Krankheiten begrenzt.
- Das auffällige Verhaltensmuster ist tiefgreifend und in vielen persönlichen und sozialen Situationen eindeutig unpassend.
- Die Störungen beginnen immer in der Kindheit oder Jugend und manifestieren sich auf Dauer im Erwachsenenalter.
- Die Störung führt zu deutlichem subjektiven Leiden, manchmal jedoch erst im späteren Verlauf.
- Die Störung ist meistens mit deutlichen Einschränkungen der beruflichen und sozialen Le istungsfähigkeit verbunden.
Mit den Grundkriterien müssen jeweils Zusatzkriterien bei den einzelnen Typen von Persönlichkeitsstörungen erfüllt sein, welche in der ICD-10 respektive im DSM-IV speziell aufgeführt werden.
Unter Cluster A werden im DSM-IV die Persönlichkeitsstörungen vom paranoiden, schizoiden sowie schizotypen Typ zusammengefasst. In Klammern steht jeweils die Codierung nach DSM-IV und ICD-10.
3.1 Paranoide Persönlichkeitsstörung (301.00, F60.0)
Trotz mangelhafter empirischer Befundlage hielt sich dieses Konzept von Anfang an sowohl in den ICD als auch in den DSM. In neueren Ausgaben der ICD und DSM sind weniger aktuelle empirische Erkenntnisse reflektiert worden, sondern eher Präzisierungen, welche Überlappungen mit anderen Störungen verhindern sollen (Fiedler, S. 157). Hauptmerkmale der paranoiden Persönlichkeitsstörung ist ein in verschiedenen Situationen auftretendes durchgängiges Misstrauen und eine Neigung, neutrale oder gar freundliche Handlungen anderer als feindselig oder kränkend zu interpretieren. Ursache für diese Fehlinterpretation ist die hohe Empfindsamkeit auf Kritik und Kränkung. Diesem Charakterzug verdankt die paranoide Persönlichkeitsstörung die Assoziation mit einer paranoiden Schizophrenie oder mit einer anderen paranoiden Störung. Auch die wiederholt verdächtigte Untreue des Partners gehört zu den Kriterien. In der ICD-10 (S. 228) werden des weiteren folgende Zusatzkriterien zur Diagnose aufgeführt:
- Tendenz zu stark überhöhtem Selbstwertgefühl, das sich in ständiger Selbstbezogenheit zeigt.
- Streitsüchtiges und beharrliches, situationsunangemessenes Bestehen auf eigene Rechte.
3.2 Schizoide Persönlichkeitsstörung (301.20, F60.1)
Die ersten Bemühungen um eine systematische Ausarbeitung einer „schizoiden Persönlichkeit“ Anfangs letzten Jahrhunderts sind eng mit der Erfassung und Erforschung der Schizophrenie verknüpft. Aufgrund von beobachteten Verhaltensauffälligkeiten in Familien mit schizophrenen Mitgliedern schlug Bleuler
(1922; s. Fiedler 1995, S. 167) ein Kontinuum vor, in dem sich die Grenzen zwischen schizoidem Charakter (für Familienangehörige eines Schizophrenen) und einer latenten Schizophrenie (Patient vor einem psychotischen Schub, respektive in einer Interphasenremission) nicht eindeutig festlegen liessen. Die schizoide Persönlichkeitsstörung wird schliesslich als ein tief greifendes Muster, das durch Distanziertheit in sozialen Beziehungen und durch eine eingeschränkte Bandbreite des Gefühlsausdrucks im zwischenmenschlichen Bereich gekennzeichnet ist, verstanden (DSM-IV).
In den Diagnosesystemen werden jeweils Listen aufgeführt, bei welchen mindestens drei (ICD-10) respektive vier (DSM-IV) Zusatzkriterien zur gerechtfertigten Diagnose erfüllt sein müssen.
3.3 Schizotypische Persönlichkeitsstörung (301.22, F21)
Der Begriff Schizotypie geht ursprünglich auf Rados (1953; s. Fiedler, 1995, S. 178)
„schizophrenen Genotyp“ zurück. Menschen mit diesem Genotyp müssen im späteren Leben nicht zwingend an einer klinisch bedeutsamen Schizophrenie erkranken, können jedoch stets eine Reihe psychodynamisch auffälliger Persönlichkeitsmerkmale zeigen. Ähnlich wie Bleuler bei der Schizoidie, stellte sich Rado ein Kontinuum der möglichen Störungsausprägung vor. Bereits Mitte der vierziger Jahre kam es zu einer parallel verlaufenden Entwicklung. Hoch und Polatin (1949; s. Fiedler, 1995, S. 179) begannen mit der Borderlineforschung. Nachdem lange Zeit überlappende Bereiche bestanden, grenzte sich die Borderlineforschung erst in den siebziger Jahren allmählich von den Forschungen zur Schizotypie ab. Etwa zur gleichen Zeit gelang Spitzer (1979; s. Fiedler, 1995, S. 181) die Abgrenzung der schizotypischen von der instabilen Persönlichkeitsstörung.
Aktuell wird die schizotype Störung aufgrund ihres „genetischen Spektrums“ an der Schizophrenie in der ICD-10 unter F2 aufgeführt. Im DSM-IV folgt die schizotyp ische der schizoiden Persönlichkeitsstörung und wird folgendermassen umschrieben:
Ein teifgreifendes Muster sozialer und zwischenmenschlicher Defizite, das durch akutes Unbehagen in mangelnde Fähigkeit zu engen Beziehungen gekennzeichnet ist. Weiterhin treten Verzerrungen der Wahrnehmung oder des Denkens, sowie eigentümliches Verhalten auf. Mindestens fünf der folgenden Zusatzkriterien müssen erfüllt sein:
- Beziehungsideen (jedoch keinen Beziehungswahn)
- Seltsame Überzeugungen oder magische Denkinhalte, die das Verhalten beeinflussen und nicht mit den Normen der jeweiligen subkulturellen Gruppe übereinstimmen
- Ungewöhnliche Wahrnehmungserfahrungen einschliesslich körperbezogene Illusionen
- Seltsame Denk- und Sprechweise
- Argwohn oder paranoide Vorstellungen
- Inadäquater oder eingeschränkter Affekt
- Verhalten oder äussere Erscheinung sind seltsam, exzentrisch oder merkwürdig
- Mangel an engen Freunden oder Vertrauten ausser Verwandten ersten Grades
- Ausgeprägte soziale Angst, die nicht mit zunehmender Vertrautheit abnimmt und die eher mit paranoiden Befürchtungen als mit negativer Selbstbeurteilung zusammenhängt
Besonders erwähnenswert ist, dass in der ICD-10 (1999, S. 113) die schizotype Störung nicht zur Diagnose empfohlen wird, da keine klaren Grenzen zur Schizophrenia Simplex (F20.6) und zu den schizoiden oder paranoiden Persönlich- keitsstörungen gezogen werden können. Differentialdiagnostisch lässt sich die
schizotypische Persönlichkeitsstörung nur schwierig vom Autismus und dem Asperger-Syndrom untersche iden.
Unter Cluster B werden im DSM-IV die Persönlichkeitsstörungen vom antisozialen, borderline, histrionischen und narzistischen Typ zusammengefasst.
3.4 Dissoziale Persönlichkeitsstörung (301.7, F60.2)
Das Problem der dissozialen Persönlichkeitsstörung liegt darin, dass sie in der Jurisprudenz zune hmend zur Klassifikation gewohnheitsmässiger Delinquenz und Kriminalität benutzt wird. Ursprünglich wurden aufgrund einer ähnlichen Fehlentwicklung die beiden Konzepte „psychopathische“ und „soziopathische“ Persönlichkeit nicht mehr in den Diagnosesystemen verwendet. Einer erneuten Verschiebung eines Diagnosebegriffs zu einer juristischen Kategorie muss standhaft entgegengehalten werden. Denn nicht alle Kriminellen sind antisoziale Persönlichkeiten. Dem hat beispielsweise Moffitt (1993) mit seiner Unterscheidung zwischen einer pubertätsgebundenen und einer überdauernden, eher pathologischen Form antisozialer Tendenzen Rechnung getragen (s. Abb. 3). (Anmerkung: Noch im DSM III-R werden kriminelle Aspekte und antisoziale Persönlichkeit auf einer Kriterienliste vermischt aufgelistet! Im DSM-IV ve rschwanden die vorwiegend kriminellen Aspekte schliesslich aufgrund heftiger Krit ik.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Moffitt unterscheidet zwischen der pubertätsgebundenen und der überdauernden Form antisozialer Tendenzen (Moffitt 1993, S. 677).
Die Dissoziale Persönlichkeitstörung wird im ICD-10 (1999, S. 229) wie folgt beschrieben:
Die Persönlichkeitsstörung fällt durch eine grosse Diskrepanz zwischen dem Verhalten und den geltenden sozialen Normen auf und ist charakterisiert durch mindestens drei der folgenden Zusatzkriterien:
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Arbeit über Persönlichkeitsstörungen?
Diese Arbeit soll im Rahmen einer Hausarbeit einen Beitrag leisten, die Scheu vor Persönlichkeitsstörungen bei Therapeuten einzudämmen, indem sie Informationen und Aufklärung über den neuesten Stand der Forschung bietet.
Wie werden Persönlichkeitsstörungen definiert?
Persönlichkeitsstörungen werden durch unflexible, fehlangepasste Persönlichkeitszüge definiert, die zu Beeinträchtigungen im sozialen und beruflichen Leben führen. Sie beinhalten oft Leidenszustände oder Konflikte und zeigen sich in starren, unangepassten Reaktionen in verschiedenen Lebenssituationen.
Welche Diagnosemanuale werden zur Klassifizierung von Persönlichkeitsstörungen verwendet?
Die ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) und das DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) werden zur Klassifizierung von Persönlichkeitsstörungen verwendet.
Was sind die allgemeinen Kriterien für Persönlichkeitsstörungen nach ICD-10?
Nach ICD-10 müssen für alle Typen von Persönlichkeitsstörungen folgende Grundkriterien erfüllt sein: Deutliche Unausgeglichenheit, andauerndes Verhaltensmuster, tiefgreifende Verhaltensmuster, Beginn in der Kindheit oder Jugend, subjektives Leiden und Einschränkungen der Leistungsfähigkeit.
Welche Cluster von Persönlichkeitsstörungen gibt es im DSM-IV?
Im DSM-IV werden die Persönlichkeitsstörungen in drei Cluster aufgeteilt: Cluster A (paranoid, schizoid, schizotyp), Cluster B (dissozial, Borderline, histrionisch, narzisstisch) und Cluster C (ängstlich-vermeidend, dependent, zwanghaft).
Was ist die paranoide Persönlichkeitsstörung?
Die paranoide Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch Misstrauen und die Neigung, neutrale oder freundliche Handlungen anderer als feindselig oder kränkend zu interpretieren. Ursache ist oft eine hohe Empfindsamkeit auf Kritik und Kränkung.
Was ist die schizoide Persönlichkeitsstörung?
Die schizoide Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch Distanziertheit in sozialen Beziehungen und eine eingeschränkte Bandbreite des Gefühlsausdrucks im zwischenmenschlichen Bereich.
Was ist die schizotypische Persönlichkeitsstörung?
Die schizotypische Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch soziale und zwischenmenschliche Defizite, akutes Unbehagen in engen Beziehungen, Verzerrungen der Wahrnehmung oder des Denkens und eigentümliches Verhalten. Sie wird in der ICD-10 nicht zur Diagnose empfohlen, da keine klaren Grenzen zur Schizophrenie gezogen werden können.
Was ist die dissoziale Persönlichkeitsstörung?
Die dissoziale Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch eine grosse Diskrepanz zwischen dem Verhalten und den geltenden sozialen Normen, Herzlosigkeit, Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer und Missachtung sozialer Verpflichtungen.
Welche Therapieansätze werden für Persönlichkeitsstörungen erwähnt?
Es werden verschiedene Therapieansätze erwähnt, darunter psychoanalytische Ansätze, interpersonelle Therapie, kognitive Therapie nach Beck und die dialektisch behaviorale Therapie von Linehan.
- Quote paper
- Mike Schaub (Author), 2001, Persönlichkeitsstörungen: Begriff, Typen und Therapien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106097