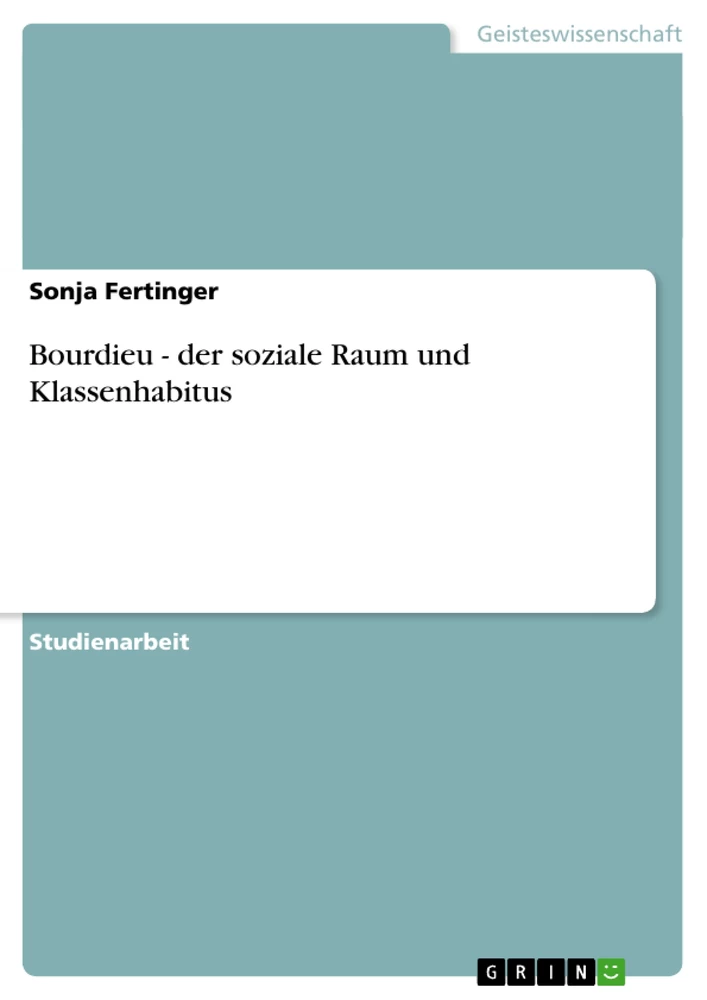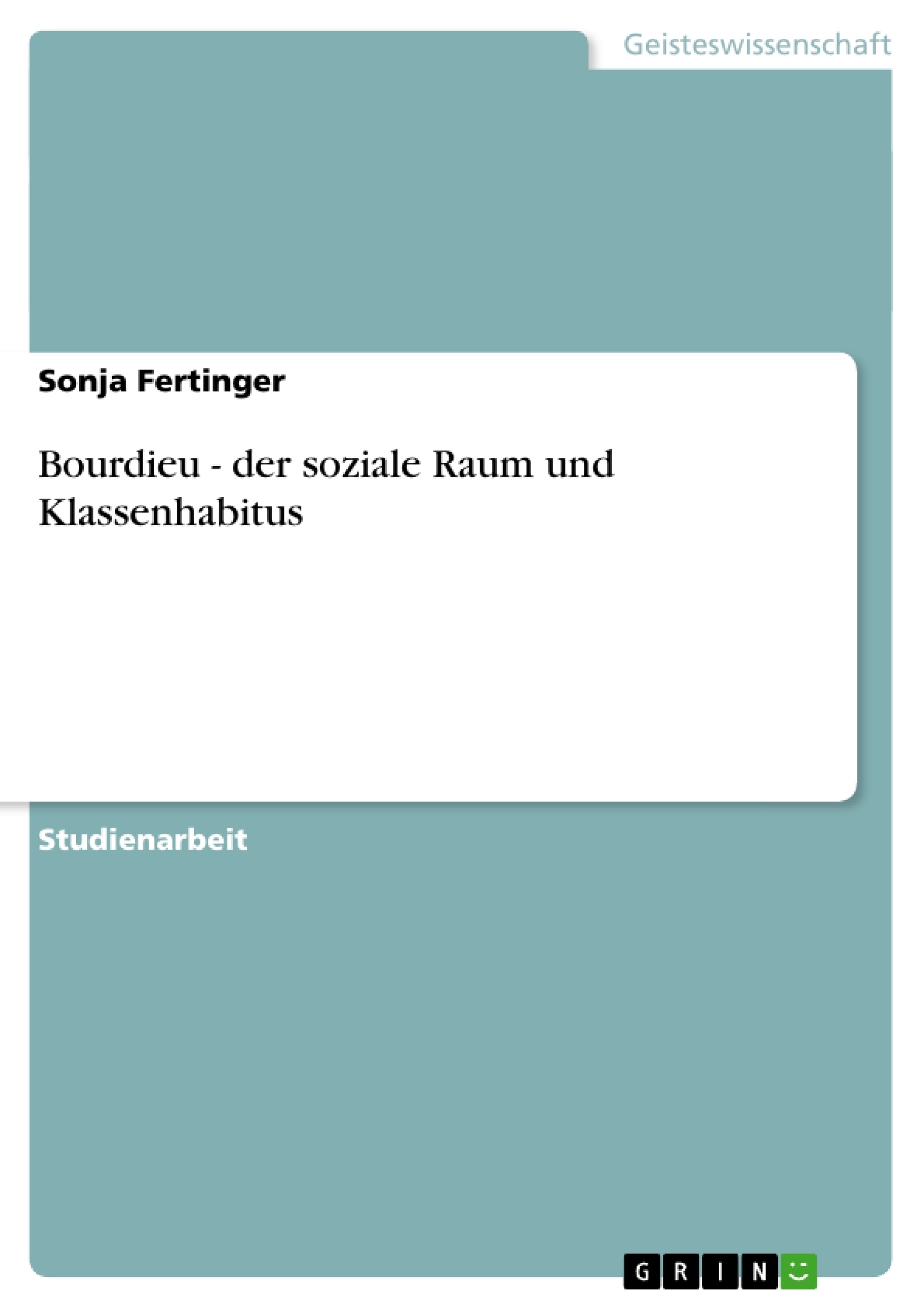Was uns prägt, was uns unterscheidet, und warum unser Handeln oft unbewussten Regeln folgt – diese Fragen stehen im Zentrum dieser tiefgründigen Analyse von Pierre Bourdieus zentralem Konzept des Habitus. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der soziale Räume, Klassenstrukturen und ungeschriebene Gesetze unser Denken und Verhalten formen. Diese Arbeit seziert Bourdieus Theorie, beginnend mit der fundamentalen Idee des sozialen Raums, einem komplexen Gefüge objektiver Bedingungen, die unser Umfeld definieren und unsere Wertvorstellungen prägen. Entdecken Sie, wie Bourdieu den Klassenbegriff neu interpretiert, jenseits traditioneller marxistischer Vorstellungen, und die Unterscheidung zwischen der mobilisierten Klasse, einer temporären Allianz im Kampf gegen Missstände, und der objektiven Klasse, die nach dem Erhalt ihrer inhärenten Identität strebt, beleuchtet. Im Kern steht die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Habitus, dem „Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis“, der als Bindeglied zwischen sozialem Raum und individueller Handlung fungiert. Erfahren Sie, wie der Habitus als internalisiertes Dispositionschema unser Wahrnehmen, Denken und Handeln beeinflusst, oft unbewusst, und so soziale Reproduktion ermöglicht. Diese Analyse zeigt, wie der Klassenhabitus, der nicht individuell, sondern gruppen- oder klassenspezifisch ist, als Instrument zur Reproduktion sozialer Macht dient und Abgrenzungsversuche gegenüber anderen Klassen manifestiert. Abschließend wird die Frage beleuchtet, inwiefern der Habitus veränderbar ist und welche Rolle die Sozialisation spielt. Diese Arbeit bietet nicht nur eine umfassende Einführung in Bourdieus Werk, sondern regt auch dazu an, die eigenen sozialen Prägungen und unbewussten Verhaltensmuster kritisch zu hinterfragen, um so ein tieferes Verständnis der Gesellschaft und unserer Rolle darin zu entwickeln. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Soziologie, Sozialtheorie und die verborgenen Mechanismen sozialer Ungleichheit interessieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der soziale Raum
3. Klassenbegriff
3.1 Die mobilisierte Klasse
3.2 Die objektive Klasse
4. Der Habitus
5. Der Klassenhabitus
6. Literaturnachweis
1. Einleitung
Diese Hausarbeit ist Teil eines „Gesamtkunstwerkes“, das den Begriff des „Habitus“ darstellen soll. Der Begriff des Habitus wurde von Pierre Bourdieu eingeführt. Da dieses Thema von insgesamt sechs Leuten bearbeitet wurde, wird in dieser Ausarbeitung der Teil des von mir bereits gehaltenen Referats genauer betrachtet und dargestellt.
Um den Habitus definieren und erklären zu können bedarf es zuerst der Klärung einiger Begrifflichkeiten. Aus diesem Grund werde ich zuerst einen Einblick in Bourdieu´s Vorstellung des „Sozialen Raumes“, und der verschiedenen „Klassen“ bieten. Anschließend werde ich den Habitus selbst vorstellen. Einen tieferen Einblick in den Habitus bieten die anschließenden Hausarbeiten. Um diesen nichts vorwegzunehmen oder zu widersprechen, werde ich es bei diesen drei Punkten belassen.
2. Der soziale Raum
Unter dem sozialen Raum versteht Bourdieu alle erfassbaren objektiven Bedingungen des Umfelds, die ein Individuum betreffen1. Daran gebunden sind objektiv erfassbare Wertvorstellungen, die jedes Individuum für sich selbst seit Beginn seiner Wahrnehmung erfährt. Der soziale Raum stellt das prägende Umfeld eines jeden heranwachsenden Individuums dar und übt somit einen „konditionierenden“ und prägenden Effekt2 auf dieses aus.
Bourdieu versteht den sozialen Raum als abstraktes Konstrukt, von dem aus Akteure in ihrem Alltagsleben ihren Blick auf die Welt werfen. Akteure haben im sozialen Raum eine gewisse Position inne und nehmen von diesen aus gegenüber dem Umfeld Standpunkte ein, die durch die Position bestimmt werden. Die persönliche soziale Lage in diesem Raum wird durch innere Eigenschaften bestimmt.
Der soziale Raum kann weiters durch Begriffe wie soziale Lage, Klasse oder das zugehörige Milieu spezifiziert werden, deren besondere Bedingungen in Verhalten und Urteilsvermögen des Individuums wiedererkennbar sind. Jeder Mensch steht seit vor der Geburt im Einfluss seines Umfeldes. Jeder Akteur dieses Umfeldes präsentiert sich in seiner besonderen Eigenart, die dem Gesamtumfeld zueignen ist. Die ist erkennbar in z.B. Lauten, Melodien, emotionales Engagement oder Bewegungen.
3. Klassenbegriff
Bourdieu teilt den sozialen Raum in verschiedene Milieus und Klassen. Da er sich selbst als Marxist sieht, ist die Erklärung seines Klassenbegriffs am weitest gehendsten, weswegen auch hier ausschließlich auf den Klassenbegriff eingegangen wird.
Bourdieu unterscheidet zwei verschiedene Formen von Klassen: die objektive und die mobilisierte Klasse.
„Die objektive Klasse und mobilisierte Klasse dürfen nicht verwechselt werden. Bei letzterer handelt es sich um das Ensemble von Akteuren, die auf der Grundlage homogener vergegenständlichter oder inkorporierter Eigenschaften und Merkmale sich zusammengefunden haben zum Kampf um Bewahrung oder Änderung der Verteilungsstruktur der vergegenständlichten Eigenschaften“3.
3.1 Die mobilisierte Klasse
Dies bedeutet in Bourdieu´schem Sinne, dass die mobilisierte Klasse eine letztlich zeitlich begrenzte Erscheinung darstellt. Im Sinne einer Kampfhandlung gegenüber einer als Missstand empfundenen Situation definieren Akteure ihre Klasse, oder bekommen diese von außen definiert. Es finden sich Menschen zusammen, die gemeinschaftlich gegen diesen Missstand ankämpfen möchten. Einen weiteren Zusammenhang dieser Akteure wie private oder berufliche Haltung, Position oder Lebensweisen müssen die Klassenmitglieder nicht aufweisen. Der Erhalt der Klasse dient ausschließlich dem Zweck der Bekämpfung eines Missstandes4 5.
3.2 Die objektive Klasse
Im Gegensatz zur mobilisierten Klasse strebt die objektive Klasse nach dem Erhalt der eigenen inhärenten Identität. Die Struktur dieser Klasse ist komplexer; sie zieht weitere Faktoren mit ein wie es z.B. ein vollständiges Existieren in einer gewissen gesellschaftlichen Position, inkl. Beruf, Religion, Erziehung und ähnliches ermöglichen6 7.
4. Der Habitus
Der Habitus stellt sozusagen das Bindeglied zwischen dem sozialen Raum und den Klassen dar. Bourdieu definiert diesen als das „Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssystem dieser Formen“8. Das gemeinsame prägende Element aller Individuen, die einem sozialen Raum angehören, ist der Habitus.
Die Habitustheorie geht davon aus, dass jede Person gesellschaftlich geprägt ist. Diese Prägung betrifft die Wahrnehmung, das Denken und die Handlungen, die nach diesem Sinne schematisiert sind. Dies wird das Dispositionschema9 genannt. Die Schemata geben den Akteuren einen sozialen Sinn, der als Ordnungssinn zu verstehen ist. Dieser hilft, sich im sozialen Raum und in den einzelnen Feldern darin zurechtzufinden.
Der Habitus erzeugt somit Formen des Verhaltens und der Wertung. Diese Formen entstehen durch den Einfluss des sozialen Raumes. Der Habitus jedes Individuums wird einerseits durch den sozialen Raum strukturiert, andererseits strukturiert dieser anhand jener Strukturierung Systeme der Erzeugung von Verhalten und Bewertung. Er ist also strukturierende und strukturieret Struktur zugleich10.
Der soziale Raum überträgt seine Formen von Praxis und Bewertungsschemata auf das Individuum. Obwohl dieses sich seines Habitus nicht bewusst ist, betrachtet das Individuum sein Verhalten als bewusst gewählt - dies nennt Bourdieu den Kooptationseffekt11. Das Individuum bringt sich selbst - als Vertreter seines Habitus - in seinen sozialen Raum ein; sodass jener Habitus erhalten bleibt. Somit produziert der Habitus den Habitus.
So werden durch den Habitus, der die gesellschaftlichen Strukturen verinnerlicht und in Denk- und Erwartungs- und Handlungsstrukturen transformiert hat, die Grenzen der Praktiken festgelegt, während innerhalb der Grenzen ein Spielraum für Variationen bereitgestellt wird. Dadurch wird der Habitus ein wertvolles Instrument, um soziale Reproduktion zu erklären12.
Der Habitus wird durch Sozialisation vermittelt, das heißt, er ist stark abhängig von der sozialen Position und der Lebenslage der Familien. Durch die Verinnerlichung des Habitus wird dieser zu etwas Unbeachtetem und Selbstverständlichem, dem keine weitere Bedeutung zugemessen wird.
Weiters ist zu bemerken, dass der Habitus zwar jedem Individuum inhärent ist, er aber nicht individuell ist. Anstatt dem Individuum eine „persönliche Note“ zu verleihen, betrifft der Habitus eher den Grundrahmen, durch den alle zugehören Mitglieder eines sozialen Raumes erkennbar sind. Laut Bourdieu ist der Habitus nicht unmittelbar erkennbar, er ist eher ein Teil des Unbewussten - ein Teil seines Charakters. Das Erkennen einer Zugehörigkeit erfolgt also nicht durch das Erleben von einzelnen Personen oder sich selbst, sondern anhand einer Abgrenzung zu Personen, die aus anderen sozialen Räumen - z.b. anderen Klassen - stammen13.
Bourdieu stellte dadurch fest, dass eine große Übereinstimmung in Verhalten und Geschmack innerhalb gleicher kultureller und ökonomischer Verhältnissee vorherrscht. Dies entsteht durch einen starken, nicht von individueller Persönlichkeit überarbeiteten gesellschaftlichen Einfluss - inkorporiert als Habitus14.
Im Unterschied zu gängigen Sozialisationstheorien, in denen besagt wird, ein Individuum kann dadurch, dass es ständiger Sozialisation unterliegt, in seinem Verhalten beeinflusst werden und sich dadurch grundlegend ändern, geht Bourdieu davon aus, dass ein Habitus einem Menschen von Anfang an zugrundeliegt. Das heißt, der Mensch ist durchaus fähig, sich weitere Verhaltensmuster, die in seinem bisherigen sozialen Raum als unüblich galten, anzueignen. Dennoch kann ein Mensch sich aufgrund seines Habitus nicht grundlegend ändern15. Der Akteur ist mit diesem zu verwachsen. Ein Beispiel dafür wäre das verschwenderische Verhalten Neureicher. Akteure können neue Verhaltensformen dazulernen, aber Praxisformen, die durch den Habitus verinnerlicht wurden, sind kaum ablegbar.
5. Der Klassenhabitus
Wie an den Elementen des Habitus verdeutlicht wurde, ist ein gewisser Habitus nicht einem einzelnen Individuum zugeschrieben, sondern einer ganzen Gruppe von Akteuren, wie z.B. Klassen oder auch Familien. Das Dispositionsschema ist im wesentlichen von der Position im sozialen Raum abhängig. Da die Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungsschemata von der Sozialstruktur und der sozialen Positionierung der Familie festgelegt werden, ist klar, dass z.B. ein Kleinbürger unterschiedliche Dispositionsstrukturen verinnerlicht hat, als ein Arbeiter oder Bauer16. Demzufolge kann der Habitus auch auf Gruppen oder Klassen angewandt werden, die eine ähnliche Position im sozialen Raum besetzen17. Diese können aufgrund dessen auf ähnliche Erfahrungen zurückgreifen, haben ähnliche Dispositionsschemata und ergo einen ähnlichen Habitus18.
Der Habitus kann weiters als Instrument für die Reproduktion sozialer Macht auch für gesamte Klassen betrachtet werden. Da sich der Habitus auch als Abgrenzungsmittel gegenüber anderen - vor allem „niedrigeren“ Klassen gegenüber definiert, können persönliche Abgrenzungsversuche anderen Akteuren gegenüber auch als Teil des klassenspezifischen habituellen Verhaltens gewertet werden19.
6. Literaturnachweis
- Bourdieu, Pierre; Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft; Frankfurt/Main 1982, Kap. 2, 3 S.171-354
- Käsler, Dirk; Klassiker der Soziologie. Kap. Pierre Bourdieu S. 257-266
- Kimmerle, Stephan; Neomarxismus. Der Klassenbegriff in neuen Ansätzen, Berlin 2000, S. 78-81, 105-117
- Schwingel, Markus; Bourdieu zur Einführung, Hamburg 1995, S. 56- 81, 99-120
[...]
1 Bourdieu, Pierre; Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft; Frankfurt/Main 1982, S. 171-276
2 Bourdieu, Pierre; Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft; Frankfurt/Main 1982, S. 171-276
3 Bourdieu, Pierre; Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft; Frankfurt/Main 1982, S.175
4 Käsler, Dirk; Klassiker der Soziologie. Kap. Pierre Bourdieu S. 257-266
5 Kimmerle, Stephan; Neomarxismus. Der Klassenbegriff in neuen Ansätzen, Berlin 2000, S. 78-81
6 Käsler, Dirk; Klassiker der Soziologie. Kap. Pierre Bourdieu S. 257-266
7 Kimmerle, Stephan; Neomarxismus. Der Klassenbegriff in neuen Ansätzen, Berlin 2000, S. 78-81
8 Bourdieu, Pierre; Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft; Frankfurt/Main 1982, S.277
9 Schwingel, Markus; Bourdieu zur Einführung, Hamburg 1995, S. 56-81
10 Schwingel, Markus; Bourdieu zur Einführung, Hamburg 1995, S. 56-81
11 Bourdieu, Pierre; Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft; Frankfurt/Main 1982, S. 277-354
12 Kimmerle, Stephan; Neomarxismus. Der Klassenbegriff in neuen Ansätzen, Berlin 2000, S. 78-81
13 Schwingel, Markus; Bourdieu zur Einführung, Hamburg 1995, S. 56-81
14 Schwingel, Markus; Bourdieu zur Einführung, Hamburg 1995, S. 56-81
15 Schwingel, Markus; Bourdieu zur Einführung, Hamburg 1995, S. 56-81
16 Bourdieu, Pierre; Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft; Frankfurt/Main 1982, S. 277-354
17 Kimmerle, Stephan; Neomarxismus. Der Klassenbegriff in neuen Ansätzen, Berlin 2000, S. 78-81
18 Schwingel, Markus; Bourdieu zur Einführung, Hamburg 1995, S. 56-81
Häufig gestellte Fragen
Was ist der soziale Raum nach Bourdieu?
Der soziale Raum umfasst alle objektiven Bedingungen des Umfelds, die ein Individuum betreffen. Er prägt das Individuum durch Wertvorstellungen und wirkt "konditionierend". Bourdieu sieht ihn als abstraktes Konstrukt, von dem aus Akteure ihren Blick auf die Welt richten. Die soziale Lage wird durch innere Eigenschaften bestimmt.
Wie unterscheidet Bourdieu Klassen?
Bourdieu unterscheidet zwischen objektiver und mobilisierter Klasse. Die mobilisierte Klasse ist eine zeitlich begrenzte Erscheinung, die im Kampf gegen Missstände entsteht. Die objektive Klasse strebt nach dem Erhalt ihrer Identität und umfasst Faktoren wie Beruf, Religion und Erziehung.
Was ist der Habitus?
Der Habitus ist das "Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssystem dieser Formen". Er ist das gemeinsame prägende Element aller Individuen eines sozialen Raumes. Er prägt Wahrnehmung, Denken und Handlungen und gibt Akteuren einen sozialen Sinn.
Wie wirkt der Habitus?
Der Habitus erzeugt Formen des Verhaltens und der Wertung durch den Einfluss des sozialen Raumes. Er strukturiert Systeme der Erzeugung von Verhalten und Bewertung. Das Individuum betrachtet sein Verhalten als bewusst gewählt (Kooptationseffekt), obwohl es durch den Habitus geprägt ist.
Wie wird der Habitus vermittelt?
Der Habitus wird durch Sozialisation vermittelt und ist stark abhängig von der sozialen Position und der Lebenslage der Familien. Durch die Verinnerlichung wird er selbstverständlich und unbeachtet.
Ist der Habitus individuell?
Der Habitus ist nicht individuell, sondern betrifft den Grundrahmen, durch den Mitglieder eines sozialen Raumes erkennbar sind. Er ist Teil des Unbewussten und wird durch Abgrenzung zu anderen sozialen Räumen erkannt.
Kann sich der Habitus ändern?
Bourdieu geht davon aus, dass ein Habitus einem Menschen von Anfang an zugrundeliegt und sich nicht grundlegend ändern kann. Zwar können neue Verhaltensmuster erlernt werden, aber die verinnerlichten Praxisformen sind kaum ablegbar.
Was ist der Klassenhabitus?
Der Klassenhabitus bezieht sich auf den Habitus einer ganzen Gruppe von Akteuren, wie z.B. Klassen oder Familien. Das Dispositionsschema ist von der Position im sozialen Raum abhängig. Der Habitus kann als Instrument für die Reproduktion sozialer Macht betrachtet werden.
Welche Literatur wird zitiert?
Die Hausarbeit zitiert:
- Bourdieu, Pierre; Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft; Frankfurt/Main 1982
- Käsler, Dirk; Klassiker der Soziologie. Kap. Pierre Bourdieu
- Kimmerle, Stephan; Neomarxismus. Der Klassenbegriff in neuen Ansätzen, Berlin 2000
- Schwingel, Markus; Bourdieu zur Einführung, Hamburg 1995
- Quote paper
- Sonja Fertinger (Author), 2002, Bourdieu - der soziale Raum und Klassenhabitus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106087