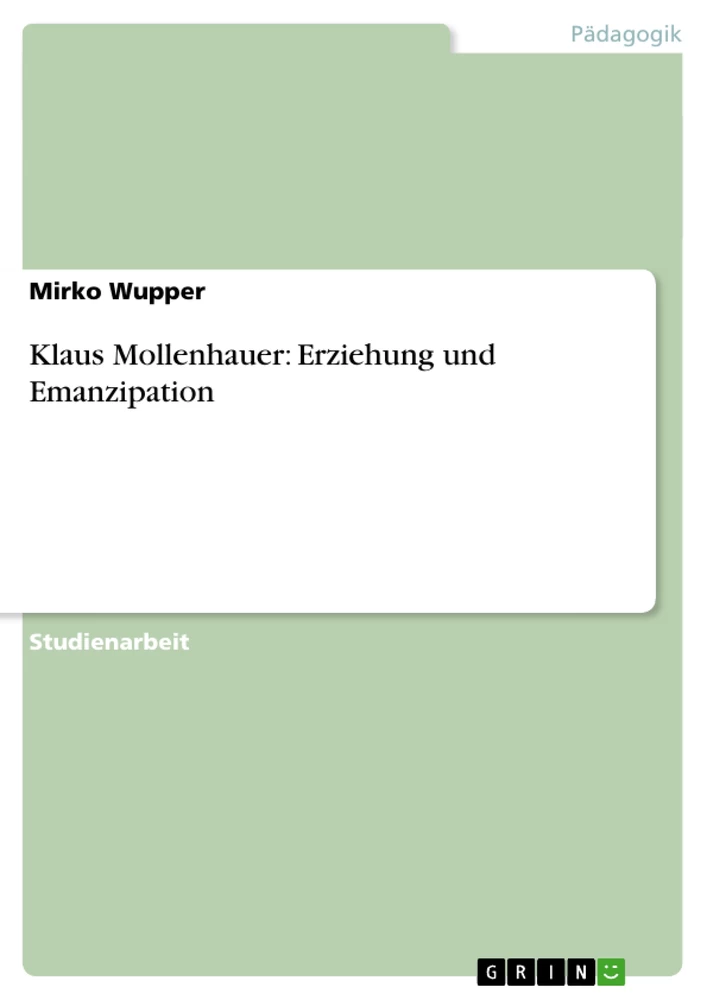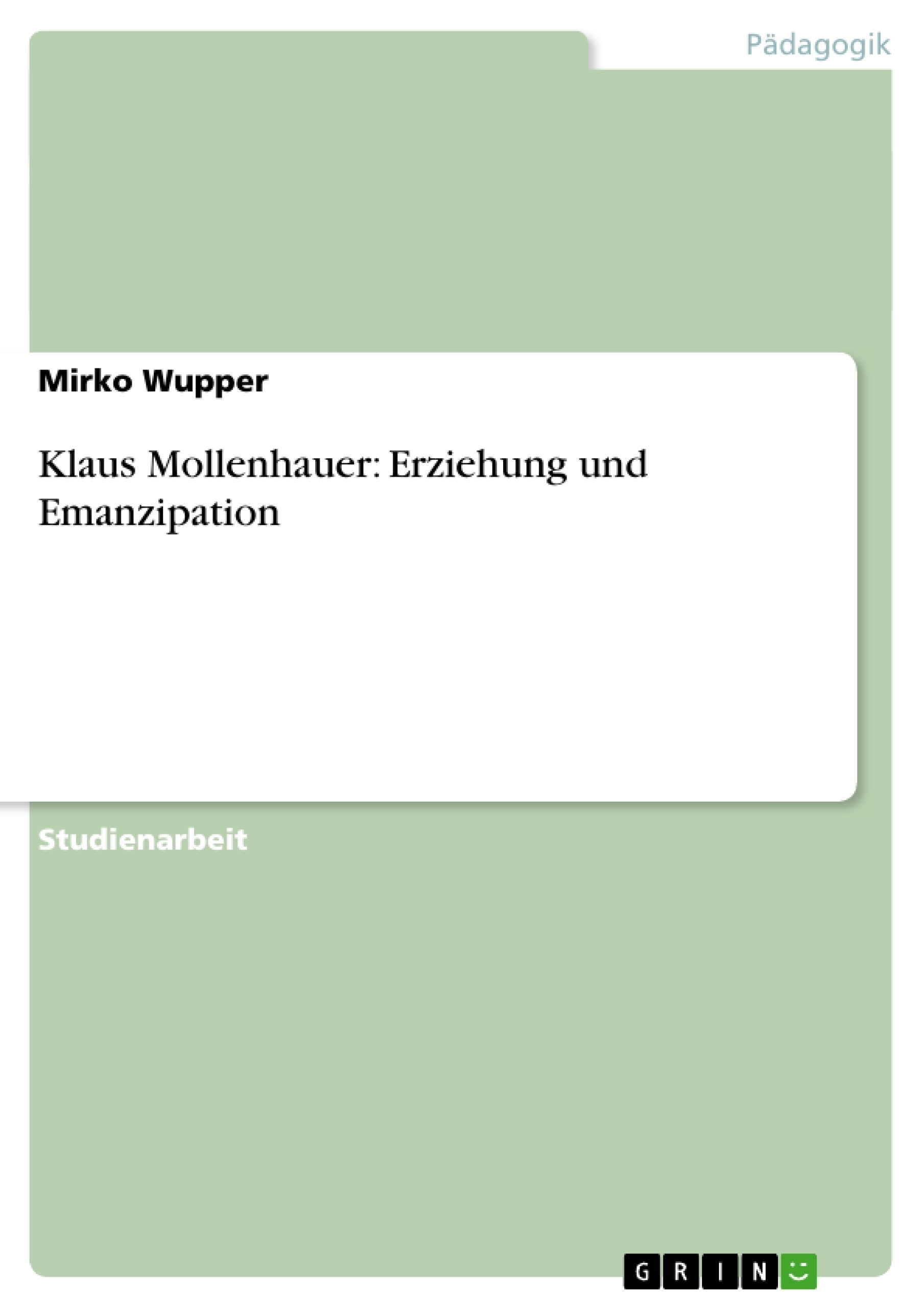Was bedeutet es, frei zu sein – wirklich frei? In einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, in der die Fundamente der traditionellen Erziehung ins Wanken gerieten, wagte Klaus Mollenhauer mit seinem Werk „Erziehung und Emanzipation“ einen provokativen Neuanfang. Dieses Buch ist weit mehr als eine pädagogische Abhandlung; es ist eine Streitschrift für die Selbstbestimmung des Individuums, ein Aufruf zur kritischen Auseinandersetzung mit den unsichtbaren Fesseln, die unsere Rationalität und unser Handeln im sozialen Gefüge einschränken. Mollenhauer analysiert messerscharf die Dichotomie zwischen geisteswissenschaftlicher und empirisch-analytischer Pädagogik und plädiert für eine Synthese, die den Menschen in seiner Gesamtheit erfasst. Er zeigt auf, wie sowohl normative als auch erfahrungswissenschaftliche Ansätze zur Emanzipation beitragen können, wenn sie sich nicht in ihren eigenen Methoden verfangen. Dabei scheut er sich nicht, die blinden Flecken beider Lager aufzuzeigen und eine Erziehungswissenschaft zu fordern, die sich ihrer erkenntnisleitenden Interessen bewusst ist. Das Buch entfaltet seine Brisanz im Kontext der Bildungsreform der 1970er Jahre, einer Zeit, in der emanzipatorische Ideen dieCurricula und Schulstrukturen tiefgreifend veränderten. Doch Mollenhauers Ansatz blieb nicht unwidersprochen. Kritiker warfen ihm vor, den Begriff der Rationalität zu instrumentalisieren und eine allzu negative Sicht auf traditionelle Erziehungsmethoden zu vertreten. Dennoch bleibt sein Werk ein Meilenstein der Pädagogik, der bis heute zum Nachdenken über die Ziele und Methoden von Bildung anregt. Es ist eine Einladung an alle, die sich für die Frage interessieren, wie Erziehung zur Entfaltung mündiger und selbstbestimmter Persönlichkeiten beitragen kann, die in der Lage sind, die Welt kritisch zu hinterfragen und aktiv mitzugestalten. "Erziehung und Emanzipation" ist somit ein zeitloses Plädoyer für eine Pädagogik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und ihn befähigt, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Entdecken Sie die bahnbrechenden Ideen Mollenhauers und tauchen Sie ein in eine Debatte, die aktueller ist denn je.
1. Einleitung
Mollenhauers Buch „Erziehung und Emanzipation“ hat die pädagogische Diskussion in den späten sechziger- und frühen siebziger Jahren maßgeblich geprägt. Es passte in eine Zeit, in der mit tradierten Konventionen gebrochen wurde und sich weitreichende politische und soziale Veränderungen im Gesellschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland vollzogen.
In dieser Ausarbeitung werde ich zunächst versuchen, den Begriff „Emanzipation“ näher zu fassen, um mich dann mit dem Vorwort von „Erziehung und Emanzipation“ zu beschäftigen. Das Vorwort ist wohl der bedeutendste Teil des Buches, da in der Sekundärliteratur fast ausschließlich auf diese einleitenden Zeilen Bezug genommen wird. Darauf aufbauend werde ich mich unter Punkt ... mit der Bildungsreform in der Bundesrepublik befassen und untersuchen, inwieweit emanzipatorische Gedanken in die neuen bildungspolitischen Ziele mit aufgenommen und dann auch im Schulsystem verwirklicht wurden. An einigen ausgewählten Beispielen soll unter Punkt... dargestellt werden, wie kontrovers Emanzipation als Erziehungsideal diskutiert wurde. Diese Ausarbeitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vor allem kritische Stimmen zur emanzipatorischen Pädagogik kommen nur kurz zu Wort, da der Umfang der Ausarbeitung für eine differenziertere Betrachtung nicht ausreicht. Vielmehr soll deshalb auf die Bedeutung Mollenhauers für die damalige pädagogische Diskussion aufmerksam gemacht werden, die in ihren Auswirkungen auch heute noch spürbar ist.
2. Der Begriff „Emanzipation“
Der Begriff „Emanzipation“ ist ein weitreichender und in unseren Breitengraden sehr gebräuchlicher Begriff. Er lässt sich in den verschiedensten geisteswissenschaftlichen Richtungen ausmachen, in der Soziologie, der Religion, der Geschichte und nicht zuletzt in der Pädagogik. Daher gibt es auch eine Vielzahl von Definitionen, die den Begriff der Emanzipation zu fassen versuchen und zum Teil von der jeweiligen geisteswissenschaftlichen Richtung, der sich der Wissenschaftler zugehörig fühlt, abhängig sind. In einer stark individualisierten Gesellschaft, in der die Gleichberechtigung aller Menschen von so fundamentaler Bedeutung ist wie in unserer, verwundert es nicht, dass „Emanzipation“ als Begrifflichkeit schnell geradezu inflationär verwendet wird. Um dem entgegenzuwirken macht es Sinn, sich zunächst einmal dem Grundsinn von Emanzipation zu nähern und den Begriff dann erst auf seine Bedeutung für die Pädagogik hin zu untersuchen.
2.1. Definitionen
„Emanzipation“ kommt aus dem lateinischen und bedeutet soviel wie „Freilassung“, soll heißen die „Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit; Verselbstständigung.“1
„Der Grundsinn von Emanzipation ist Freilassung in dem Sinne, dass eine bestimmte Gruppe innerhalb einer Rechtsgemeinschaft die Grundrechte aller Mitglieder der Rechtsgemeinschaft erhält (Gleichberechtigung).“2
2.2. Die geschichtliche Entwicklung des Begriffs der „Emanzipation“
Der Begriff tauchte zum ersten mal im römischen Reich (E- mancipatio) auf und bedeutete „im römischen Recht die Freilassung des Sohnes durch den Vater oder des Knechtes durch den Herrn.“3 Die heutige Bedeutung von Emanzipation fußt auf den Überlegungen Hegels, der die Menschheitsgeschichte als eine Freiheitsgeschichte verstand. Die Menschen einer neuen geschichtlichen Epoche sind nach Hegel grundsätzlich bestrebt, die Zwänge der davor liegenden Epoche zu überwinden. Der Ausgangspunkt des menschlichen Daseins ist also die Entfremdung und die Geschichte ist die sukzessiv vollzogene Überwindung der Entfremdung.
In dieser Tradition stehen F. Feuerbach, der sich für eine religiöse Emanzipation einsetzte, sowie B. Bauer, K. Marx und F. Engels, die eine politische und menschliche Emanzipation anstrebten.4
2.3. Emanzipation in der Pädagogik
In der Erziehungswissenschaft wurde der Begriff der Emanzipation erst in den 60er Jahren aufgegriffen. J. Habermas leistete hier Vorschub durch seine Theorie, „wonach die Wissenschaften in quasi- transzendentalen Interessen konstituiert seien5 “, also auf ein höheres Gesamtziel ausgerichtet sind. Für die Pädagogik wurde daraufhin gefordert, dass sie „sich vom Interesse an Emanzipation leiten zu lassen6 “ habe.
3. Mollenhauers „Erziehung und Emanzipation“
„Die Jahre nach dem zweiten Weltkrieg haben gezeigt, dass die „geisteswissenschaftliche Pädagogik“ nur begrenzt leistungsfähig ist im Hinblick auf die Aufklärung derjenigen Zusammenhänge, die die Wirklichkeit der Erziehung ausmachen.“7 Aus dieser Kritik heraus entwickelte sich in den sechziger und siebziger Jahren die empirisch- analytische Erziehungswissenschaft, deren bedeutendster Vertreter W. Brezinka ist. Versuchte die geisteswissenschaftliche Pädagogik, sich durch hermeneutische Verfahren dem Gegenstand des Pädagogischen zu nähern, so setzte die erfahrungswissenschaftliche Pädagogik analytisch- empirische Verfahren dagegen. Mollenhauer sieht in dieser neuen Entwicklung die Gefahr der Verkürzung von Erziehungswissenschaft und befürchtet, dass eine Wissenschaftskonzeption entsteht, „nach der Wert- und Zwecksetzungen nur noch beschrieben, aber nicht mehr wissenschaftlich diskutiert werden können.“8 Das erkenntnisleitende Interesse der Erziehungswissenschaft ist aber das Interesse an Emanzipation, wobei Emanzipation „die Befreiung der Subjekte... aus Bedingungen, die ihre Rationalität und das damit verbundene gesellschaftlich Handeln beschränken9 “, meint. Also muss das oberste Ziel von Erziehung und Bildung sein, dem entgegenzuwirken, was den Menschen in seiner freien Entfaltung einschränkt und ihn verdinglicht.
Die Emanzipation des Menschen ist nach Mollenhauer nur dann möglich, wenn beide erziehungswissenschaftlichen Richtungen ihren Beitrag zur Befreiung des Individuums aus Selbstentfremdung und Verdinglichung leisten. Die Aufgabe der empirisch- analytischen Pädagogik ist es, Informationen zu Verfügung zu stellen, auf deren Basis die hermeneutische Pädagogik durch Deutung und Auslegung dieser Erkenntnisse pädagogische Prozesse steuern kann.
Diese Forderung erscheint in ihrer Umsetzung höchst kompliziert wenn man bedenkt, dass sich die erfahrungswissenschaftliche Pädagogik aus der Kritik an der normativ- emotionalen Erziehungswissenschaft heraus konstituiert hat und die beiden Modelle daher weit voneinander entfernt sind. Mollenhauer entdeckt hier allerdings Gemeinsamkeiten bei beiden Richtungen: „Erfahrungswissenschaftliche und normative Pädagogik sind sich in diesem Punkte näher als sie glauben.“10 Die erfahrungs- wissenschaftliche Pädagogik versucht die Erziehungswissenschaft genauso zu behandeln wie die Naturwissenschaften. Brezinka verdeutlicht dies an seinem Wissenschaftsbegriff. „Wer ihren (den der Wissenschaft, d. Verf.) Zweck darin sieht, die Wirklichkeit zu erforschen und über sie zu informieren, entscheidet sich damit für einen anderen Wissenschaftsbegriff als jemand, der fordert, sie solle auch die moralischen Überzeugungen, die Einstellungen und Handlungen der Menschen beeinflussen.“11 Brezinka entscheidet sich zugunsten der Erkenntnisgewinnung aus der Wirklichkeit und gegen eine hermeneutische Herangehensweise. Er übersieht hier allerdings, dass die Auswahl von bestimmten Informationen immer auch deren Verwendung nahelegt. Anders als die Naturwissenschaften verändert die Pädagogik durch jede Art von Erkenntnisgewinnung ihren eigenen Gegenstandsbereich. Der Physiker, der den Aufbau eines Atoms untersucht, kann Aufgrund seiner Ergebnisse bestimmen, wie sich ein Atom zusammensetzt. Das Atom an sich bleibt allerdings dasselbe.
Trotzdem ist die Empirie für erfolgreiches pädagogisches Handeln unerlässlich. Wenn man durch empirische Erkenntnisgewinnung pädagogische Prozesse durchschaut und deren innere Zusammenhänge erkennt, wird die erfolgreiche Steuerung von Verhalten erst ermöglicht.
Das lässt sich gut an einem Beispiel verdeutlichen:
Viele Grundschullehrerinnen und -lehrer klagen über die mangelnde Konzentrationsfähigkeiten ihrer Schülerinnen und -schüler. Eine breit angelegte Untersuchung dieser Problematik an unterschiedlichen Grundschulen in Deutschland, die diese These unter Umständen bestätigen würde, zöge auch notwendigerweise Konsequenzen und Veränderungen im Umgang mit den Schülern nach sich. Außerdem ist die Forderung nach einer empirischen Untersuchung schon eine pädagogische Intervention. „Jeder Forschungsakt ist deshalb notwendig auch ein sinnkonstituierender Akt, ein verändernder Eingriff in diese Kommunikationsgemeinschaft.“12
Pädagogische Interventionen dürfen nicht dazu dienen, Menschen zu beherrschen, sondern müssen dazu eingesetzt werden, den Menschen aus dem, was ihn einengt, zu befreien.
Eine Beschränkung der Erziehungswissenschaften auf die empirische oder die hermeneutische Pädagogik birgt daher große Gefahren: Eine rein erfahrungswissenschaftlich definierte Erzieher- Kind Beziehung wäre eine am technologischen Erkenntnismodell orientierte Beziehung, wobei der Erzieher Subjekt und das Kind Objekt pädagogischen Handelns wäre und Intentionen des Erziehers daher leicht „als Ursachen missverstanden13 “ werden könnten. Eine ausschließlich hermeneutisch orientierte Pädagogik bezieht ihre Erkenntnisse nur aus Zeichen, in den meisten Fällen aus sprachlichen Zeichen. Sprache ist aber immer abhängig von sozialen Systemen. Die Erziehungswissenschaft nur auf die Interpretation von Sprache aufzubauen würde bedeuten, sie ständig der Gefahr der Ideologisierung auszusetzen.
In der Sonderpädagogik herrscht seit Jahren eine rege Diskussion über den Begriff der Behinderung, der von vielen Sonderpädagogen als stigmatisierend empfunden wird. Hier lässt sich gut veranschaulichen, wie schwer es ist, sich nur auf der Ebene der Sprache zu bewegen, ohne in diesem Fall Menschen auf ihre Behinderung zu reduzieren. Da es keinen adäquaten Ersatzbegriff für Behinderung gibt, arbeiten auch Sonderpädagogen als Teil der Kommunikationsgemeinschaft zwangsläufig mit diesem Begriff. Bliebe die Sonderpädagogik nur auf der Ebene der Sprache und der Interpretation eben dieser, könnten Stigmatisierungen nur unzureichend aufgedeckt werden, da man vorher empirisch untersuchen müsste, was Menschen mit dem Wort „Behinderung“ assoziieren, wie und wann dieser Begriff gebraucht wird usw.. Viele Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, dass sie durch die Verwendung des Wortes „behindert“ stigmatisieren. Den Handelnden sind oft „ihre Motive wie auch die Sprache, in der sie sie auszudrücken versuchen, nicht durchweg durchsichtig und ihnen deshalb rational nicht voll verfügbar...14 “.
Aufgabe der Erziehungswissenschaft muss es deshalb sein, Klarheit in das Erziehungshandeln zu bringen, etwaige Irrationalitäten aufzudecken und somit dafür zu sorgen, „dass die heranwachsende Generation solche Rationalität in sich hervorbringt.“15
4.Mollenhauer vor dem Hintergrund der Bildungsreform
Diese grundlegenden Überlegungen Mollenhauers sind eingebettet in einen zeitgeschichtlichen Kontext, in dem die Bildungsreform in Deutschland entstand. Diese Bildungsreform war massgeblich von der emanzipatorischen Pädagogik beeinflusst. So schreibt etwa Wilhelm Schwarz:
„Die emanzipatorische Pädagogik ist mehr als ein unübersehbarer Faktor der bundesrepublikanischen Bildungslandschaft. Sie ist die Richtung in der gegenwärtigen Pädagogik, die dem gesamten Geschehen ihren Stempel aufprägt. Ob man ihre Bemühungen aktiv unterstützt, sich mit ängstlicher Halbherzigkeit an ihre Bestrebungen anhängt oder ihr entgegentritt: noch jede Aktion und Reaktion ist durch sie bestimmt.“16
Die Ziele der Bildungsreform waren größtenteils emanzipatorischer Art und somit eine Reaktion auf die sich verändernden Wert- und Normvorstellungen innerhalb der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Diese neu definierten Ziele schlugen sich dementsprechend in allen Bildungsbereichen des Bildungssystem nieder.
4.1. Auswirkungen der emanzipatorischen Pädagogik im Schulsystem
So war etwa im Bildungsgesamtplan für den Elementarbereich eine besondere Förderung von Menschen mit individuellen oder milieubedingten Benachteiligungen festgesetzt. Diese Benachteiligungen sollten frühzeitig durch kompensatorische Maßnahmen ausgeglichen werden.17 Im Primarbereich wurde durch eine Revision des Curriculums Unterrichtsmethoden eingeführt, „die zu entdeckendem Lernen, zu selbständigem und gemeinschaftlichem Arbeiten sowie zur Einübung in Problemlösen hinführen18 “ sollten. Auch im Bereich der Sekundarstufe I waren die emanzipatorischen Auswirkungen der Bildungsreform deutlich spürbar. „Durch zunehmende Wahl- und Leistungsdifferenzierung unter Beibehaltung eines verpflichtenden Kernbereiches gemeinsamer Inhalte soll der Neigung und Befähigung des einzelnen in größtmöglichem Maße Rechnung getragen werden.“19
Neben den Revisionen der Curricula der bestehenden Schulformen setzte in den siebziger Jahren eine Diskussion über die Einführung der Gesamtschule ein. Die SPD- regierten Länder sahen die Ideen und Ideale des Bildungsgesamtplanes am ehesten in der integrierten Gesamtschule verwirklicht. „Bei der integrierten Gesamtschule ist der Schulverbund so eng, daß die einzelnen Schulformen nicht mehr voneinander zu trennen sind.“20 Pflichtfächer, Wahlpflichtfächer, Wahlfächer und Arbeitsgemeinschaften sollten für ein breites und individuell nutzbares Fächerangebot sorgen. Hinzu kam die Unterteilung in A- ,B- , und C- Kurse, wobei beispielsweise der A- Kurs Mathematik in diesem Bereich einem Leistungskurs entspräche und der C- Kurs Mathematik nur minimale Anforderungen stellte. In den zentralen Zielen dieser damals neuen Schulform zeigt sich wiederum die Nähe zu den Forderungen Mollenhauers. So ist ein Kernziel der integrierten Gesamtschule die „Verwirklichung von Chancengerechtigkeit im Bildungswesen durch Mobilität und Differenzierung.“21
Die CDU- regierten Länder setzten der integrierten Gesamtschule das Modell der kooperativen Gesamtschule entgegen. Bei dieser Schulform sollten die Schularten nicht wie in der integrierten Gesamtschule verschmelzen. Sie „hält im Prinzip an der Dreigliederung fest, wobei allerdings der Schwerpunkt auf die Kooperation der drei Zweige gelegt wird.“22 Hier sollte also eine möglichst hohe Durchlässigkeit zwischen den Schularten erreicht werden.
4.2. Aufgaben der Bildungsreform vor dem Hintergrund des Bildungsgesamtplanes
Diese Veränderungen im Bildungsgesamtplan zeigen sehr deutlich, wie viel Gewicht auf der Forderung nach gleichen Bildungschancen für Menschen aus allen sozialen Schichten in der Bildungsreform lag. „Hauptziel des Bildungssystems muss die Durchsetzung von Chancengleichheit - besser Chancengerechtigkeit sein, verstanden als optimale Förderung individuell unterschiedlicher Begabungen.“23 Der Mensch als Individuum trat also zudem in den Vordergrund und der Wunsch nach einer freien Entfaltung der Persönlichkeit, dem gesellschaftliche Rahmenbedingungen konträr gegenüberstanden, wurde stärker. Diese Bedingungen, die Emanzipation einschränkten, sollten nach Mollenhauer durch neue Konzeptionen in der Erziehungswissenschaft überwunden werden. Gleichzeitig erforderte eine so umfassende und einschneidende Reform des Bildungswesen natürlich auch gesichertes Datenmaterial, um die Reform auf „feste Füße“ zu stellen. Daher waren Hermeneutik und Empirie in der Bildungsreform eigentlich sehr eng miteinander verknüpft. Empirie verstand sich in der Bildungsreform als „Bildungsforschung“. Bildungsforschung sollte „eine kontinuierliche Reform der äußeren und inneren Struktur des Bildungswesens im Sinne einer Prozessplanung ermöglichen.“24 Die Aufgabe der Bildungsforschung war also die Erforschung der Außenstruktur (also der strukturellen sowie der quantitativen Bedingungen im Bildungswesen durch Bildungsstatistiken, Standortforschung usw.) sowie der Binnenstruktur (funktionale und qualitative Bedingungen, also z.B. die Sozialisations- und Curriculumforschung).
5. Kritik an Mollenhauers „Erziehung und Emanzipation“
So wichtig Mollenhauers Buch „Erziehung und Emanzipation“ für seine Zeit war, so umstritten war es auch. Wie bereits oben angesprochen, galt die emanzipatorische Pädagogik lange Zeit als die Richtung in der Pädagogik, und als ein Indiz für die Wichtigkeit einer bestimmten wissenschaftlichen Richtung gilt sicherlich die Zahl der Kritiker, die sie auf den Plan ruft.
So wirft etwa W. Schwarz in seinem Buch „Emanzipation als Bildungsziel?“ Mollenhauer vor, die Begriffe, mit denen er arbeitet, nicht hinreichend zu erläutern und sie in der Folge für seine Zwecke zu missbrauchen. „Was meint Mollenhauer, wenn er Rationalität sagt?“25 Schwarz stößt sich an der Verbindung der Begriffe Rationalität und Emanzipation, die an sich schon zweideutig sind und durch die „Wechselreiterei“ der Begriffe in dieser Zweideutigkeit verbleiben. Vielmehr solle hier der Begriff der Rationalität für das emanzipatorische Interesse herhalten. Nach Schwarz pervertiert die Vernunft zum Interesse. „Die Vernunft, die die Wahrheit sucht und dabei auch Kritik nicht scheut, wird zum Nörgler, wenn ihr anstelle der Wahrheit das Interesse unterschoben wird.“26 Die Rationalität darf also nicht zum bloßen Synonym für Gesellschaftskritik werden, wie Schwarz es bei Mollenhauer bemängelt.
O. Nigsch stellt in seinem Buch „Bildungsreform zwischen Entfremdung und Emanzipation“ die Frage, ob der Versuch, dass Emanzipationsproblem als pure politische Stimmungsmache abzutun, berechtigt sei.27 Er erkennt, dass das Emanzipationsproblem häufig von dogmatischen Standpunkten auf beiden Seiten aus diskutiert wird und fordert daher eine umfassende empirische Erschließung von Emanzipation, um eine „Präzisierung des terminologischen Instrumentariums zu erreichen28 “. Aufbauend auf dieser empirischen Untersuchung müsse dann geklärt werden, ob der Begriff „Emanzipation“ und sein Gegenstück, die „Entfremdung“, unter Umständen, weil nicht genau definierbar, ganz aus dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch eliminiert werden sollten.29
Auch Walter Braun wirft in „Emanzipation als pädagogisches Problem“ die Frage auf, ob es überhaupt möglich ist, „ein anthropologisch abgesichertes und pädagogisch relevantes Modell von Emanzipation30 “ zu entwerfen. Er kommt zu dem Schluss, „daß emanzipatorische Theorien zwar alle traditionellen kritisch zu hinterfragen imstande sind, daß aber diese Hinterfragung noch kein emanzipatorisches Modell liefert, das uns für die pädagogische Praxis nützen könnte.“31
Zudem entdeckt Braun einen fundamentalen Widerspruch in der Emanzipationspädagogik: Ist es möglich, Lernziele mit emanzipatorischem Charakter zu entwickeln, die sich dann also selbst in Frage stellen?32
H.-G. Roth stößt sich in „25 Jahre Bildungsreform in der Bundesrepublik“ an der negativen und eher kontraproduktiven Ausrichtung der emanzipatorischen Pädagogik, da sie hauptsächlich am Abbau von Fremdbestimmung interessiert und somit „auf Kritik und Negation ausgerichtet ist.“33 Er orientiert sich selbst an einem offenen Bildungsbegriff, der durch seine Flexibilität den Anforderungen einer freien pluralistischen Gesellschaft eher entgegenkommt.34
6. Fazit
Die große Leistung Mollenhauers besteht für mich darin, dass er die Vor- und Nachteile der hermeneutischen und der empirischen Pädagogik erkannt und beschrieben hat, um die beiden Richtungen dann zusammenzuführen zu dem, was er emanzipatorische Erziehungswissenschaft nennt. Sicherlich ist Emanzipation ein etwas schwammiger und politisch motivierter Begriff, doch der Einfluss, den Mollenhauer auf die Bildungsreform hatte, lässt sich meiner Ansicht nach nur durch die von ihm vorgenommene Politisierung der Pädagogik erklären. Aus heutiger Sicht ist sicherlich der von Roth geforderte offene Bildungsbegriff die klügere Variante. Dem damaligen Zeitgeist entsprach jedoch eher der emanzipatorische Bildungsbegriff, ohne den wohl eine solch einschneidende Reform wie die Bildungsreform nicht möglich gewesen wäre.
7. Literaturverzeichnis
Herausgeber: Wissenschaftlicher Rat der Dudenreaktion: Duden, Fremdwörterbuch. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag 1997
Herausgeber: Willmann- Institut München- Wien: Wörterbuch der Pädagogik. Freiburg im Breisgau: Herder 1977
Mollenhauer, Klaus: Erziehung und Emanzipation. München: Juventa Verlag 1968
Schwarz, Wilhelm: Emanzipation als Bildungsziel? Bonn: Eichholz Verlag 1974
Roth, Hans- Georg: 25 Jahre Bildungsreform in der Bundesrepublik. Bad Heilbrunn/OBB. Julius Klinkhardt Verlag 1975
Nigsch, Otto: Bildungsreform zwischen Entfremdung und Emanzipation. Graz: Hermann Böhlhaus Nachf. 1978
Braun, Walter: Emanzipation als pädagogisches Problem. Kastellaun/ Hunsrück: Aloys Henn Verlag 1977
Kreis, Heinrich: Der pädagogische Gedanke der Emanzipation in seinem Verhältnis zum Engagement. Bad Heilbronn/ OBB.: Julius Klinkhardt Verlag 1978
[...]
1 Herausgeber: Wissenschaftlicher Rat der Dudenreaktion: Duden, Fremdwörterbuch. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag 1997, S. 221
2 Herausgeber: Willmann- Institut München- Wien: Wörterbuch der Pädagogik. Freiburg im Breisgau: Herder 1977, S. 219
3 Herausgeber: Willmann- Institut München- Wien: a.a.O., S. 221
4 vgl. Herausgeber: Willmann- Institut München- Wien: a.a.O., S. 219
5 Herausgeber: Willmann- Institut München- Wien: a.a.O., S.221
6 Herausgeber: Willmann- Institut München- Wien:a.a.O., S.221
7 Mollenhauer, Klaus: Erziehung und Emanzipation. München: Juventa Verlag 1968, S.9
8 Mollenhauer, Klaus: a.a.O. , S.9 f.
9 Mollenhauer, Klaus: a.a.O., S.11
10 Mollenhauer, Klaus: a.a.O., S. 14
11 Mollenhauer, Klaus: a.a.O., S. 12
12 Mollenhauer, Klaus: a.a.O., S.15
13 Mollenhauer, Klaus: a.a.O., S.16
14 Mollenhauer, Klaus: a.a.O., S.17
15 Mollenhauer, Klaus: a.a.O., S.17 f.
16 Schwarz, Wilhelm: Emanzipation als Bildungsziel? Bonn: Eichholz Verlag 1974, S. 9
17 vgl. Roth, Hans- Georg: 25 Jahre Bildungsreform in der Bundesrepublik. Bad Heilbrunn/OBB. Julius Klinkhardt Verlag 1975, S. 67
18 Roth, Hans- Georg: a.a.O., S 73
19 Roth, Hans- Georg: a.a.O., S. 74 f.
20 Roth, Hans- Georg: a.a.O., S.81
21 Roth, Hans- Georg: a.a.O., S.82
22 Roth, Hans- Georg: a.a.O., S.80
23 Roth, Hans- Georg: a.a.O., S. 121
24 Roth, Hans- Georg: a.a.O., S. 123
25 Schwarz, Wilhelm: a.a.O., S.58
26 Schwarz, Wilhelm: a.a.O., S.61
27 Nigsch, Otto: Bildungsreform zwischen Entfremdung und Emanzipation. Graz: Hermann Böhlhaus Nachf. 1978, S. 186
28 Nigsch, Otto: a.a.O., S. 186
29 vgl. Nigsch, Otto: a.a.O., S. 187
30 vgl. Braun, Walter: Emanzipation als pädagogisches Problem. Kastellaun/ Hunsrück: Aloys Henn Verlag 1977, S. 93
31 Braun, Walter: a.a.O., S. 93
32 Braun, Walter: a.a.O., S. 94
33 Roth, Hans- Georg: a.a.O., S. 99
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung befasst sich mit Klaus Mollenhauers Buch „Erziehung und Emanzipation“ und dessen Bedeutung für die pädagogische Diskussion in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren. Sie untersucht den Begriff der Emanzipation, analysiert Mollenhauers Vorwort und beleuchtet die Auswirkungen emanzipatorischer Gedanken auf die Bildungsreform in der Bundesrepublik Deutschland.
Was ist Emanzipation laut dieser Ausarbeitung?
Emanzipation bedeutet im Grundsinne "Freilassung", also die Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit und die Verselbstständigung. Es beinhaltet die Gleichberechtigung einer bestimmten Gruppe innerhalb einer Rechtsgemeinschaft.
Wie hat sich der Begriff "Emanzipation" historisch entwickelt?
Der Begriff tauchte erstmals im römischen Reich auf und bedeutete die Freilassung des Sohnes durch den Vater oder des Knechtes durch den Herrn. Die heutige Bedeutung basiert auf Hegels Überlegungen, der die Menschheitsgeschichte als eine Freiheitsgeschichte verstand.
Welche Rolle spielt Emanzipation in der Pädagogik?
In der Erziehungswissenschaft wurde der Begriff der Emanzipation erst in den 1960er Jahren aufgegriffen. Jürgen Habermas trug dazu bei, indem er forderte, dass sich die Pädagogik vom Interesse an Emanzipation leiten lassen solle, also dem Ziel, Menschen aus Bedingungen zu befreien, die ihre Rationalität und ihr Handeln beschränken.
Was kritisiert Mollenhauer an der empirisch-analytischen Erziehungswissenschaft?
Mollenhauer befürchtet, dass die empirisch-analytische Erziehungswissenschaft zu einer Verkürzung der Erziehungswissenschaft führt, indem sie Wert- und Zwecksetzungen nur noch beschreibt, aber nicht mehr wissenschaftlich diskutiert. Er plädiert für eine Verbindung von empirischer und hermeneutischer Pädagogik.
Welche Auswirkungen hatte die emanzipatorische Pädagogik auf die Bildungsreform in der Bundesrepublik?
Die Bildungsreform war maßgeblich von der emanzipatorischen Pädagogik beeinflusst. Ziele wie Chancengleichheit, individuelle Förderung und die freie Entfaltung der Persönlichkeit wurden in den Bildungsgesamtplan aufgenommen und führten zu Veränderungen im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich, einschließlich der Diskussion um die Einführung der Gesamtschule.
Welche Kritik wurde an Mollenhauers „Erziehung und Emanzipation“ geübt?
Kritiker wie W. Schwarz warfen Mollenhauer vor, die Begriffe, mit denen er arbeitet, nicht hinreichend zu erläutern und sie für seine Zwecke zu missbrauchen. Zudem wurde die Verbindung von Rationalität und Emanzipation kritisiert, sowie die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt möglich sei, ein anthropologisch abgesichertes und pädagogisch relevantes Modell von Emanzipation zu entwerfen.
Was ist das Fazit der Ausarbeitung?
Mollenhauers Leistung besteht darin, die Vor- und Nachteile der hermeneutischen und der empirischen Pädagogik erkannt und beschrieben zu haben, um die beiden Richtungen zusammenzuführen. Sein Einfluss auf die Bildungsreform ist unbestreitbar, auch wenn der emanzipatorische Bildungsbegriff aus heutiger Sicht möglicherweise weniger relevant erscheint als ein offener Bildungsbegriff.
- Arbeit zitieren
- Mirko Wupper (Autor:in), 2001, Klaus Mollenhauer: Erziehung und Emanzipation, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105953