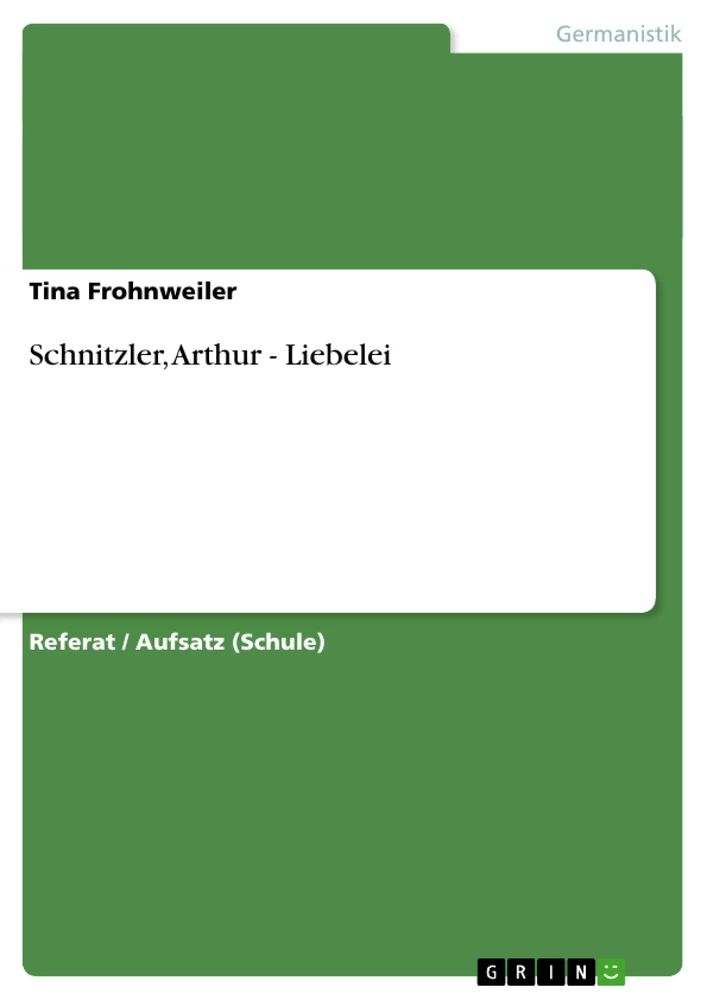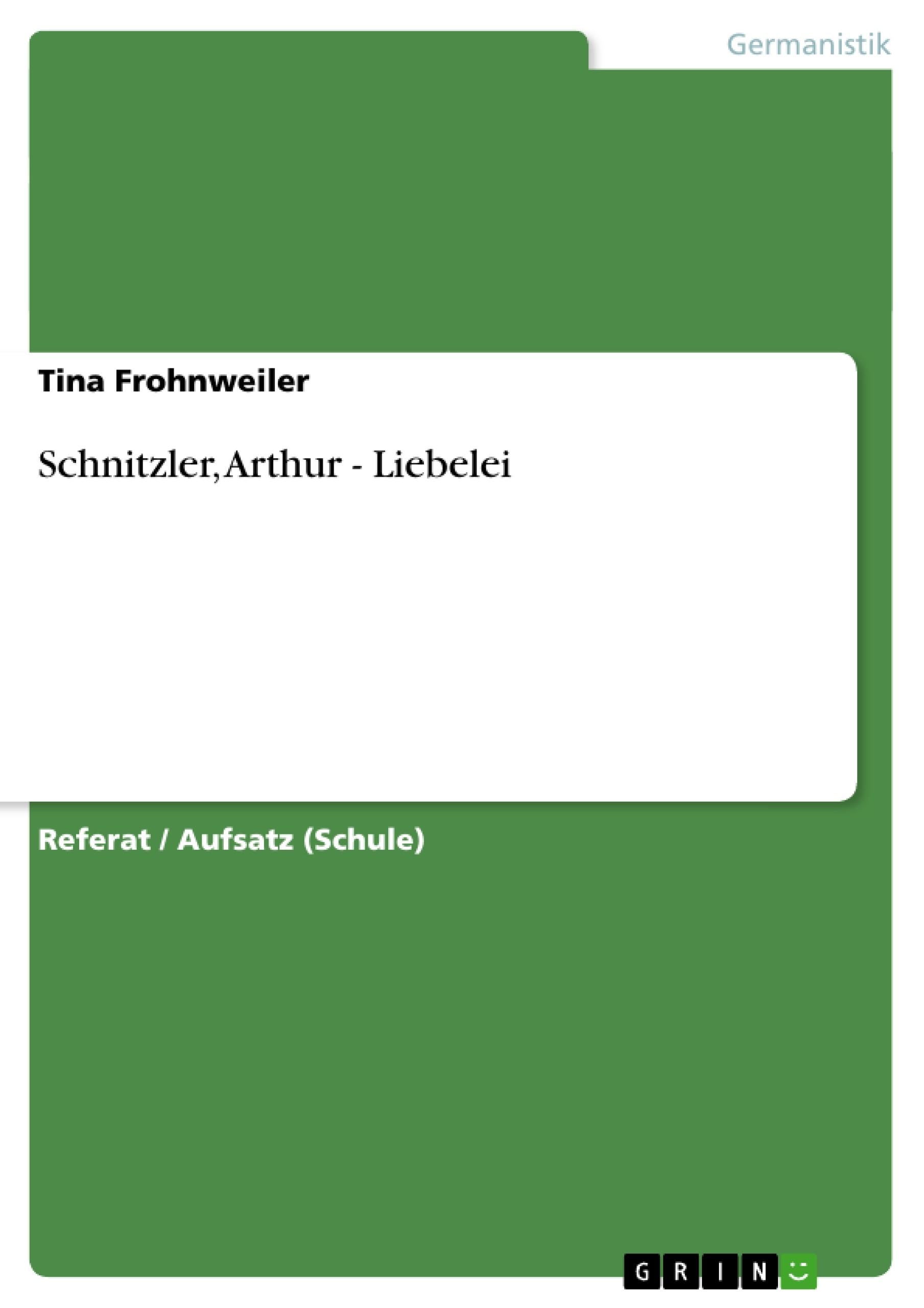Inmitten des glanzvollen Wien der Jahrhundertwende, wo Walzerklänge die Luft erfüllen und amouröse Intrigen zum Alltag gehören, entfaltet sich Arthur Schnitzlers "Liebelei" als ein erschütterndes Kammerspiel der Emotionen und gesellschaftlichen Konventionen. Der junge Lebemann Fritz Lobheimer, gefangen in einer Affäre mit einer verheirateten Frau, sucht Ablenkung in einer unbeschwerten "Liebelei" mit der unschuldigen Christine Weiringer, der Tochter eines Theatermusikers. Was als harmloses Spiel beginnt, entwickelt sich rasch zu einem Strudel aus Leidenschaft, Eifersucht und tragischer Verblendung. Schnitzler seziert mit messerscharfer Präzision die Doppelmoral der Wiener Gesellschaft, in der oberflächlicher Glanz und unbeschwerte Lebenslust die tiefen Abgründe menschlicher Sehnsüchte und Ängste verdecken. Die Begegnung mit dem Ehemann seiner Geliebten zwingt Fritz zu einer schicksalhaften Entscheidung, die nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das von Christine für immer verändern wird. Verzweifelt klammert sich Christine an die Illusion einer großen Liebe, während Fritz zwischen den Fesseln seiner Vergangenheit und dem Versprechen eines neuen Glücks hin- und hergerissen ist. Als die Wahrheit ans Licht kommt, stürzt Christine in einen bodenlosen Abgrund der Verzweiflung, unfähig, mit dem Verrat und dem Verlust fertig zu werden. Schnitzler entwirft ein eindringliches Psychogramm seiner Figuren, deren Handlungen von inneren Konflikten und äußeren Zwängen bestimmt werden. "Liebelei" ist mehr als nur eine tragische Liebesgeschichte; es ist eine schonungslose Abrechnung mit einer Gesellschaft, die ihre wahren Gefühle hinter einer Maske der Konvention verbirgt. Das Drama beleuchtet die Themen Liebe, Verlust, Tod und die Oberflächlichkeit der Wiener Gesellschaft zur Zeit der Jahrhundertwende. Ein zeitloses Meisterwerk der Wiener Moderne, das den Leser bis zum letzten Akt in seinen Bann zieht und noch lange nach dem Schließen des Buches nachhallt. Die Charaktere, von dem sensiblen Fritz über die naive Christine bis hin zu dem zynischen Theodor, verkörpern auf eindringliche Weise die Zerrissenheit und Haltlosigkeit einer Generation, die zwischen Tradition und Moderne gefangen ist. Ein Muss für Liebhaber klassischer Dramen und alle, die sich für die Abgründe der menschlichen Seele interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt von Arthur Schnitzler und erleben Sie ein Theaterstück, das Sie so schnell nicht vergessen werden.
Arthur Schnitzler LIEBELEI
Schauspiel in drei Akten
Von: Tina Frohnweiler und Lisa Heizmann
DAS STÜCK
Arthur Schnitzlers Tragödie Liebelei ist ein Schauspiel in drei Akten. Es entstand 1894 und wurde am 9. Oktober 1895 im Wiener Burgtheater erstmals aufgeführt. Das Stück selbst spielt im Wien der Jahrhundertwende.
Personen
Hans Weiringer (Violinspieler am Josefstädter Theater) Christine Weiringer (seine Tochter)
Mizi Schlager (Modistin)
Katharina Binder (Frau eines Strumpfwirkers) Lina (ihre 9 jährige Tochter)
Fritz Lobheimer (junger Mann)
Theodor Kaiser (junger Mann)
Ein Herr (Ehemann der Geliebten)
Inhalt
Theodor und Fritz verbringen mit ihren Bekannten Mizi und Christine eine stimmungsvolle Soiree. Theodor, der mit der lebenslustigen Mizi liiert ist, hat seinem Freund - als Erholung von der strapaziösen "Liebestragödie" mit einer verheirateten Frau - eine unverbindliche "Liebelei" mit Christine Weiring, der naiven Tochter eines städtischen Theatermusikers, verordnet. Durch das Erscheinen des Gatten der ehemaligen Geliebten wird die inszenierte Gemütlichkeit gestört: in einer kurzen Unterhaltung unter vier Augen fordert der unbekannte Herr Fritz zu einem Duell heraus.
Am darauffolgenden Tag gibt Fritz gegenüber Christine vor für kurze Zeit auf ein Gut zu verreisen. Christine sorgt sich um ihn und wird zwei Tage später von Theodor darüber unterrichtet, dass Fritz im Duell für eine andere Frau erschossen wurde und bereits begraben ist. Voller Verzweiflung stürzt sich Christine aus dem Fenster.
Interpretation
Schnitzler hat mit Liebelei seinen ersten und größten Bühnenerfolg. Er verwandelt den Typus des gemütvollen Wiener Volksstücks in ein sozialpsychologisches Drama: Er beschränkt sich auf die spätbürgerliche Welt und die umfassende Problematisierung von Kommunikationslosigkeit, Erotik und Tod.
Theodor und Fritz, zwei fesche wohlhabende Wiener Studenten, verbringen mit ihren Freundinnen Mizi und Christine in Fritzens Wohnung eine stimmungsvolle Soiree - bei Kerzenlicht, leiser Klaviermusik und belangloser Konversation. Theodor, der mit der lebenslustigen Mizi liiert ist, hat seinem Freund - als Erholung von der strapaziösen "Liebestragödie" mit einer verheirateten Frau aus der "guten" Gesellschaft - eine kleine, unverbindliche "Liebelei" mit Christine Weiring, der naiven Tochter eines städtischen Theatermusikers, verordnet. Seiner Meinung nach haben "die Weiber [...] nicht interessant zu sein, sondern angenehm ... Erholen! Das ist der Sinn. Zum Erholen sind sie da.". Für Fritz, labiler aber auch sensibler als Theodor, bedeutet Christine die Möglichkeit, aus seiner Langeweile in augenblickshafte Glückserlebnisse zu entfliehen. Strikt verbittet er sich beim Tête-à-tête mit Christine alles, was diesem Vorhaben im Wege steht - etwa ihre besorgte Frage nach jener mysteriösen "Dame in Schwarz" mit der Fritz im Theater gesehen wurde: "Gefragt wird nichts. Das ist ja gerade das Schöne. Wenn ich mit dir zusammen bin, versinkt die Welt - punktum." Das Kontinuum der Zeit ist für Fritz in ein Zufallsmosaik unzusammenhängender Augenblicke zerfallen; Glück ist nur denkbar als Stillstand, als Verewigung des Augenblicks: Denn der "Augenblick" ist die "einzige Ewigkeit", so argumentiert Fritz, "die wir verstehen können, die einzige, die uns gehört". Dieses Bewusstsein, dass die Wirklichkeit ungreifbar und nur momentanerweise zugänglich sei, steht in thematischem Zusammenhang mit einer radikalen Sprachskepsis: Fritz glaubt nicht mehr an die "großen Worte", die das Geheimnisvolle der Augenblickserfahrung zerstören ("Sprich nicht von Ewigkeit"); er glaubt einzig an die "Stimmung" davon, dass es "vielleicht Augenblicke" gibt, "die einen Duft von Ewigkeit um sich sprühen". Die Betonung der Nuance, der eigene Wert des Details, der in der Inszenierung des Lebens deutlich wird, ist ein Thema, mit dem sich Schnitzler in vielen seiner Stücke beschäftigt. Es wird zum Symbol für die sorglose Gesellschaft des Wiens der Jahrhundertwende, die im hier und jetzt, völlig unpolitisch und desinteressiert leben, stilisiert.
Jäh wird die inszenierte Gemütlichkeit gestört, als ein "unbekannter Herr" - der Gatte jener "Dame in Schwarz" - erscheint. Kompromittierende Liebesbriefe Fritzens hat er als Beweismaterial mitgebracht. Barsch, in kaltem Zorn, spricht er in einer kurzen Unterhaltung unter vier Augen die unvermeidliche Duellforderung aus.
Fritz zweifelt nicht daran, dass dies sein Todesurteil bedeutet. Am nächsten Tag unterhalten sich Frau Katharina Binder, eine Nachbarin, die ihre Umwelt mit "guten" Ratschlägen beeinflussen will und Christine in der kleinbürgerlichen Dachwohnung, die sie mit ihrem Vater bewohnt. Katharina versucht Christine von den Vorteilen einer Ehe mit einem Cousin zu überzeugen, der "so ein honetter junger Mensch" sei; "jetzt ist er sogar fix angestellt ... mit einem ganz schönen Gehalt". Sowohl Christine als auch ihr einsichtiger Vater weisen diese trostlose Aussicht auf ein Leben "ohne Glück und ohne Liebe" zurück.
Schnitzler erkennt, mit einem unbestechlichen Blick für Korrespondenzen im Gefüge der zeitgenössischen Gesellschaft, die Verwandtschaft von Frau Binders Prüderie und Mizis erotischer Leichtlebigkeit: Beide betrachten die Beziehung zum Mann vornehmlich unter dem Aspekt von Sicherheit und Profit; Frau Binder findet das "schönen Gehalt" ihres biederen Cousins ebenso imponierend wie Mizi die "schöne" und "prachtvoll" eingerichtete Wohnung von Fritz. Mit bissigen Anspielungen zieht Frau Binder sich zurück als Christine nach Hause kommt und über Kopfschmerzen klagt. Fritz ist zum verabredeten Rendezvous nicht erschienen. Plötzlich, gepackt von "einer solchen Sehnsucht nach diesem lieben süßen Gesichterl" steht er dann doch vor der Tür und lässt sich, unter dem Vorwand, kurzfristig vereisen zu müssen, in Wirklichkeit aber um Abschied für immer zu nehmen, Christines Zimmer zeigen. Das Interieur dieses Raumes - kleinbürgerliches Mobiliar mit künstlichen Blumen, Schubertbüste und kleiner Bibliothek - verklären sich in den Augen des Todgeweihten zur Stätte paradiesischen Geborgenseins. Gleichzeitig behauptet sich in ihm hartnäckig das Wissen um die abgründige Scheinhaftigkeit dieser Idylle: "O Gott, wie lügen diese Stunden!" Zwei Tage später erfährt Christine durch Dritte, dass sie für Fritz "nichts gewesen als ein Zeitvertreib". Er hat sich im Duell "für eine andere niederschießen lassen" und ist bereits begraben. "Indem er an einer Lüge stirbt wird sichtbar, dass sie von einer Lüge gelebt hat" (H. Bahr). Verzweifelt stürzt sich Christine aus dem Zimmer, um sich den Tod zu geben. Schnitzlers Schauspiel, dessen beiläufiger Konversationsbau sich im letzten Akt unversehens zu eindringlicher Unmittelbarkeit verdichtet, als in Christines jäh ausbrechender Verzweiflung der tragische Kern dieser scheinbar flüchtigen Beziehung enthüllt wird, erreicht mit diesen Szenen eine Dimension, die weit über den unmittelbaren, präzis fassbaren Zeitbezug hinaus reicht.. Hinsichtlich Figurenkonstellation und Thematik, kann man "Liebelei" mit dem bürgerlichen Trauerspiel (z.B. "Kabale und Liebe") vergleichen. Während bei Lessing und Schiller das tragische Scheitern der leidenden Bürgermädchen stets einen versöhnenden Aspekt enthält (Die Heldin durchschaut - kraft eines Bewusstseinsaktes - die Ausweglosigkeit ihrer Lage und verklärt den eigenen physischen Untergang zur Utopie eines von den Zwängen der Gesellschaft befreiten Individuums), stellt Schnitzler Ratlosigkeit und Verzweiflung dar (vgl. Hauptmanns frühe naturalistische Dramen z.B. "Die Ratten"): Alle Beteiligten sind in einem vom Individuum nicht mehr aufhebbaren Schuldzusammenhang verstrickt. Die Menschen stellen keine Individuen dar, sondern sind von der Gesellschaft in Rollen gepresst, welche sie zu Lügen und Verstrickungen zwingen. Die Übermacht des Anonymen, dem der einzelne ausgesetzt ist und erliegt, hält allegorisch ein Bild in Christines Zimmer fest; es zeigt "ein Mädel", das "schaut zum Fenster hinaus, und draußen ... ist der Winter". Das Bild heißt "Verlassen".
Charakterisierung der Personen
Fritz Lobheimer : Fritz ist sensibel, emotional und leidenschaftlich. Er hat keine Kraft zur Eigenständigkeit und es fehlt ihm an Selbstsicherheit. Er wirkt wie Kind, das auf eine Bezugsperson angewiesen ist. In diesem Falle ist es Theodor, der sich um Fritz kümmert und ihn bestärkt. Da er kein Mensch großer Worte ist und sich anderen gegenüber verschlossen zeigt, ergeben sich Unschlüssigkeiten in Bezug auf seine Beziehung zu Christine.
Er glaubt, seine Leidenschaft zu einer früheren Liebe schon überwunden zu haben, wird von ihr aber wieder eingeholt. Für sie stirbt er im Duell. Fritz möchte geliebt werden, gibt diese Liebe aber nicht zurück. Für ihn ist Christine nur Liebelei. Seine Bindungsängste macht er ihr oft genug deutlich, indem er betont, dass die Beziehung nicht für die Ewigkeit ist (S.116).
Christine Weiringer :
Sie verkörpert den von Schnitzler geschaffenen Typus des „süßen Mädels‘‘: ein schüchternes, naives Mädchen der Mittelschicht, die durch ihre Emotionalität und Ehrlichkeit besticht. Vor allem die jungfräuliche Unerfahrenheit reizt die Lebemänner Wiens. Dies zeigt sich darin, dass Fritz ihr alles bedeutet. Sie ist bereit, ihn auf Ewig zu lieben und ihm alles zu geben. Umso verständlicher ist es, dass Christine einen furchtbaren Schmerz verspürt als sie erfährt, dass ihr Geliebter gestorben ist. Ihr war bewusst, dass Fritz sie einmal verlassen wird, aber dass er für eine andere gestorben ist, verkraftet sie nicht. Als sie begreift, dass sie für ihn nur eine Liebelei war und wenig zu seinem Leben dazugehörte, stürzt sie sich aus Angst vor der Wiederkehr dieses Schmerzes in den Tod.
Mizi Schlager :
Mizi ist der Liebe und den Männern gegenüber kritisch eingestellt und lässt sich „leichtherzig von Hand zu Hand reichen‘‘ (R.Alewyn). Sie ist sich ihrer Weiblichkeit bewusst und weiß ihre Wirkung auf Männer zu nutzen. Sie ist selbstbewusst, emanzipiert und will ihr Leben genießen; Mizi lebt für den Augenblick. Das Genussbedürfnis drückt sich in ihrem leichtfertigen Umgang mit Liebschaften aus. Diese Handlungsweise macht sie den wienerischen Lebemänner ähnlich: Sie hat Theodor gern, als Liebe lässt sich diese Zuneigung aber keinesfalls bezeichnen.
Theodor Kaiser :
Theodor gehört zu den witzigen und charmanten jungen Männer des damaligen Wiens. Er weiß, was Frauen hören wollen und spielt nur mit ihnen. Er ist, ebenso wie Mizi, offen für Liebelei, die ihm Vergnügen bereitet. Treue, gegenseitiges Vertrauen und Rücksichtnahme sind sekundär. Die Liebe ist in seinen Augen nicht für die Ewigkeit, er lebt wie Mizi für den Augenblick (Stimmungszauber). Trotz seiner direkten Art, scheint er in seinem Inneren nicht gefühllos.
Hans Weiringer :
Hans Weiring glaubt, seine Schwester zeitlebens behüten zu müssen. Nach ihrem Tod bereut er, ihr nicht das Recht gegeben zu haben, frei zu leben. Deshalb lässt er seine Tochter Christine die Jugend genießen. Er weiß, dass Fritz nicht der Richtige für seine Tochter ist, gewährt ihr aber dennoch Freiheit. Nichts desto trotz möchte er seiner Tochter Enttäuschungen ersparen. Als er Christine in Schmerz und Trauer um ihren Geliebten erlebt, bereut er seine Großzügigkeit.
Katharina Binder :
Als Angehörige des konservativen Kleinbürgertums ist sie auf Ansehen und beruflichen Erfolg eines Menschen fixiert. Sie vertritt sie die Meinung, dass der gute Beruf einen Mann ausmacht und scheinbar weniger die Liebe zu ihm. Aus diesem Grund möchte sie Christine von Fritz wegbringen und mit Herrn Binder zusammen bringen.
Die Oberflächlichkeit wird in ihrer Aussage transparent, dass der Umgang mit Mizi Christine nur schade. Sie leugnet ihren jugendlichen Leichtsinn und toleriert das Verhalten der jungen Generation nicht.
Liebe & Liebelei
Mizi und Theodor sind die Vertreter der Liebelei. Die Erfüllung ihrer Lust und purer Genuss stehen an erster Stelle. Sie leben für den Moment. Den völligen Gegensatz dazu verkörpert Christine als Vertreterin der Liebe: Sie vertraut Fritz bedingungslos, ist ehrlich und bereit alles für ihn zu opfern. Fritz hingegen ist schwieriger einzuordnen:
Christine bekommt von ihm keine wahrhaftige Gegenliebe. Falls er zu lieben fähig ist, empfindet er keine Liebe zu Christine sondern eine Liebe zu der vorheirateten Frau, für die er in den Tod geht. Christine als besonders labiler Beispielcharakter des "süßen Mädel" verkraftet nicht die Tatsache, dass sie nur eine von Fritzens Liebeleien darstellt. Der Gegensatz zwischen ihrem starken Gefühl der Liebe und dem plötzlichen Bewusstsein nicht geliebt worden zu sein, treibt sie in den Freitod.
Der Tod
Die Tragödie endet mit dem Tod von Fritz und Christine. Aber was war ihnen der Tod wert? Die Beziehung zwischen Fritz und seinem "süßen Mädel" basierte nicht auf Liebe. Sie starben keinen Tod miteinander und keinen Tod umeinander und somit keinen erhebenden und tröstlichen Tod. Wenn es Liebe war, für die Fritz in den Tod ging, war es keine Liebe zu Christine und schlimmer noch eine Liebe von gestern.
Christine stellt hier einen besonders labilen Charakter dar. Als "süßes Mädel" verkraftet sie nicht die Tatsache, dass sie nur eine von Fritzens Liebeleien darstellte. Ihr Verhalten ändert sich gegen Ende schlagartig: Sie ist nicht mehr sie selbst, geht aus sich heraus, wütet durch die Wohnung. Der Gegensatz zwischen ihrem starken Gefühl der Liebe und dem plötzlichen Bewusstsein nicht geliebt worden zu sein, treibt sie in den Freitod.
Der Autor
Arthur Schnitzler wurde am 15.05.1862 in Wien geboren. Schon als Neunjähriger versuchte er sich im Schreiben von Dramen. Er studierte aber dennoch nach dem Abitur Medizin. Nach der Assistenzarztzeit in der allgemeinen Poliklinik seines Vaters in Wien eröffnete er nach dessen Tod eine Privatpraxis. Währenddessen schrieb er für Zeitschriften. Zwei Jahre später folgte dann sein erstes Bühnenmanuskript, 1893 die erste Uraufführung und 1895 das erste Buch, das den Namen "Sterben" trägt.
Arthur Schnitzler gilt als kultivierter, sensibler Erzähler der genussfreudigen Wiener Gesellschaft um die Jahrhundertwende. In seinen Werken befasst er sich hauptsächlich mit erotischen Problemen und mit der Darstellung von schwierigen und absonderlichen seelischen Zuständen (aus Liebe in den Tod). Diese scharfe psychologische Einfühlung und Darstellung ist charakteristisch für den Dekadenzdichter. R. Alewyn charakterisiert ihn sehr treffend als "Seelenzergliederer und Sittenschilderer, Gesellschaftskritiker und Wahrheitsfanatiker"
Nichts desto trotz ist Schnitzler dem männlichen Besitzdenken verfallen. Dies erklärt, dass er sich in seinen Werken durchgängig auf die Seite des Mannes stellt und sich mit seinen Figuren teilweise identifizieren kann. Die individuelle Gestalt in all ihren Charaktereigenschaften bildet stets den Mittelpunkt seiner Werke.
(HANDOUT)
THEMENKREIS "WIENER MODERNE"
ARTHUR SCHNITZLER: LIEBELEI (1894)
INHALT
SCHAUSPIEL IN DREI AKTEN
Theodor und Fritz verbringen mit ihren Bekannten Mizi und Christine eine stimmungsvolle Soiree. Theodor, der mit der lebenslustigen Mizi liiert ist, hat seinem Freund - als Erholung von der strapaziösen "Liebestragödie" mit einer verheirateten Frau - eine unverbindliche "Liebelei" mit Christine Weiring, der naiven Tochter eines städtischen Theatermusikers, verordnet. Durch das Erscheinen des Gatten der ehemaligen Geliebten wird die inszenierte Gemütlichkeit gestört: in einer kurzen Unterhaltung unter vier Augen fordert der unbekannte Herr Fritz zu einem Duell heraus.
Am darauffolgenden Tag gibt Fritz gegenüber Christine vor für kurze Zeit auf ein Gut zu verreisen. Christine sorgt sich um ihn und wird zwei Tage später von Theodor darüber unterrichtet, dass Fritz im Duell für eine andere Frau erschossen wurde und bereits begraben ist. Voller Verzweiflung stürzt sich Christine aus dem Fenster.
LIEBE UND LIEBELEI
Mizi und Theodor sind die Vertreter der Liebelei. Die Erfüllung ihrer Lust und purer Genuss stehen an erster Stelle. Sie leben für den Moment. Den völligen Gegensatz dazu verkörpert Christine als Vertreterin der Liebe: Sie vertraut Fritz bedingungslos, ist ehrlich und bereit alles für ihn zu opfern. Fritz hingegen ist schwieriger einzuordnen: Christine bekommt von ihm keine wahrhaftige Gegenliebe. Falls er zu lieben fähig ist, empfindet er keine Liebe zu Christine sondern eine Liebe zu der vorheirateten Frau, für die er in den Tod geht. Christine als besonders labiler Beispielcharakter des "süßen Mädel" verkraftet nicht die Tatsache, dass sie nur eine von Fritzens Liebeleien darstellt. Der Gegensatz zwischen ihrem starken Gefühl der Liebe und dem plötzlichen Bewusstsein nicht geliebt worden zu sein, treibt sie in den Freitod.
DIE TRAGÖDIE
In Christines jäh ausbrechender Verzweiflung wird der tragische Kern der Liebelei mit Fritz enthüllt. Der belanglose Konversationsbau verdichtet sich im letzten Akt augenblicklich zu eindringlicher Unmittelbarkeit, das Schauspiel erreicht mit diesen Szenen eine neue Dimension. In Bezug auf Figurenkonstellation und Thematik, kann man "Liebelei" mit dem bürgerlichen Trauerspiel (z.B. "Kabale und Liebe") vergleichen. Während bei Lessing und Schiller das tragische Scheitern der leidenden Bürgermädchen stets einen versöhnenden Aspekt enthält (Die Heldin durchschaut - kraft eines Bewusstseinsaktes - die Ausweglosigkeit ihrer Lage und verklärt den eigenen physischen Untergang zur Utopie eines von den Zwängen der Gesellschaft befreiten Individuums), stellt Schnitzler Ratlosigkeit und Verzweiflung dar (vgl. Hauptmanns frühe naturalistische Dramen z.B. "Die Ratten"): Alle Beteiligten sind in einem vom Individuum nicht mehr aufhebbaren Schuldzusammenhang verstrickt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Liebelei" von Arthur Schnitzler?
"Liebelei" ist ein Schauspiel in drei Akten, eine Tragödie von Arthur Schnitzler, die 1894 entstand und 1895 uraufgeführt wurde. Das Stück spielt im Wien der Jahrhundertwende und thematisiert Beziehungen, Liebe, und Tod in der spätbürgerlichen Gesellschaft.
Wer sind die Hauptfiguren in "Liebelei"?
Die Hauptfiguren sind Hans Weiringer (Violinspieler), Christine Weiringer (seine Tochter), Mizi Schlager (Modistin), Fritz Lobheimer (junger Mann), Theodor Kaiser (junger Mann) und ein Herr (Ehemann der Geliebten).
Worum geht es in "Liebelei"?
Das Stück handelt von Fritz, der eine Affäre mit einer verheirateten Frau hat. Sein Freund Theodor rät ihm zur Erholung eine unverbindliche "Liebelei" mit Christine Weiring zu beginnen. Die Situation eskaliert, als der Ehemann der ehemaligen Geliebten Fritz zu einem Duell fordert. Fritz wird im Duell getötet und Christine, die in ihn verliebt war, stürzt sich daraufhin aus dem Fenster.
Was sind die zentralen Themen in "Liebelei"?
Die zentralen Themen sind die Oberflächlichkeit und Inszenierung von Beziehungen, die Unfähigkeit zu wahrer Kommunikation, die Ambivalenz zwischen Liebe und "Liebelei", sowie die Auseinandersetzung mit Erotik und Tod in der Wiener Gesellschaft um die Jahrhundertwende.
Wie wird der Charakter Fritz Lobheimer in "Liebelei" dargestellt?
Fritz wird als sensibler, emotionaler und leidenschaftlicher Mann dargestellt, dem es jedoch an Selbstsicherheit und Eigenständigkeit mangelt. Er sucht Glück in flüchtigen Momenten und kann sich nicht fest binden.
Wie wird Christine Weiringer charakterisiert?
Christine verkörpert den Typus des "süßen Mädels": Ein naives, schüchternes Mädchen der Mittelschicht, das sich nach wahrer Liebe sehnt und für Fritz alles zu opfern bereit ist. Ihre Unerfahrenheit und Ehrlichkeit machen sie für Fritz interessant, doch er kann ihre Liebe nicht erwidern.
Was repräsentieren Mizi Schlager und Theodor Kaiser in dem Stück?
Mizi und Theodor repräsentieren die "Liebelei", den unverbindlichen Genuss und die kurzweiligen Vergnügungen. Sie leben für den Augenblick und legen weniger Wert auf Treue oder tiefe Gefühle.
Welche Rolle spielt der Tod in "Liebelei"?
Der Tod spielt eine zentrale Rolle, da er das Ende der Illusionen und die Tragik der Beziehungen offenbart. Fritz stirbt im Duell für eine vergangene Liebe, und Christine wählt den Freitod, weil sie die Oberflächlichkeit ihrer Beziehung zu Fritz nicht ertragen kann.
Wie wird "Liebelei" im Vergleich zu anderen bürgerlichen Trauerspielen gesehen?
Anders als in den bürgerlichen Trauerspielen von Lessing und Schiller, in denen das tragische Scheitern der Heldinnen oft einen versöhnenden Aspekt hat, zeigt Schnitzler in "Liebelei" Ratlosigkeit und Verzweiflung. Die Figuren sind in einem Schuldzusammenhang verstrickt, dem sie nicht entkommen können.
Was ist die Bedeutung des Bildes "Verlassen" in Christines Zimmer?
Das Bild "Verlassen", das ein Mädchen zeigt, das aus dem Fenster in den Winter schaut, symbolisiert die Übermacht des Anonymen und die Verlassenheit, der die einzelnen Figuren ausgesetzt sind. Es verdeutlicht die Ausweglosigkeit ihrer Situation.
- Quote paper
- Tina Frohnweiler (Author), 2001, Schnitzler, Arthur - Liebelei, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105731