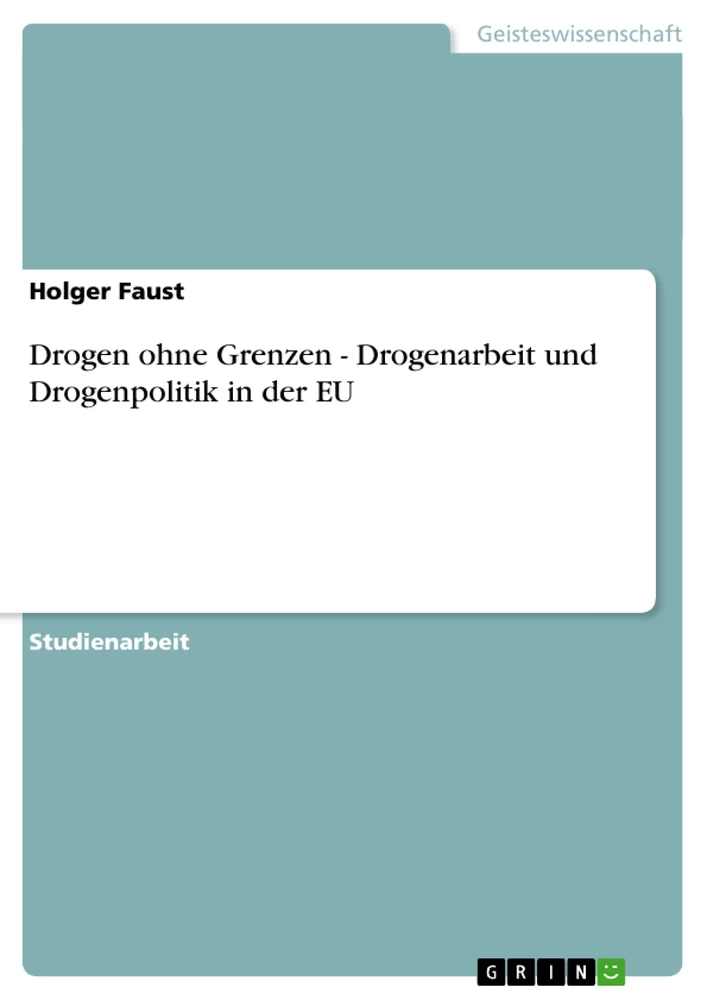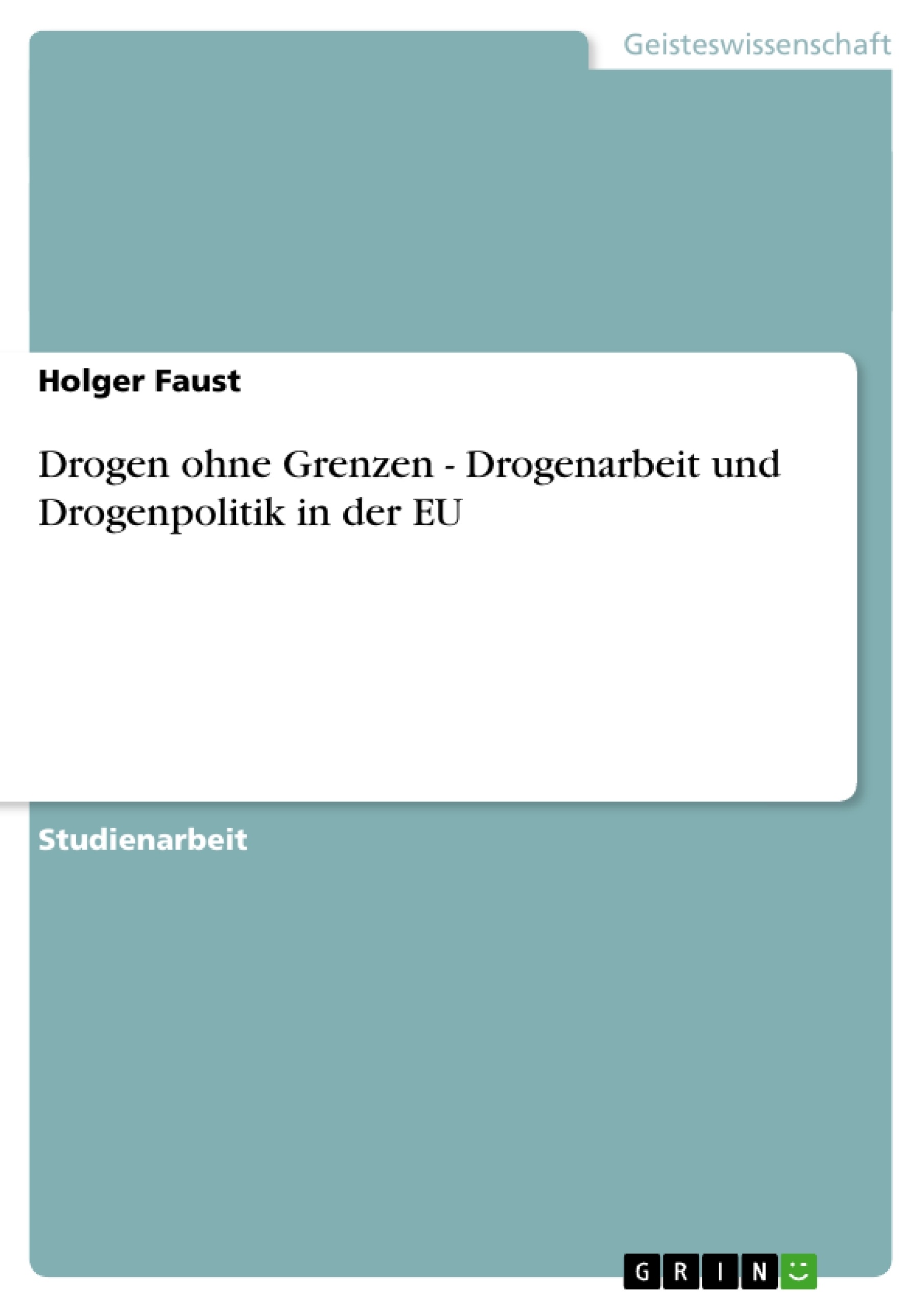1 EINLEITUNG
2 DROGENPROBLEMATIK DER EU
2.1 WAS SIND DROGEN?
2.2 CHARAKTERISTIK VON DROGEN
2.2.1 Cannabis
2.2.2 Heroin
2.2.3 Kokain, Crack
2.2.4 Amphetamine
2.2.5 Ecstasy
2.2.6 LSD
2.3 PRÄVALENZ UND KONSUM
2.3.1 Allgemeine Drogenerfahrung
2.3.2 Adoleszenz
2.3.3 Zahl der KonsumentInnen
2.3.4 Zahl der Drogentoten
2.3.5 Menge der beschlagnahmten Drogen
2.4 FOLGEN DES DROGENKONSUMS
2.4.1 Individuelle Folgen
2.4.2 gesellschaftliche Folgen
3 DROGENMARKT
3.1 DER WELTWEITE DROGENMARKT
3.2 DER EINHEITLICHE DROGENMARKT DER EU
3.3 ANGEBOT UND NACHFRAGE ALS MARKTMECHANISMUS
3.4 DIE HÄNDLER UND PRODUZENTENSEITE
3.5 KORRUPTION UND GELDWÄSCHE
4 ALLGEMEINE ZIELSETZUNG VON DROGENPOLITIK UND -ARBEIT
4.1 DEFINITION
4.2 STRATEGIE
5 INTERNATIONALE LÖSUNGSSTRATEGIEN
5.1 INTERNATIONALE MAßNAHMEN
5.1.1 Abkommen und Verträge
5.1.2 Die Vereinten Nationen
5.2 STRATEGIE DER EU
5.2.1 Der Europäische Aktionsplan
5.2.2 Europol
5.2.3 Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
5.2.4 Pompidou-Gruppe
5.2.5 Bewertung der EU-Strategie
6 NATIONALE LÖSUNGSSTRATEGIEN
6.1 REPRESSION
6.1.1 Betäubungsmittelgesetzgebung
6.1.2 Prozeßrechtssysteme
6.2 PRÄVENTION
6.3 REINTEGRATION UND REHABILITATION
6.3.1 Ambulante Beratung, Betreuung und Behandlung
6.3.2 Entzug
6.3.3Entwöhnung
6.3.4 Nachsorge
6.4 SCHADENSMINIMIERUNG
7 ABSCHLUßBETRACHTUNG
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
LITERATURLISTE
1 Einleitung
Eine saubere, drogenfreie Gesellschaft? Ohne Kriminalität, Verelendung, Prostitution, Spritzen auf Spielplätzen, Dealern an Schulen, Sorgen der Eltern, AIDS, Hepatitis etc.. So stellen sich weite Teile der Politik und der Gesellschaft seit Jahrzehnten, seit Beginn des “Kampf gegen Drogen”, gegen “die Geißel unserer Jugend”, die Welt,in der wir Leben, vor. In der Tat, eine schöne Vorstellung. Sind aber wirklich die Drogen dafür verantwortlich?
Die „Utopie einer drogenfreien Gesellschaft“ argumentiert meist mit einer Doppelmoral, wird der Blick auf die Verbreitung sozial akzeptierter Drogen wie Alkohol, Tabak und Medikamente geworfen. Drogen vielleicht als Sündenbock für das, was in unserer Konsumgesellschaft falsch läuft? Angst aus Unwissenheit? Jede Debatte über Drogen wird meist emotional geführt, wie die oben gewählte, natürlich provozierend gemeinte, Wortwahl zeigt.
Zwei Positionen stehen sich dabei unerbittlich gegenüber. Hier Abstinenz und Repression, dort Legalisierung und Entkriminalisierung. Beide Lager kommen sich keinen Schritt näher. Die nationale Sichtweise verhindert, daß das Drogenproblem, und es ist wirklich ein Problem, auf anderem Wege, dem internationalen, gelöst wird. Drogen haben keine Grenzen. Sie verbreiten sich auf der ganzen Welt und werden von internationalen Händlern vertrieben, meist aber national bekämpft. Dabei kann weder die eine Position, welche den Konsum verherrlicht, noch die andere, welche Drogen dämonisiert, in naher Zukunft eine Lösung erwarten. Gibt es überhaupt eine Lösung? Sollte nicht statt dessen eine Reform eingeleitet werden, welche sich aus Repression und Legalisierung zusammensetzt, um das bisherige System zu verbessern, die Defizite aufzuzeigen, zum Wohle der Suchtkranken, der KonsumentInnen und der Gesellschaft?
Der Konsum von Drogen als bewußtseins- und emotionsverändernde Substanzen, welche auf das zentrale Nervensystem einwirken, ist fast so alt wie die Geschichte der Menschheit selbst. Vom rituellen Gebrauch von Meskalin der Schamanen oder der medizinischen Anwendung von Opium als Heilpflanze in der sumerischen bzw. assyrischen Kultur 2700 v. Christus, hier ist von der “braunen Droge” und von der “Tochter des Feldmohns” die Rede, zeigen, daß es nie eine drogenfreie Gesellschaft gab. Zu allen Zeiten konsumierten Menschen Drogen, wobei in der neueren Zeit der rituelle Aspekt mit allgemeingültigen Bräuchen, welche den/die BenutzerIn vor Mißbrauch schützte, verschwindet.
In den 60er Jahren setzte in den westlichen Industriestaaten die “Drogenwelle” v.a. unter Jugendlichen im Zuge der studentischen Protestbewegung als Folge gesellschaftlicher und politischer Konflikte und Umbrüche ein. Die Gesellschaft reagierte mit repressiven kriminalisierenden Maßnahmen, z.B. durch die Verschärfung des Strafrechtes und sah Drogenkonsum und -abhängigkeit als Devianz.
Erst in den 80er Jahren suchte man nach anderen Wegen, dem Drogenproblem mit all seinen Folgen, Verelendung, Drogentot, Beschaffungskriminalität, AIDS usw., Einhalt zu gebieten. Es entstand ein System der Medizinalisierung und Therapeutisierung, in der Sucht als Krankheit gesehen wird und dringend behandlungsbedürftig ist. Die Repression durch das Strafrecht mit dem Abstinenzparadigma wurde aber nicht aufgegeben, sondern dient weiterhin als Richtlinie für die Drogenarbeit und Drogenpolitik. Drogen als “das Böse an sich”, als “Dämon für unsere Jugend” welche es unbedingt zu bekämpfen gilt, sind Grundlage für den seit den 60er Jahren geführten “War on Drugs”.
Heute konsumieren Millionen junger Menschen aus allen sozialen Schichten und gesellschaftlichen Gruppen Drogen. Laut UNO rauchen mehr als 140 Millionen auf der Welt Cannabis. 8 Millionen greifen zu Heroin und Opiaten, rund 13 Millionen zu Kokain und 30 Millionen zu Amphetaminen.. In vielen Ländern ist der Drogenkonsum und -mißbrauch in alle Lebensbereiche eingedrungen und dabei für die Gesellschaft zum Problem geworden.
Ist der „Krieg gegen die Drogen“ vielleicht gescheitert? Alle Mitglieder der Europäischen Union (EU) sehen Drogen als Bedrohung. Der “Nationale Rauschgiftbekämpfungsplan” Deutschlands dient hier nur als Beispiel.
Drogen sind kein nationales Problem oder Phänomen, obwohl sie zumeist national behandelt werden. Formen und Ausmaß des Drogenkonsum sind in allen Staaten verschiedentlich ausgeprägt. Unterschiede bestehen hinsichtlich des Umfangs und der Qualität der ergriffenen Maßnahmen. Strafrecht, Hilfs- und Therapieangebote divergieren teilweise in erheblichem Umfang.
Diese Arbeit versucht sich dem Problem Drogen innerhalb der EU zwischen den Polen Repression und Legalisierung zu nähern. Sie soll einen Vergleich ermöglichen, ob die jetzige Drogenpolitik und Drogenarbeit erfolgreich ist oder nicht. Inwieweit ist die Tatsache, daß die Drogenpolitik national begrenzt ist, hinderlich, um eine professionelle Drogenhilfe und -arbeit zu leisten?
Zunächst ist es deshalb wichtig, zu klären, was und wer das Drogenproblem ist, um später zu beleuchten, wie es von Drogenpolitik und Drogenarbeit zu lösen versucht wird. Ob es dabei eine einfache Lösung gibt, ist fraglich. Dabei erregt bereits das bloße Erwähnen der Begriffe „Drogen“, „Drogensucht“ und „Drogenabhängigkeit“ die Gemüter und führt zu einer Reihe unterschiedlicher, manchmal sehr heftiger Reaktionen.
Wie kaum ein anderer Bereich umfaßt das „Drogenproblem“ eine Vielzahl verschiedener Aspekte und dringt in eine ebenso große Anzahl verschiedener Lebensbereiche ein. Eine detaillierte Aufzählung aller wichtigen Aspekte im Zusammenhang mit dieser Problematik würde den hier vorgegebenen Rahmen sprengen. Sie betreffen Individuen und Gruppen wie auch Stadtviertel, Städte, Regionen und Länder und stehen darüber hinaus sogar in einem internationalen Kontext.
Innerhalb der EU gibt es zwar einige Ansätze hin zu einer einheitlichen Strategie, ob und wie sie gelingt, versucht diese Arbeit später zu ergründen. Da es sich um eine vergleichende Studie handelt, befaßt sich das erste Kapitel 4 mit der Drogenproblematik, um mögliche Unterschiede der EUMitgliedsstaaten herauszuarbeiten.
Drogenarbeit und Drogenpolitik muß sich auch vor Augen halten, daß der Drogenhandel in seiner internationalen Verflechtung eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellt. Um dies aufzuzeigen, wird dem Drogenmarkt ein eigenes Kapitel gewidmet. Das dritte Kapitel befaßt sich damit, wie die Politik an diese Problematik herangeht, welche Konzepte sie entwickelt und welche unterschiedlichen Strategien bestehen. Die Umsetzung der Strategien durch die Drogenarbeit soll dann im nachfolgenden Kapitel aufgezeigt werden.
Kein Kapitel ist getrennt von dem anderen zu sehen. Die Drogenproblematik ist die Grundlage für die Drogenpolitik. Diese wiederum nimmt Einfluß auf die Drogenarbeit. Das Drogen Gefahren beherbergen, legal oder illegal, soll nur kurz angesprochen werden, da dies von vorne herein klar ist.
Welche Wege gibt es, dem Problem beizukommen? In letzter Zeit wurden zunehmend aus verschiedenen Kreisen und zwar nicht nur von linken Vordenkern, sondern auch von Polizei und Politik, über eine Legalisierung von Drogen, z.B. einer staatlichen Heroinabgabe, nachgedacht und diskutiert.
Innerhalb der praktischen Arbeit mit Drogenabhängigen kommen neue Konzepte, die weitestgehend von dem bisher vorherrschendem Abstinenzparadigma abweichen und alternative Wege suchen, sich mit dem Thema Sucht und Abhängigkeit auseinanderzusetzen. Vorreiter ist hier wieder einmal die Niederlande, aber auch in Deutschland finden verschiedene Ansätze zunehmend ein offenes Ohr. Der Name, unter dem verschiedene Maßnahmen subsumiert werden, ist die Akzeptierende Drogenarbeit, die den Konsum von Drogen als normal herausstellt und nicht eine totale Abstinenz fordert, sondern aufzuzeigen versucht, daß ein Leben mit der Sucht möglich ist.
Es ist eine Tatsache, daß es keine drogenfreie Gesellschaft gibt und in nächster Zeit auch nicht geben wird. Die Behandlung einer Sucht sollte völlig unabhängig davon sein, ob das Suchtmittel erlaubt oder verboten ist.
2 Drogenproblematik der EU
Warum sind Drogen ein Problem für die KonsumentInnen, aber auch für die Gesellschaft? Dieses Kapitel versucht, die Frage zu beantworten und die Nachfrageseite zu beleuchten. Was für Substanzen, welches Ausmaß und welche Folgen?
Seit Mitte der 60er Jahre greifen immer mehr Jugendliche zu Drogen. Ausgehend von den USA hat sich die Drogenwelle mit zeitlicher Verzögerung auch auf Europa ausgedehnt. England war eines der ersten Länder, in denen ein Konsum in großem Umfang festgestellt wurde. Heroin und Kokain wurden dort in den 60er Jahren von staatlicher Seite vergeben. Ende der 80er hat sich die Verbreitung von Drogen innerhalb ganz Europa auf hohem Niveau eingependelt und ist in den 90er Jahren nicht zurückge- gangen.
Die 15 Mitglieder der Europäischen Union treffen sich eher selten, um über die Ursachen der Drogenprobleme zu debattieren und an einer Lösung zu arbeiten. Die meiste Zeit verbringen sie damit, herauszufinden, was vor sich geht, während ihre politischen Möglichkeiten beschränkt bleiben. Sie sind immer in der Defensive, immer versucht, neue Richtungen von Drogenabhängigkeit herauszuarbeiten. Einige besitzen verläßliche Daten zum Ausmaß des Problems und wenig zum Erkennen der Wichtigkeit von sekundären Eigenschaften wie ökonomische Auswirkungen. Gerade Studien über die Kosten der bisher geführten Drogenpolitik sind dringend notwendig, um über eine Lösung zu diskutieren.
Kein EU-Staat kann behaupten, daß er einen umfassenden und zuverlässigen Nachweis seiner Aufgaben im Zusammenhang mit den durch Drogenpolitik und Drogenmißbrauch verursachten Kosten erbringen kann, obwohl diese Daten von großer Bedeutung für die Effizienz der politischen Strategie sind. Wieviel kostet die Strafverfolgung, was sind die Folgekosten der Sucht, also Beschaffungskriminalität wie auch Therapie und Rehabilitationskosten, was sind die Auswirkungen des Schwarzmarktes? Hierzu gibt es nur sehr wenige verläßliche Daten.
Das Drogenproblem in Europa wird von einigen wichtigen Faktoren begleitet - der offensichtlichste ist die Schwierigkeit, gleiches mit gleichem zu vergleichen. Drogenkonsum kam in seiner modernen Form zu verschiedenen Zeiten und unter unterschiedlichen Bedingungen in den Mitgliedstaaten auf. Großbritannien, die Niederlande, Deutschland, Dänemark und Frankreich erfuhren es zuerst, irgendwann Mitte oder Ende der 60er. Für die meisten anderen ist es ein Phänomen der 70er und 80er. Es gibt ebenso große Unterschiede in der Forschungstradition. Diejenigen, welche das Drogenproblem, mit Ausnahme von Frankreich, als erste behandelt haben, besitzen die meisten Forschungsergebnisse, andere fast keine.
In Ländern, in denen es keine Untersuchungen gibt, basieren Theorien zur Abhängigkeit und Sucht auf Informationen von anderen Quellen. In Griechenland, Spanien und Portugal zum Beispiel wurden Programme aus Amsterdam, London oder Köln übernommen. Diese Zuweisung ist nicht akzeptabel für Länder, in denen die Familie eine gewichtige Rolle spielt. Zum Beispiel leben die meisten der 40.000 Heroinabhängigen in Portugal mit ihren Eltern zusammen und werden innerhalb der Familie finanziell unterstützt - Straßenjunkies wie in Deutschland sind fast unbekannt.
2.1Was sind Drogen?
Es gilt zunächst zu definieren, was unter Drogen verstanden wird. Hierzu eine Definition unter vielen: “ Drogen: Substanzen - natürlich gewonnen oder synthetisch hergestellt-, die mißbraucht werden. Neben den sog. Rauschmittel auch Genußmittel, Arznei- und Giftstoffe.”1
Hier zeigt sich schon, wie schwer eine einheitliche Begriffsdefinition zu finden ist. Später wird diese Definition noch näher konkretisiert, basiert im Wesentlichem auf einer Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahre 1964. Drogen werden dabei immer unter den Aspekten Mißbrauch, Abhängigkeit, Sucht eingestuft, wobei der Grad der Abhängigkeit variiert. Abhängigkeit ist ein “Zustand, der sich aus der wiederholten Einnahme einer Droge ergibt, wobei die Einnahme periodisch oder kontinuierlich erfolgen kann. Ihre Charakteristika variieren in Abhängigkeit von der benutzten Droge...”2Der Begriff Drogensucht wurde ersetzt durch den Begriff Drogenabhängigkeit, die in allen europäischen Ländern als Krankheit anerkannt ist.
Auf Grundlage dieser Definitionen und der daraus resultierenden
Drogentypologie (siehe Abbildung 1) basieren die internationalen
Abkommen, UN-Single-Convention von 1961, Übereinkommen über psychotrope Suchtstoffe von 1971 sowie dem Wiener Zusatzabkommen von 1988, die maßgeblich Einfluß nehmen auf die Ausgestaltung der Drogenpolitik der EU und ihrer Mitglieder.3
WHO Drogentypologie (Abbildung 1)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter Drogen sollen im folgendem alle Substanzen verstanden werden, welche unter die internationalen Suchstoffabkommen fallen und deren Konsum nach den internationalen Gesetzen verboten und illegal ist. Auch wenn diese Unterscheidung nach Böllinger4 nicht auf sozialmedizinischen, pharmakologischen, soziologischen und psychologischen Erkenntnissen beruht, sondern aufgrund verschiedener internationaler Interessen, v.a. den USA, gewachsen ist. Er spricht von einer Doppelmoral in der Drogenpolitik: “Ein Teil der
Drogen ist sozial akzeptiert, ihr Gebrauch kulturell integriert und ökonomisch gefördert, der Umgang mit dem anderen Teil wird strafrechtlich sanktioniert und als kulturfremd ausgegrenzt..”
Dagegen sollte der psychoaktive Aspekt von Drogen auf das zentrale Nervensystem betont werden, wie es Vogt/Scheerer5vorschlagen: ”Drogen sind alle Stoffe, Mittel, Substanzen, die aufgrund ihrer chemischen Natur Strukturen oder Funktionen im lebenden Organismus verändern, wobei sich diese Veränderung insbesondere in den Sinnesempfindungen, in der Stimmungslage, im Bewußtsein oder im Verhalten bemerkbar machen.”
Diese Definition ist laut Böllinger6und Rausch7frei von juristischen und moralischen Bewertungen und bedient sich damit einer objektiven Sicht von Suchtstoffen, die notwendig erscheint, um sich dem Thema neutral zu nähern.
2.2 Charakteristik von Drogen
Ausgehend von der oben erwähnten Unterscheidung legal, illegal soll im folgendem auf die illegalen Drogen eingegangen werden, auf die sich sowohl Drogenpolitik als auch Drogenarbeit in der Hauptsache befassen und in der EU am weitesten innerhalb der Illegalität verbreitet sind:
- die Cannabisprodukte Haschisch und Marihuana,
- Heroin,
- Kokain,
- Ecstasy,
- Amphetamine,
- LSD.
Dabei soll kurz auf Wirkungsweise, Risikopotential, Konsumform und Illegalität eingegangen werden: Keine Droge ist dabei frei von Risiken, auch wenn von keinen körperlichen Schäden oder seelischer Abhängigkeit gesprochen wird. Alle bringen bei exzessiven Konsum nichtkalkulierbare Auswirkungen für die KonsumentInnen mit sich. Es ist nicht nur die Droge allein, es hängt ab, wer die Droge konsumiert und in welchem Kontext dies erfolgt, wie und wie oft. Keine Droge darf deshalb verharmlost werden. Wirkung und Potential der Substanz sollten möglichst objektiv beschreibar sein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Abbildung 2)
2.2.1 Cannabis
- wird aus der leicht zu kultivierenden Hanfpflanze Cannabis Sativa gewonnen, die auf allen Kontinenten wächst. Haschisch - auch Hasch, Dope, Shit - hergestellt aus Cannabisharz; Marihuana - auch Gras, Ganja - aus Cannabiskraut.
- Wirkungsweise und -dauer: Entspannend, dämpfend sowie leicht halluzinogen; beruht auf den Wirkstoff THC (Tetrahydrocannabinol). Die Stärke richtet sich nach der Wirkstoffkonzentration des THC, der im Duchschnitt bei 5- 15% liegt. Die Wirkung hält je nach THC-Gehalt 1 bis 3 Stunden an.
- Konsumform: Rauchen pur oder mit Tabak; schlucken als Plätzchen oder Tee.
- Abhängigkeitsentwicklung: Normalerweise führt der Konsum nicht bzw. zu einer äußerst geringen Toleranzentwicklung, bei der weder eine körperliche
Abhängigkeit noch Entzugserscheinungen eintreten. Meistens tritt auch keine psychische Abhängigkeit ein, bei übermäßigem Konsum kann aber eine Gewöhnung an die entspannende Wirkung der Droge einsetzen.
- Überdosis: Sehr unwahrscheinlich, vorher Erbrechen.
- Illegalität:. Seit 1937 in Deutschland verboten; 60%
aller Verurteilungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt (BtMG) aufgrund Cannabiskonsums; Seit 1994 geringe Mengen laut Bundesverfaßungsgericht toleriert und straffrei; allerdings gibt es keine genaue Regelung, was geringe Mengen bedeuten. In Holland in der Praxis straffrei, juristisch aber nur geduldet, in den meisten europäischen Ländern werden geringe Mengen zum Eigenkonsum toleriert.8
2.2.2 Heroin
- halbsynthetisch hergestellt aus dem getrockneten Milchsaft des Schlafmohns, - auch H, Dope, Braunes - wurde 1898 von der Firma Bayer als Hustensaft entwickelt.
- Wirkungsweise und -dauer: zuerst euphorisierend, dann dämpfend. Als Schmerz - und Beruhigungsmittel übt es, ähnlich Morphium, eine depressive Wirkung auf das zentrale Nervensystem aus. Es wird als Schmerzkiller bezeichnet. Der Reinheitsgehalt auf dem Straßenmarkt liegt zwischen 20 - 45%, es wird immer gestreckt, u.a. mit Koffein, Vitamin C, Paracetamol und wirkt höchstens vier Stunden.
- Konsumform: rauchen auf Alufolie, schnupfen als braunes Pulver, injizieren; intravenöser Gebrauch ist die riskanteste Methode.
- Abhängigkeitsentwicklung: anhaltender, regelmäßiger Konsum verursacht mit großer Wahrscheinlichkeit die Entwicklung einer körperlichen Toleranz sowie ein zwanghaftes Gebrauchsmuster. Die Dosis muß immer weiter erhöht werden, so daß die euphorisierende Wirkung erlebt wird. Bei Entwicklung einer Toleranz mit einer körperlichen und psychischen Abhängigkeit treten bei Nichtkonsum Entzugserscheinungen (“Cold Turkey”9) auf. Der Gebrauch muß aber nicht zwangsläufig in eine Abhängigkeit führen. Bei Einhaltung bestimmter Regeln ist es durchaus möglich, genußorientiert und kontrolliert Heroin zu gebrauchen. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß Heroin das stärkste psychische Abhängigkeitspotential aller hier charakterisierten Drogen hat.
- Überdosis: Krämpfe, Bewußtlosigkeit, Tod. Die meisten Überdosierungen sind unbeabsichtigt. Schuld hat meistens eine ungewohnt hohe Stoffkonzentration des Straßenheroins sowie der bei Junkies weit verbreitete polyvalente Gebrauch mehrerer Drogen.
- Illegalität: Besitz, Erwerb und Handel ist illegal. In
einigen Ländern werden geringe Mengen zum Eigenverbrauch toleriert und nicht strafrechtlich verfolgt10.
2.2.3 Kokain, Crack
- Kokain - auch Koks, Schnee - wird mittels eines
chemischen Verfahrens aus den Coca-Blättern gewonnen. Crack ist die rauchbare, freie Base, die mittels chemischer Umwandlung aus Backpulver, Äther oder Ammoniak gewonnen wird.
- Wirkungsweise und -dauer: euphorisierend,
stimulierend, appetithemmend. Es ist ein Aufputschmittel und vermittelt das Gefühl körperlicher Kraft, voller Energie und gesteigerter Leistungsfähigkeit, welches die Bewältigung stressiger Situationen mit Hilfe eines positiven Selbstwertgefühls erleichtert. Auch als Egodroge bezeichnet. Die Dauer hält zumeist nur 30 Minuten an, bei Crack meist nur 15 Minuten
- Konsumform: schnupfen als weißes Pulver, rauchen (Crack, Freebase), injizieren.
- Abhängigkeitsentwicklung: Ob eine körperliche
Toleranzentwicklung bei Kokaingebrauch einsetzt, ist in der Literatur umstritten, bei Kokain eher unwahrscheinlicher als bei Crack, dessen Konsum entzugsähnliche Erscheinungen zur Folge haben kann. Die größte Gefahr besteht in der Entwicklung einer psychischen Abhängigkeit, die bei Crack noch wesentlich höher ist als bei Kokain, wenn es geschnupft wird. Kokain macht gierig nach mehr. Ein regelmäßiger hoher Kokainkonsum führt zu Gewichtsverlust, geschwächtem Immunsystem bis zum körperlichem Verfall. Trotzdem ist ein genußorientierter und kontrollierter Gebrauch möglich, bewiesen durch die Tatsache, daß sehr wenige KokainistInnen in den Drogenhilfeeinrichtungen auftauchen und ihren Konsum weitgehend selbst kontrollieren. Bei Crack gibt es bisher nur Untersuchungen aus den USA, die zeigen, daß der Konsum schnell außer Kontrolle gerät und zum Mißbrauch bis zur Abhängigkeit führen kann.
- Überdosis: Krämpfe, Sinnestäuschungen, Tod
- Illegalität: Besitz, Erwerb und Handel ist wie bei Heroin verboten, in manchen Ländern wird es medizinisch in der Lokalanästhesie eingesetzt und in geringen Mengen toleriert11.
2.2.4 Amphetamine
- rein synthetisch hergestellt - auch Speed oder Pep.
- Wirkungsweise und -dauer: stimulierend,
aufputschend. Sie wirken auf das zentrale Nervensystem ein und bewirken einen ähnlichen Effekt wie ein körpereigener Adrenalinausstoß. Sie lösen das Gefühl von Wachsein, erhöhter Aufmerksamkeit, unterdrücktem Hunger und Schlafbedürfnis, Wohlbefinden evtl. aber auch Anspannung aus. Je nach Dosierung dauert der Rausch 6 - 12 Stunden an.
- Konsumform: schnupfen (häufigste Form) als weißes
Pulver, schlucken als Tablette, injizieren
- Abhängigkeitsentwicklung: Bei exzessivem Gebrauch
stellt sich rapide eine Toleranzentwicklung ein, d.h. für die gleiche Wirkungsweise der Droge ist eine immer höhere Dosierung notwendig, körperliche Entzugserscheinungen wie bei Opiaten treten nicht auf. Eine psychische Abhängigkeit kann sich entwickeln, da sich eine starke Sehnsucht nach dem Drogeneffekt einstellen kann.
- Überdosis: Muskelkrämpfe, Pulsrasen, erhöhte
Körpertemperatur. Meist hervorgerufen durch hohe Dosierung oder Mischkonsum mit Alkohol, Heroin oder Barbituraten.
- Illegalität: Besitz, Erwerb, Handel ist verboten12.
2.2.5 Ecstasy
- Synthetisch hergestellt aus Safrol oder
Piperonylmethylketon; entwickelt 1912 von der Firma Merck als Appetitzügler, bezeichnet ursprünglich die reine Substanz mit der chemischen Formel 3,4-Methylen-Dioxy-Methyl- Amphetamin oder abgekürzt MDMA. Auf dem Schwarzmarkt werden aber auch verwandte Stoffe wie MDE, MDA, 2CB oder DOB vertrieben, die eng verwandt aber teilweise eine anderer Wirkung besitzen, was ein hohes Risikopotential in sich birgt, da niemand genau weiß, welche Substanz enthalten ist - auch E, XTC, Pille.
- Wirkungsweise und -dauer: sowohl entspannend als
auch euphorisierend und stimulierend, leicht halluzinogen sowie kontaktfördernd. Es erzeugt das Gefühl von Unverletzlichkeit, steigert das Harmonie- und Zärtlichkeitsempfinden gegenüber Aggressivität und Ängstlichkeit und wird deshalb als “Liebesdroge” bezeichnet. Die Dauer des Rausches liegt je nach Stoffkonzentration bei bis zu vier Stunden.
- Konsumform: meistens Schlucken als Pille.
- Abhängigkeitsentwicklung: Körperlich macht Ecstasy
nicht abhängig. Es führt nicht zu Entzugserscheinungen und nicht zu einem zwanghaften Mißbrauchsmuster, wie das z.B. bei Heroin der Fall ist. Der Körper bildet aber eine Toleranzbildung sowohl in Hinblick auf den aufputschenden wie auch psychoaktiven Effekt, so daß sich der Körper an den Stoff gewöhnt und immer größere Dosen eingenommen werden müssen, um den gleichen Effekt zu erhalten. Bei exzessivem Konsum kann eine psychische Gewöhnung an die Droge entstehen.
- Überdosis: Krämpfe, Kreislaufprobleme, selten Tod,
meist wegen vorausgehenden Herzproblemen oder Überempfindlichkeit
- Illegalität: Besitz, Erwerb, Handel von MDMA seit
1985, MDE, MDA u.a. in den 90er in den europäischen Ländern verboten13.
2.2.6 LSD
- - auch Acid, Pappe, Trip, Micro - halbsynthethisch hergestellt aus dem Mutterkorn ,einem Getreidepilz; entdeckt 1938 von Albert Hofmann, schweizer Chemiker bei Sandoz
- Wirkungsweise und -dauer: starkes Halluzinogen und psychedelische Droge, Sinnesverzerrungen, verändertes Raum- und Zeitgefühl; es sensibilisiert die Sinne und erhöht die Geschwindigkeit der Informationsaufnahme. Die Wirkung
wird als Trip oder Reise in eine andere Welt beschrieben. Es treten visuelle Effekte mit einer veränderten Farbintensität und Wahrnehmung von Gerüchen, Bewegungen und Berührungen auf. Leichtere Trips wirken etwa 5-6 Stunden, stärkere 12-16.
- Konsumform: schlucken, als Microtabletten oder imprägniert auf Eßpapier
- Abhängigkeitsentwicklung: Der Konsum führt nicht zu einer körperlichen Abhängigkeit. In seltenen Fällen kann eine psychische Gewöhnung an die Rauschwirkung einsetzen.
- Überdosis: Es liegen keine seriösen Berichte über eine Überdosierung vor. Bei exzessivemGebrauch kann aber eine Psychose ausbrechen, auch bei einmaligem Gebrauch, wenn eine psychiatrische Vorschädigung vorlag.
- Illegalität: Der Handel, Besitz und Erwerb ist verboten14.
2.3 Prävalenz und Konsum
In der EU leben heute etwa 370 Millionen Menschen. Das Ausmaß des Konsums und die daraus resultierenden Probleme lassen sich anhand von einigen Indikatoren bestimmen15:
- Drogenerfahrung und aktueller Konsum
- Zahl der Drogentoten
- Menge der beschlagnahmten Drogen
Aus diesen Daten lassen sich verschiedene Informationen ableiten: Wie viele EuropäerInnen nehmen welche Drogen? Wie groß ist die Nachfrage nach Drogen? Wie groß das Angebot? Was für Problem ergeben sich daraus? Welche neuen Trends zeichnen sich ab? Wie groß ist das Drogenproblem tatsächlich? Wie unterscheiden sich Drogenkonsum und Drogenproblem in den EU-Staaten? Sie bieten eine Basis, um an einer Lösung durch Drogenpolitik und -hilfe zu arbeiten.
Wie erwähnt, lassen sich diese Zahlen nur bedingt vergleichen und interpretieren. Die nationalen Unterschiede haben zur Folge, daß selbst scheinbar gleichgeartete Daten im europäischemVergleich nicht vereinbar sind. So werden z.B. Zahlen zum Ausmaß des Cannabiskonsums verwässert durch die unterschiedliche strafrechtliche Verfolgung in manchen Ländern und der daraus geführten Statistik. Die epidemiologische Forschung zum Drogenkonsum steckt in vielen Ländern noch in den Kinderschuhen und ist erst langsam im Aufbau begriffen.
Die EU versucht zwar seit einigen Jahren diese Defizite auszugleichen und fordert von den Mitgliedstaaten einen einheitlichen Aufbau von Netzwerken, die sich mit dem Erforschen des Ausmaßes und der Drogenentwicklung befassen. Viele Länder, z.B. Portugal und Griechenland, haben damit aber erst vor einigen Jahren begonnen. Andere Länder, wie Holland und England, besitzen schon länger
halbwegs verläßliche Daten, die mit Hilfe von Monitoring-Systemen das Ausmaß des Konsums beleuchten und neue Drogentrends aufspüren. Von diesen Ländern sollte innerhalb der EU sowie ihren Nachbarstaaten gelernt werden.
Fast alle Angaben beruhen auf Schätzungen von Polizeibehörden, regierungsnahen Stellen oder Einrichtungen der Drogenhilfe und geben nur unzureichend Aufschluß über das tatsächliche Ausmaß und die Verbreitung. Die Zahlen basieren entweder auf der Anzahl der KonsumentInnen, die mit der Polizei und der Drogenhilfe in Kontakt kommen, ein sogenannter institutioneller Zugang oder auf Umfrageergebnissen sogenannten epidemioglogisch orientierten Prävalenzstudien, die teilweise sehr ungenau sind und sich meist auf eine Gruppe von Personen, in der Regel Schüler und Studenten, beschränken.
Die Illegalität und die soziale Mißbilligung von Drogen lassen Aufschlüsse über die Aufrichtigkeit der Bevölkerung durch eine Umfrage teilweise fraglich erscheinen. Es bleibt wohl immer eine Dunkelziffer. Über die Gesamtheit des Konsums können alle nachfolgenden Daten nur begrenzt etwas aussagen und sollten mehr als Anhaltspunkte dienen und nicht übernommen werden, um damit das Drogenproblem erklären zu wollen.
In Deutschland werden die Zahlen in der Hauptsache von drei Stellen ermittelt:
- Einmal von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durch eine Repräsentativumfrage mit 3000 Befragten,
- dem Bundeskriminalamt (BKA) innerhalb des Rauschgiftjahresberichtes,
- und dem Institut für Suchtforschung (IFT), das Daten von den Suchtberatungsstellen innerhalb des EBIS-Dokumentationssystem auswertet.
Portugal hat als Quelle das staatliche Programm gegen den Drogenmißbrauch “Projekt VIDA” sowie die polizeilich auffällig gewordenen DrogenkonsumentInnen.
Die Niederlande erfaßt die Daten anhand der Polizeistatistik sowie mit sogenannten Monitoring-Systemen, die sich mit dem Aufspüren neuer Drogentrends sowie mit dem Vergleichen alter Daten befassen. Hier leistet das TRIMBOS-Institut in Utrecht diese Arbeit.
Alle 15 Mitgliedsstaaten der EU besitzen polizeiliche Statistiken sowie eine staatliche Institution, die sich mit epidemiologischen Studien zum Drogenkonsum befaßt und ihre Daten in einem europäischen Informationsnetz für Drogen und Drogensucht mit dem Namen REITOX16übermittelt.
Es handelt sich diesbezüglich um quantitative Erhebungen, welche den Blickwinkel nicht auf die Lebenswelt der von Drogenproblemen Betroffenen richtet. Versuche, den Drogengebrauch und seine Auswirkungen ausschließlich mit quantitativen Methodensträngen zu erfassen, können den Prozeßcharakter und die wechselseitigen Beeinflussung- und Bedingungsfaktoren von Umwelt, Person und Drogen nicht klar genug aufschlüsseln.
Neuere qualitativ orientierte Forschungsarbeiten zeigen, daß der Einstieg in den illegalen Drogengebrauch und dessen Fortführung ein äußerst komplexes Geschehen darstellt17. Die lebensweltliche Erfassung des Interaktionsgeflechtes zwischen dem Individuum, seiner konkreten Lebenspraxis und den gesellschaftlichen Einflüssen würde die Chance eröffnen, den Gebrauch von illegalisierten Drogen als Resultat differentieller Entwicklungsverläufe zu erhellen.
Wie Eingangs schon erwähnt, gibt es in der EU z.B. keine vergleichenden Studien zu den Folgen der Kriminalisierung und deren Kosten. Desweiteren fehlen in diesen Prävalenzstudien Aussagen über die Bedeutung des Gebrauchs für das Individuum, Konsumsituation oder Gebrauchsmuster. Oftmals wird vom Konsum von Opiaten direkt auf Abhängigkeit und Sucht geschlossen. Die Drogenwirkung wird für die Entstehung der Abhängigkeit verantwortlich gemacht. Dabei wird die Lebenswelt der KonsumentInnen ausgeblendet, in der es auch den kontrollierten und genußorientierten und nicht nur den zwanghaften Gebrauch gibt, ebenso wie selbstinitierte Cleanphasen.
Das rein statische Konzept der Studien kann deshalb das Drogenproblem nur beschreibend darstellen und klassifizieren, nicht aber erklären. Drogenprobleme sind aber ein prozeßhaftes Geschehen, das sich ständig dem Wandel von neuen subkulturellen Trends und gesellschaftlichen Werten mit verändernden Gesetzen und Drogenhilfestrukturen ausgesetzt ist.
2.3.1 Allgemeine Drogenerfahrung
Eine Repräsentativumfrage der Gesamtbevölkerung ist der direkteste Weg, um den Drogenkonsum eines Landes zu beschreiben. Nur die Hälfte der EU-Staaten führten seit 1990 solche nationale Erhebungen durch. Leider werden die Befragungen nicht jährlich durchgeführt, so daß Trends schwer zu ermitteln sind.
Alle Personen wurden zufällig ausgewählt. Unterschiede gibt es dabei im Alter. Die meisten Länder starteten ab 18 Jahre aufwärts, andere schon ab 15 oder 16 Jahren. In einigen Studien wurde dabei ein mündliches Befragungsverfahren eingesetzt, in anderen ein telephonisches oder postalisches. Die Wahl des Verfahrens für die Schätzung der Drogenprävalenz hat einen nicht unerheblichen Einfluß18. Telephonbefragungen ergeben in der Regel die geringsten
Werte19. Die Ermittlung auf dem Postweg ergeben die höchsten. Das mündliche Verfahren rangiert in der Mitte. Die Unterschiede in der Datenermittlung erschweren eine direkten Vergleich zwischen den einzelnen Ländern.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Abbildung 3)
Abbildung 3 zeigt, wieviel Prozent der Personen eines Landes jemals in ihrem Leben Erfahrungen mit Drogen gemacht haben. Cannabis ist mit Abstand die am weitesten verbreitete illegale Droge in der EU. Finnland und Ostdeutschland liegen dabei mit um die 5% am Ende der Skala, Dänemark und Großbritannien mit 31% bzw. 21% an der Spitze. Die anderen illegalen Drogen Kokain, Amphetamine und Ecstasy haben dazu im Vergleich relativ wenige Menschen in ihrem Leben probiert. Nur die Prävalenz von Amphetaminen in Großbritannien mit 8%, sowie die von Kokain in Spanien mit 3,3% zeigen deutliche Unterschiede zu den anderen Ländern. Ecstasy wurde dabei von relativ wenigen Personen jemals konsumiert. Heroin ist dabei von allen Drogen am wenigsten verbreitet, liegt in allen Umfragen unter 0,5%.
Trends lassen sich anhand der Lifetime-Prävalenz nicht
abzeichnen. Der Konsum kann schon Jahre bis in die 60er zurückliegen und wurde nur in einer Lebensperiode der Person ausprobiert. Ein besserer Indikator für die aktuelle Situation ist die Befragung, ob illegale Drogen während der letzten 12 Monate konsumiert wurden.
(Abbildung 4)
Mit Ausnahme von Cannabis ist der Konsum von Drogen während der letzen 12 Monate im allgemeinen sehr niedrig, unter 2% bei Kokain, Amphetaminen und Ecstasy. Vergleiche und Trends lassen sich damit nicht ableiten. Im allgemeinen läßt sich im Vergleich zu den 80er Jahren sagen, daß der Konsum von Cannabis in den 90er angestiegen ist, in einigen Ländern auch der Gebrauch von Amphetaminen und Ecstasy, insbesondere bei Jugendlichen. Kokain und Heroin haben eine relativ geringe Verbreitung.
2.3.2 Adoleszenz
Allgemeine Bevölkerungsumfragen erscheinen nicht sensibel genug, um das Drogenproblem zu erfassen und Trends abzugeben, die wichtig für Politik und Hilfe sind. Drogenkonsum ist besonders problematisch im Jugendalter. Während dieses Lebensabschnittes des Experimentierens findet zumeist der erste Kontakt mit Drogen statt. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Adoleszenz wie kein anderer Abschnitt des menschlichen Lebens mit Neugierde, Experimentierfreudigkeit und riskanten Verhal- tensweisen in Verbindung zu bringen ist.
Fast alle EU-Staaten befaßten sich in den 90er mit derartigen Untersuchungen. Es zeigt sich, daß in der Gruppe der Jugendlichen und junger Erwachsenen im Alter von 12-24 Jahren die Werte, was die Drogenerfahrung anbelangt, wesentlich höher liegen als für die Gesamtbevölkerung. Hier ist als Indikator die Drogenerfahrung auf Lebenszeit (Lifetime- Prävalenz) aussagekräftiger, da der Erstkontakt noch nicht so lange her ist. Als Umfragemethode wurde ein Fragebogen benutzt. Es ist anzunehmen, daß die Jugendlichen den Drogenkonsum eher zugeben, da die Anonymität gewährleistet und die Eltern in sicherer Entfernung waren.
Der Cannabiskonsum bietet einen nützlichen Einstieg. Ein direkter Vergleich der einzelnen Länder ist zwar aufgrund des unterschiedlichen Alters der Jugendlichen nicht direkt möglich, zeigt aber, daß sehr viele Jugendliche bereits Erfahrungen mit dieser Droge besitzen. Mit zunehmendem Alter steigt in fast allen Ländern die Prävalenz.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Abbildung 5)
Richtet sich der Blick auf alle wichtigen illegalen Drogen in der Gruppe der 15 - 17jährigen in Umfragen nach der gleichen Methode, durchgeführt an Schulen, ergibt sich folgendes Bild:
Drogenerfahrung auf Lebenszeit von 15-16 Jährigen Schülern
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Abbildung 6)
Sind die Daten für Cannabis relativ verläßlich, beruhen im Bezug auf Amphetamine, Ecstasy, LSD sowie Kokain und Heroin die Angaben teilweise auf Schätzungen, so daß die Verläßlichkeit dieser Daten fraglich ist. Cannabis ist die am weitesten verbreitete Droge, In der Regel haben 2-5% der 15- 16 Jährigen jemals in ihrem Leben Amphetamine, LSD und Ecstasy probiert. In Finnland und Schweden unter 1%, in Luxemburg und Großbritannien hat jeder zehnte Speed und Ecstasy konsumiert, noch mehr, nämlich 12%, testeten in England LSD. Heroin und Kokain liegen im Schnitt bei 1%, wobei Kokain etwas häufiger probiert wurde, in den
Niederlanden von etwa 2% der Schüler.
In Deutschland gibt es keine Untersuchungen in dieser
Altersgruppe. Als grober Vergleich kann eine Großgruppe der
12 - 25jährigen in Westdeutschland 1997 herangezogen werden:
Lifetime-Prävalenz 12-25jähriger Jugendlicher in Westdeutschland
(Abbildung 7)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein Vergleich mit anderen europäischen Staaten wäre nur bei einer exakten Altersgruppe möglich. Es zeigt aber, daß Ampethamine und Ecstasy neben Cannabis unter Jugendlichen die am häufigsten probierten Drogen in Deutschland sind.
Amphetamine, Ecstasy und LSD zählen zu den sogenannten "Partydrogen". Der Konsum findet dabei bevorzugt auf Technoveranstaltungen statt, die oftmals mehrere Tage andauern. Seit dem Aufkommen dieser Jugendkultur in den späten achtziger Jahren hat sich der Anteil der Jugendlichen, die diese Drogen ausprobiert haben, sowie die Häufigkeit des Konsums zugenommen, ist aber auf eine relativ kleine Minderheit beschränkt. Weibliche Jugendliche konsumieren dabei genauso häufig wie männliche.
Im allgemeinen haben deutlich weniger als 10% aller Jugendlichen sie ausprobiert, ein regelmäßiger Konsum ist eher ungewöhnlich. Auch bei den Drogentodesfällen liegen die Jahresdurchschnittsziffern in den meisten Ländern oft bei Null und selten höher als 10.20
Die Jugendlichen sind dabei meist sozial integriert und relativ wohlhabend. Sie wirken gesellschaftlich angepaßt, friedlich, konsum- und leistungsorientiert und sind insgesamt wenig auffällig21. Vergleicht man die Drogenprävalenz in der Gruppe Jugendlicher, die regelmäßig Technoveranstaltungen besucht, so zeigt sich, daß dort die Verbreitung aller Drogen wesentlich höher liegt als unter Jugendlichen im allgemeinen.
Abbildung 8 zeigt einen Vergleich der 12-Monats-Prävalenz in der Technoszene zwischen Deutschland und den Niederlanden 1997. Befragt wurden dabei Jugendliche, die mindestens zweimal im Monat Technoveranstaltungen besuchten. Das Alter der Befragten lag zwischen 14 - 25 Jahren. Dabei muß wieder berücksichtigt werden, daß die Befragten selektiv ausgewählt wurden, es sich zwar dem Namen nach um reprä- sentative Befragungen handelt, aber zumindest in Deutschland die genaue Größe der Techno- und Raveszene nicht annähernd bekannt ist.
Es fällt auf, daß v.a. viele Jugendliche unter 18 Jahren große Erfahrungen mit illegalen Drogen haben. Das Durchschnittsalter lag bei 19,3 Jahren, ein fünftel war unter 18 Jahre. Noch auffallender ist aber die Tatsache, daß fast alle in den letzten 12 Monaten Alkohol und 80% Tabak konsumierten. Die Verbreitung der legalen Drogen scheint als um einiges höher in dieser speziellen Gruppe zu sein.
Die Daten müssen aber relativiert werden. Für 5% der Befragten stellt ihr Drogenkonsum ein Problem dar, für den Rest bleibt es beim gelegentlichen Gebrauch, einmaligem Konsum oder abstinenten Feiern. Drogenhilfe und -arbeit sollte hier neue Konzepte insbesondere in der Prävention schaffen und neue Forschungen hinsichtlich dieses Bereiches der Jugendkultur leisten. Einige Konzepte können sich bisher schon sehen lassen. Verstärkte Aufklärung und Prävention sowie Maßnahmen wie die Safer- House-Kampagnen, in deren Konzept auch das Testen von Pillen miteinbezogen ist, erscheinen der bessere Weg, um diese jugendliche Zielgruppe zu erreichen und zu helfen. Nicht verstärkte Repression, sondern mehr Prävention sollte das staatliche Motto beim Umgang mit jungen DrogenkonsumentInnen sein..
2.3.3 Zahl der KonsumentInnen
Da Prävalenzstudien auf Umfragen beruhen, ist ihre Aussagekraft mehr oder weniger beschränkt. Eine andere Methode, um daß Ausmaß des Konsums festzustellen, ist die Auswertung von polizeilichen Daten und dem Drogenhilfesystem, in der Regel Therapieeinrichtungen und Beratungsstellen. Alle nachfolgenden Zahlen in diesem Kapitel ergeben sich deshalb aus Statistiken der Polizei hinsichtlich erstauffälliger KonsumentInnen und der Behandlungszugänge in den Drogenhilfeeinrichtungen.22
Der Vergleich auf europäischer Ebene wird auch hier wieder durch die unterschiedlichen Definitionsstandards erschwert. Manche Länder fassen alle KonsumentInnen harter Drogen zusammen, v.a. Heroin und Kokain, andere zählen nur OpiatkonsumentInnen, andere schätzen anhand der Drogentoden die Anzahl der GebraucherInnen, so z.B. in Finnland. Den reinen Heroinabhängigen gibt es dabei in der Praxis fast nicht mehr. Vielmehr wird alles konsumiert, was high macht. Dieser polyvalente Gebrauch von illegalen ebenso wie von legalen Drogen, v.a. Alkohol und Medikamente, bringt große Risiken für die KonsumentInnen mit sich.
In Belgien schätzt man bei einer Population von 10 Millionen die Anzahl der KonsumentInnen harter Drogen auf 16.000. Andere Zahlen gehen von bis zu 60.000 GebraucherInnen aus. Die meisten intravenös Gebrauchenden wohnen in der Haupt- stadt Brüssel.23
Dänemark gibt 12.000 GebraucherInnen von harten Drogen an, sowohl Opiat- als auch Amphetamin und Kokainabhängige. Andere Schätzungen gehen bis auf 15.000 GebraucherInnen. Die Anzahl der CannabiskonsumentInnen liegt bei ca. 300.000 - 500.000, wobei hier auch GelegenheitsgebraucherInnen subsumiert werden.24
KonsumentInnen harter Drogen
(Abbildung 9)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für Deutschland werden 150.000 Personen geschätzt, die intravenös oder hochfrequentiert illegale Drogen, v.a. Heroin, konsumieren. Die meisten davon sind Männer, ca. 75%, die häufigste Applikationsform ist intravenös. Die Anzahl der CannabiskonsumentInnen wird auf 2,1 Millionen, die der regelmäßigen Gebraucher-Innen auf 270.000 geschätzt25. Hinzu kommt eine hohe Dunkelziffer. Vergleicht man die Zahlen mit Vorjahresdaten, so ist der Konsum von Heroin stagnierend, bei Cannabis, synthetischen Drogen und Kokain ansteigend.
In Finnland werden unter 1000 Opiatabhängige geschätzt, so daß dort aufgrund der kleinen Zahl keine genaueren Untersuchungen durchgeführt wurden.
Frankreich hat nach neusten Schätzungen 160.000 Abhängige, bei denen Heroin, 70% gebrauchen es i.v., als Hauptdroge indiziert wurde26. Andere Zahlen liegen nicht vor.
Irland hat bei einer Einwohnerzahl von 3,5 Millionen den höchsten Anteil von Opiatabhängigen an der Bevölkerung angegeben. Die meisten leben in Dublin.
Luxemburg schätzt die Zahl der risikoreichsten DrogengebrauchernInnen, die meisten i.v. OpiatmißbraucherInnen, auf 2000, fast alle befinden sich in der Hauptstadt.27
In den Niederlanden leben zwischen 25.000 und 28.000 harte DrogengebraucherInnen. Hinzu kommen ca. 35.000 meist jüngere EcstasykonsumentInnen vorwiegend aus der Techno- und Houseszene, beide Gruppen konzentrieren sich v.a. auf die Städte Amsterdam, Rotterdam, Uttrecht und Den Haag28. Die meisten Abhängigen sind, wie auch in fast allen europäischen Ländern, polytoxikoman. Im Vergleich zu den anderen Ländern der EU ist die häufigste Form des Konsums von Heroin nicht der intravenöse Gebrauch, sondern die weniger risikoreiche Art des Rauchens. Kamen29beschreibt, daß eine große Problemgruppe drogenabhängige Ausländer, v.a. aus Deutschland und Frankreich, sind. Auf 7.000 Abhängigen in Amsterdam kommen allein 1.000 aus Deutschland. Er fordert deshalb eine verstärkte länderübergreifenden Zusammenarbeit bei dem Hilfsangebot für diese Gruppe der sogenannten "Drogentouristen". Der Grund wird in der liberalen Gesetzgebung gesehen, welche es aufgrund der niedrigeren Preise attraktiv macht, in die Niederlande "zum Einkaufen“ zu fahren.
In Österreich gibt es keine genaueren Zahlen der KonsumentInnen harter Drogen. In Wien wird die Zahl der Heroinabhängigen auf 6000 geschätzt, bei einer Einwohnerzahl der Hauptstadt von 1,6 Millionen.30
Portugal geht von 40.000 bis 80.000 Heroinabhängigen aus, die meisten von ihnen injizieren. 80% Prozent sind männlich, ungefähr die Hälfte von ihnen lebt in Lissabon, ein Viertel in Porto.31 In Spanien gibt es 80.000 bis 130.000 Drogenabhängige. 41.000 leben dabei allein in Madrid. In Behandlung des Drogenhilfesystems befinden sich derzeit 38.000 Personen, die meisten von ihnen gebrauchen Heroin und injizieren.32Die Verbreitung von Cannabis ist sehr groß im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern, synthetische Drogen sind noch nicht so populär, der Trend geht hierbei aber nach oben.
In Großbritanien geht man von 70.000 - 90.000 KonsumentInnen von harten Drogen aus,33andere Schätzungen verweisen allein auf 40.000 bis 75.000 intravenös gebrauchende OpiatkonsumtInnen.34
Schweden hat bei einer Einwohnerzahl von 8,7 Millionen 14.000 - 20.000 harte DrogenmißbraucherInnen.35Das injizieren von Amphetaminen stellt die größte Gruppe da.
Für Griechenland konnten keine neueren Zahlen ermittelt werden. Laut Thamm36sind 25.000 Menschen heroinabhängig. In den 90er ist von einem geringen Ansteigen der Zahlen auszugehen.
In Italien liegt die Zahl der Opiatabhängigen zwischen 190.000 - und 313.000, was bei einer Population von 57 Millionen eine große Gruppe ist. 85% sind männlich, wobei die häufigste Form des Gebrauchs (88%) intravenös ist.37
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.3.4 Zahl der Drogentoten
Dieser Abschnitt befaßt sich mit der Anzahl der Drogentoten, die in allen Ländern erheblich schwankten. Die Zahlen lassen sich von Land zu Land auch nur bedingt vergleichen, da unterschiedliche Kriterien für die Erfassung angewandt wurden. In Portugal zählen nur Drogentodesfälle, die direkt in Verbindung mit einer Überdosis stehen, Deutschland faßt Fälle einer direkten Überdosis, Tod nach langjährigem Drogengebrauch, Selbstmord sowie tödliche Unfälle in Verbindung mit illegalen Drogen zusammen.
In fast allen Staaten in der EU stieg die Zahl der Drogentoten Ende der 80er massiv an, erreichte Anfang der 90er ihren Höchststand und war später rückläufig. Grund hierfür ist das Greifen von schadensminimierenden Maßnahmen wie Spritzentausch und die Ausweitung von Substitutionsprogrammen in den EU-Mitgliedsstaaten.
Portugal und Dänemark erreichen aber 1997 ihren bisherigen Höchststand.
Die meisten Drogentoden in Zusammenhang mit einer Überdosis sind intravenös gebrauchende HeroinkonsumentInnen. Die Sterblichkeit von
Opiatabhängigen ist 10 bis 30mal höher als im Vergleich zu der entsprechenden Altersgruppe, die keine Drogen gebraucht. Demgegenüber ist das Mortalitätsrisiko geringer, falls nicht injiziert sowie Mischkonsum mit anderen Drogen, insbesondere Alkohol und Beruhigungsmittel, vermieden wird. Tod in Zusammenhang mit synthetischen Drogen ist eher selten.38
Deutschland ist das Land mit den meisten Drogentoden in Europa, gefolgt von England und Italien. Um den Zahlen etwas mehr Aussagekraft zu verleihen, werden sie im Bezug zur Einwohnerzahl gesetzt. Für die Jahre 1991 und 1997 ergibt sich folgender Vergleich:
Drogentote pro hunderttausend Einwohner (Abbildung 11)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für 1997 liegen leider nicht von allen Ländern Daten vor. Gemessen an der Belastungszahl (Rauschgifttodesfälle pro 100.000 Einwohner) ist Dänemark am stärksten, Frankreich mit 0,4, am geringsten betroffen.
Die Zahl der Drogentoden in der ganzen EU verläuft ähnlich wie die Entwicklung in Deutschland. Seit 1980 starben in der BRD ca. 18700 Personen an den direkten Folgen des Rauschgiftkonsumsm, EU-weit ca.71.000.39
Versucht man die Größenordnung des Drogenproblems einzuschätzen, indem die Zahlen in Relation zu anderen Todeszahlen wie den Opfern des Straßenverkehrs, des Alkoholkonsums und den Selbstmordopfern gesetzt werden, ergibt sich dieses Bild:
Demnach sterben in der Bundesrepublik jährlich ca. 14.000 Personen bei Unfällen im Haushalt, 1998 starben 18.885 Personen an den direkten Folgen des Alkoholkonsums, was mehr ist als die Zahl der Drogentoten weltweit. Jährlich versuchen 20.000 Menschen ihrem Leben ein Ende zu setzen, 12256 schafften dies letztes Jahr auch.40
2.3.5 Menge der beschlagnahmten Drogen
Beschlagnahmte Menge an Cannabis in Europa (Abbildung 13)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als letzte Bestandsaufnahme zum Ausmaß der Drogenproblematik, dient die Menge der beschlagnahmten Drogen und der darauf bezogenen Schätzung der tatsächlich vorhandenen Drogenmenge:
Menge des beschlagnahmten Heroins in Europa (Abbildung 14)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Menge der beschlagnahmten Drogen erscheint relativ hoch. In Deutschland wurden allein 1997 knapp 730 kg Heroin, 1,7 Tonnen Kokain, 700.000 Pillen Ecstasy sowie 11,5 Tonnen Cannabis sichergestellt.41Holland ist bei Cannabis mit 81 Tonnen, Großbritannien mit 2,2 Tonnen Heroin und Spanien mit 18 Tonnen Kokain Spitzenreiter bei der Menge der sichergestellten Drogen.42
Beschlagnahmte Menge an
Amphetaminen in Europa (Abbildung 16)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nicht alle in diesen Ländern sichergestellten Drogen sind nur zum Verbrauch der dort einheimischen DrogenkonsumentInnen bestimmt. Länder wie Holland aber auch Deutschland sind ebenso Durchgangsländer, in denen die Drogen eingelagert werden, bestimmt in kleineren Mengen für andere Länder.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Oftmals werten spektakuläre Einzelfunde die Gesamtmenge erheblich auf. Am 12. 4.1994 wurden 10 Tonnen Haschisch in einem Container in Hamburg sichergestellt.43Ein anderer Grund für zunehmende Sicherstellungsmengen ist der erhöhte Fahndungsdruck der Behörden durch qualifizierteres Personal.
Als Trend zeigt sich, daß in fast allen Staaten der EU die Sicherstellungsmenge von Kokain sich seit den 80er Jahren verzehntfacht, die Menge von Heroin verdoppelt oder verdreifacht und von Cannabis siebenmal vergrößert hat. Kokain liegt dabei Ende der 90er weit über den Mengen von Heroin und zeigt, daß es in größerem Umfang verfügbarer ist als Heroin. In den Statistiken der Hilfeeinrichtungen ist aber Heroin nach wie vor die Hauptproblemdroge. Dies zeigt, welche Dunkelziffer im Bereich der Verbreitung von Kokain in der EU herrscht und das viele KokaingebraucherInnen oftmals sozial unauffällig über Jahre konsumieren.
Die Sicherstellung von Amphetaminen und Ecstasy hat sich in den letzten Jahren ebenfalls vervielfacht. Die größten Mengen wurden in Großbritannien beschlagnahmt. Diese Drogen werden dabei teilweise in der EU selbst produziert, v.a. in den Niederlanden. Von den 1997 sichergestellten Ecstasypillen in Deutschland stammt ein siebtel aus Holland.44
Wird die vorhandene Drogenmenge mit dem geschätzten Bedarf berechnet, kommt die Literatur45zu dem Ergebnis, daß nicht mehr als 5 - 15% der umlaufenden Drogen beschlagnahmt werden.
"Die vorliegende Beschlagnahmequote, die aus der Szene bekannte hohe Verfügbarkeit aller Drogen, die enormen Vorräte und die Folgenlosigkeit von Beschlagnahmungen im Preisniveau lassen erwarten, daß sich das Angebot an illegalen Drogen qualitativ und quantitativ auf sehr hohem Niveau etabliert hat. Die Drogenversorgung stieg in Europa kontinuierlich, was vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Profite verständlich erscheint."46
Der Reinheitsgehalt der beschlagnahmten Drogen liegt in Deutschland bei den verschiedenen Substanzen für Heroin zwischen 20 und 40%, Kokain 20 bis 70% und Amphetaminen 30 bis 90%.47Fast alle Ecstasypillen enthielten neben verschiedenen psychotropen Wirkstoffen zusätzlich Strecksubstanzen wie Lactolose oder Paracetamol. Bedingt durch den Schwarzmarkt werden alle Drogen gestreckt und durch andere Substanzen verunreinigt, die KonsumentInnen gehen ein höheres Risiko ein, da niemand weiß, was er/sie gerade zu sich nimmt. Körperliche Schädigungen sind nicht die einzigen Folgen des Drogengebrauchs: Der nächste Abschnitt befaßt sich mit den Auswirkungen des Drogenkonsums für den einzelnen und die Gesellschaft
2.4 Folgen des Drogenkonsums
Den/die typischen DrogenkonsumentenInnen gibt es dabei nicht. So unterschiedlich wie die Drogenwirkungen ist auch der Mensch, welcher die Droge zu sich nimmt. Rausch48beschreibt das Drogenproblem als ein “Problem der Drogenwirkung, ausgehend vom Potential der Droge, Applikationsform und der Konstitution der Konsumenten, in entscheidenden Teilen aber auch ein Problem von Drogenpolitik und Drogenarbeit.”
Dabei sind immer noch in weiten Teilen der Gesellschaft verschiedene Klischees vorhanden. “Haschisch ist eine hinterlistige Droge und öffnet das Tor zur Hölle.” , so Günther Beckstein 1993 über Haschisch und seine Folgen.49
In manchen politischen Diskussionen in den 90er wird immer noch der Mythos von der Einstiegsdroge Haschisch aufrechterhalten. Die KonsumentInnen “harter” Drogen haben zuerst Cannabis konsumiert, wird in die nicht richtige Tatsache umgekehrt, daß Haschisch zwangsläufig zum Konsum von Heroin führe. Tatsache ist, daß nur 3% der HaschischkonsumentInnen auf härtere Drogen zurückgreift. Weit verbreitet ist dagegen der Mischkonsum von legalen und illegalen Drogen. Einige Studien zeigen, daß früherer Alkoholkonsum eine deutlich höhere Lebensprävalenzrate für jeglichen Drogenkonsum hat.50
Die meisten Länder der EU geben an, daß Opiate, v.a. Heroin, das größte Problem mit den schwerwiegendsten Folgen für die KonsumentInnen und der Gesellschaft darstellen. 70% - 85% der Behandlungsneuzugänge in der Therapie51befassen sich mit Opiatabhängigen. Dabei greifen die OpiatkonsumentInnen meist auch zu anderen Drogen, sowohl legale als auch illegale, insbesondere Kokain, Alkohol und Schlaftabletten, da ihre Primärdroge nicht 29 immer verfügbar ist. Dieser polyvalente Mißbrauch verursacht die größten Probleme.
In einigen nordeuropäischen Ländern stellt nicht der Opiatgebrauch, sondern der intravenöse Konsum von Amphetaminen mit den gleichen Erscheinungen wie bei Heroin die größte Problemgruppe dar.52 Allgemein zeigt sich, daß beim intravenösen Gebrauch der dafür bestimmten Drogen (v.a. Heroin und Kokain), die schwerwiegendsten Folgen für den/die Konsumenten und der Gesellschaft auftreten. Im Gegensatz zu den USA: Hier ist das größte Problem das Rauchen von Crack.
2.4.1 Individuelle Folgen
In der Literatur wird, insbesondere verursacht durch eine repressiv geführte Drogenpolitik, auf zwei wesentliche Folgen für den/die KonsumentIn hingewiesen53:
- einmal eine massive Kriminalisierung der DrogenkonsumentInnen mit ihrer Folgeerscheinung der Stigmatisierung und Ausgrenzung durch die Gesellschaft
- zum zweiten eine starke gesundheitliche und soziale Verelendung, v.a. bei Heroinabhängigen. In der Kriminologie wird durch die Labeling-Theorie überzeugend dargestellt, wie eine frühzeitige soziale Sanktionierung und Bestrafung eine kriminelle Karriere fördert und den/die meist jugendlichen DrogengebraucherIn stigmatisiert und sozial ausgegrenzt. Ein Schulverweis wegen Haschischkonsums oder der Rausschmiß des mit Drogen experimentierenden Jugendlichen aus dem Elternhaus kann eine kriminelle Drogenkarriere verfestigen und zu einem sozialen Abstieg führen.
Der/die KonsumentInnen von Heroin haben, insbesondere bedingt durch die Prohibition, einen enormen Finanzbedarf zur Beschaffung der Droge. Dieser wird im hohen Maße durch Dealen finanziert. Die Opfer werden zu Tätern. Verurteilungen betreffen insbesondere Kleindealer, die zumeist selbst süchtig sind, und nicht die Großhändler, die die eigentliche Zielgruppe der Prohibiton sein sollten.
In Deutschland wurden 1997 insgesamt 209.008 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) gezählt, die seit Jahren ansteigen, was das BKA als Ausdruck des Erfolges der Maßnahmen aller Rauschgiftbehörden wertet. Bei 44% der Fälle ist Besitz von Cannabis, bei 25% Heroin der Grund, in 80% der Fälle wegen konsumorientierter Beschaffung.54Die Prohibition erzielt ihre Erfolge in erster Linie durch die Bestrafung einfacher KonsumentInnen mit der Folge, daß diese durch die Kriminalisierung zunehmend stigmatisiert und von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, damit aber erst recht in eine kriminalisierte Drogenszene abrutschen Die gesundheitlichen Folgen des Drogenmißbrauchs hängt, wie eingangs erwähnt, von der verwendeten Substanz und der Gebrauchsform ab. Wurde Cannabis in den 60er Jahren noch verdammt, bescheinigen heute die meisten medizinischen Studien, daß in der Relation zu Alkohol und Tabak davon ein eher geringes Risiko für den Körper ausgeht. Bei exzessiven Konsum, der aber nur von einer kleinen Minderheit betrieben wird, kann es aber zu einer Gewöhnung an die entspannende Wirkungsweise kommen.55Ob dies nun gefährlich ist oder nicht, hängt von der Person selbst ab, wie sie ihren Konsum erlebt.
Bei harten Drogen wird, abgesehen von der körperlichen und psychischen Gewöhnung, in der Medizin davon ausgegangen, daß v.a. bei Opiaten bei korrektem Gebrauch und reinen nicht “gestreckten” Drogen eine relativ geringe Gefahr besteht. Untersuchungen in der Schweiz zeigen, daß durch staatliche Vergabe reinen Heroins sich der Gesundheitszustand bei 70% der Patienten entscheidend verbessert hat.56
Erst im Zuge der Kriminalisierung werden durch den Verkauf der Drogen auf dem Schwarzmarkt das Risiko einer gesundheitlichen Schädigung verstärkt. Die auf dem illegalen Markt erworbenen Substanzen haben meist eine unbekannte Wirkstoffkonzentration. Vom Produzenten zum Kleindealer werden sie mehrmals “gestreckt”, d.h. mit anderen Chemikalien und Stoffen versetzt, um die Gewinnspanne zu maximieren. Für die KonsumentInnen bedeutet dies ein unkalkulierbares Risiko. Sie wissen nie, was sie konsumieren. Die Mehrzahl aller Drogentodesfälle passiert durch den Umstand, die Droge nicht mit der gewünschten Wirkung dosieren zu können. Ist der Stoff zu rein, kann es zu einer Überdosis kommen, da zuvor nur gestreckte Drogen konsumiert wurden. Führt z.B. Heroin zum Tode, geschieht dies meistens, weil gewissenlose Gauner nicht darauf achten, welche Qualität sie verkaufen Böllinger57faßt die Folgen für intravenös gebrauchende Opiatabhängige wie folgt zusammen: - “Akute gesundheitliche Leiden (Spritzenabzesse, Venenentzündungen, Zahnverfall, Blutvergiftung, Überdosierung) und schwere chronische Erkrankungen, die teilweise gar nicht oder zu spät behandelt werden (Hepatitis, Geschlechtskrankheiten, AIDS);
- Vernachlässigung der Hygiene und Selbstfürsorge (Essen, Waschen, Kleidung, Körperpflege) infolge des ständigen Beschaffungs- und Verfolgungsdrucks;
- zunehmender Mischkonsum von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, da nicht genug Geld für die Droge aufgebracht werden kann und Entzugssymptome bekämpft werden müssen;
- hohe psychische Belastung durch Angst vor Verfolgung, Beschaffungsdruck und Prostitution unter ungeschützten Bedingungen
- Obdachlosigkeit bzw. wechselnde, kurzfristige Unterkünfte im Drogenmilieu
- soziale Isolation und Vereinsamung, da aufgrund der sozialen Ausgrenzung von HeroingebraucherInnen meistens Kontakte zu Familien, Freunden, Bekannten außerhalb der Szene abreißen und innerhalb der Szene die sozialen Bezüge von Zwängen der Drogenbeschaffung bestimmt sind.”
Mißtrauen, Betrug und Angst kennzeichnet die Drogenszene. Dies wiederum verstärkt die Isolation und erhöht die Wahrscheinlichkeit, den anfänglich kontrollierten Gebrauch aufzugeben und in die Sucht abzugleiten.58
Die Prohibition beschneidet die Chance, mit Drogen risikobewußt umzugehen. Bedingt durch den hohen Preis wird auf risikoarme Konsumformen , z.B. Rauchen oder Inhalieren, verzichtet, da dafür eine höhere Menge notwendig ist. Mit Ausnahme der Niederlande gebrauchen 40% - 80% der Abhängigen von harten Drogen, insbesondere Heroin, in Nordeuropa v.a. Amphetamine, die Substanz intravenös und setzen sich der risikoreichsten Konsumform aus.
So verabreicht, kann es leicht zur Überdosierung, hoher körperlicher Schädigung, wie bei Böllinger beschrieben sowie zur Übertragung von AIDS und Hepatitis kommen, da in einigen Ländern immer noch das Tauschen der Nadel unter Abhängigen weit verbreitet ist. In Dänemark haben 50% der i.v.-User Hepatitis C, in Deutschland 44%, in Irland 84%. Bei 63% aller AIDS-Fälle in Italien haben sich die Infizierten zuvor Heroin gespritzt, in Deutschland sind dies 14% aller Fälle, in den Niederlanden 10%.59
Für einige Personen werden insbesondere harte Drogen zum Problem. Obwohl neueste Studien zeigen, daß die KonsumentInnen mit reinem Heroin alt werden können, sollte doch berücksichtigt werden, daß ein sehr geringer Prozentsatz nicht in der Lage ist, ihr Leben selbständig zu verwirklichen und einen kontrollierten oder genußorientierten Gebrauch zu finden. Egal ob die Droge verboten oder erlaubt ist. Dies darf nicht unterschätzt werden.
Viele KonsumentInnen könnten ihren Konsum aber steuern und kontrollieren und ihr Leben selbst bestimmen, wären bestimmte Barrieren, die durch die Prohibition eingeführt werden, nicht vorhanden. Beschaffungsdruck, Spritzentausch ("Needle-Sharing"), v.a. in den südlichen Ländern Portugal, Spanien und Italien, mit seinen Folgen AIDS und Hepatitis, sowie die Kriminalisierung wegen Kleinstdelikte oder Prostitution würden bei einer Entkriminalisierung der KonsumentInnen gemindert.
2.4.2 gesellschaftliche Folgen
Es sind nicht nur KonsumentInnen und Abhängige, welche unter den Folgen leiden; auch die nicht direkt betroffene Gesellschaft spürt die Auswirkungen der Drogenproblematik und wird von ihr durch enorme gesamtgesellschaftliche und volkswirtschaftliche Folgekosten in Millionenhöhe in Mitleidenschaft gezogen. Da sind zunächst die Beschaffungs-, Begleit- und Folgekriminalität, die Kosten des Strafvollzugs und der notwendig erachteten Therapiemaßnahmen, aber auch indirekte Kosten wie Wegfall der Arbeitsfähigkeit.
Eine relativ kleine Zahl von Drogenabhängigen kostet den sozialen Netzen in den einzelnen Ländern viele Millionen EURO für Rehabilitationsmaßnahmen und medizinischen Leistungen.60 Hinzu kommen die finanziellen Belastungen, die im Zuge der Beschaffungskriminalität entstehen. “Ein Junkie braucht am Tag 100 bis 150 Mark für seinen Stoff, Millionen muß die Szene tagaus, tagein zusammenraffen. Höchstens jede fünfte Mark stammt aus legalen Quellen.”61 Bei süchtigen Frauen stammt jede zweite Mark aus der
Prostitution. Der hohe Finanzbedarf der Süchtigen muß durch kriminelle Delikte abgedeckt werden und kommt den Gewinnen der Drogenmafia zugute.
Dealerei, Ladendiebstähle, Auto- und Wohnungseinbrüche, Rezeptfälschung, Betrug, Straßenüberfälle auf Passanten sind 1998 die häufigsten Delikte in Deutschland.62Ähnlich gestaltet sich die Situation in England und in den Niederlanden.63In den meisten südeuropäischen Ländern gibt es keine Untersuchungen in dieser Richtung. Hinzu kommen die Kosten, um den durch die Illegalität bedingten Verfolgungsapparat am laufen zu halten Hinsichtlich der ökonomischen Auswirkungen der Prohibition gibt es fast keine Untersuchungen. In Deutschland befaßt sich eine einzige Studie mit diesem Thema. Der Bochumer Ökonom Prof. Hartwig stellte 1997 fest, daß “der vergebliche Kampf gegen das verbotene Heroin die Gesellschaft 13 Milliarden Mark im Jahr”64kostet. Er beurteilt den ökonomischen Nutzen der Prohibition als nicht nur unnütz, sondern sogar als schädlich.
Gesellschaftliche Kosten der Prohibition (Abbildung 18)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese Studie befaßt sich nur mit den Auswirkungen des Heroinverbotes und berücksichtigte nur die niedrigsten Zahlen bei der Berechnung. Sie wurde auch nie veröffentlicht und nur mit geringen Mitteln bezahlt, so daß eine kontinuierliche Arbeit nicht möglich war. Wird von allen illegalen Drogen sowie von Durchschnittszahlen ausgegangen, dürften die gesellschaftlichen Gesamtkosten wesentlich höher liegen.
Warum die Bundesregierung unter Leitung des Gesundheitsministeriums solche Studien nicht laufend betreibt, ist eine Frage, die nur damit beantwortet werden kann, daß sich sonst die Regierung eingestehen müßte, daß ihre bisherige Politik nicht den Nutzen erwirtschaftet, den sie gerne in ihren Pressemitteilungen und Debatten vorgibt zu leisten.
3 Drogenmarkt
Ausgehend, wie sich das Drogenproblem innerhalb der EU äußert, mit welchen Folgen für die KonsumentInnen und der Gesellschaft, muß als nächster Schritt beleuchtet werden, wie der Drogenmarkt funktioniert. Es handelt sich um eine Analyse der Angebotseite der Drogen. Der internationale Weltmarkt der Drogen ist kein national begrenzter Markt, der leicht überschaubar und kontrollierbar ist. Aufgrund seiner Illegalität und Komplexität scheint er, der zumeist national geführten Bekämpfung eventuell überlegen.
3.1Der weltweite Drogenmarkt
Laut dem Drogenreport der Vereinten Nationen, beläuft sich der Umfang des weltweiten Handels mit illegalen Substanzen auf 700 Milliarden Mark jährlich.65Seit den 60er bis heute hat sich ein international operierender Wirtschaftsapparat herausgebildet, der bereits 8 Prozent des Welthandels bestimmt, mit Renditen, von denen die legal geführten Unternehmen nur träumen. Es ist die größte Wachstumsbranche der Welt. Der Deutsche Markt beläuft sich auf sechs Milliarden jährlich und ist damit der größte in der EU, gefolgt von England.66
Der Weltdrogenhandel, besonders von Lateinamerika in den größten und reichsten Markt, den USA, ist fast so groß wie der von Weizen. Die US Regierung ist machtlos und gibt gewaltige Summen für ihren “War of Drugs” aus.
Der heute professionell betriebene Drogenhandel findet zumeist grenzüberschreitend statt. Ausgehend von den Anbauländern werden die Drogen über Tausende von Kilometern in die Abnehmerländer, v.a. den USA und der EU, eingeschmuggelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies direkt oder über Umwege geschieht. Für die Drogenmafia muß die Ware nur ankommen. Beispielsweise kommt so manches Kilo Kokain aus Kolumbien nicht direkt über den Seeweg nach Europa, sondern wird zunächst nach Südafrika verschifft, um dann via Flugzeug über Nigeria nach England und später nach Deutschland eingeschmuggelt zu werden.67
Nach Thamm68erfolgt der Drogenschmuggel:
- über die sogenannten Transitländer69auf dem Landweg
- auf dem Wasserweg über die Hauptschiffahrtsrouten oder auf Alternativwegen
- auf dem Luftweg, Haupt- oder Nebenrouten
- innerhalb Europa auch auf den Schienenwegen der Eisenbahnen
Drogen werden praktisch über alle verfügbaren Transportmöglichkeiten in die Konsumländer eingeschmuggelt. Das Vorgehen der gut organisierten Banden ist dabei professionell und zumeist dem polizeilichem Verfolgungsapparat weit überlegen. Supp70schreibt in ihrem Rauschgiftreport, daß sich ein Drogenfahnder seinen Laptop-Computer selbst kaufen mußte, um technisch auf dem neusten Stand zu sein. Arme Polizei gegen reiche Dealer!
Sie benutzen die Handelswege, die Kommunikationsmittel und die Finanzströme der Weltwirtschaftsordnung geschickt für ihre Zwecke. Handys wurden schon lang vor der Polizei benutzt, ebenso wie das Internet, über das vor der Polizei geschützte Daten um die ganze Welt gesendet werden können.
3.2 Der einheitliche Drogenmarkt der EU
Nicht erst seid dem Wegfall der Binnengrenzen innerhalb des EU durch das Schengener Abkommen71von 1985, welches 1995 in Kraft trat, betrachten die Drogenhändler die EU, aber ebenso ganz Europa, als den nach den USA lukrativsten Absatzmarkt für ihre Ware. Über den Landweg durch Spanien, per Flugzeug nach London oder Frankfurt oder per Schiff über die großen Seehäfen, z.B. Rotterdamm, Hamburg, Marsaille. Aus allen Richtungen werden die Drogen in die EU-Staaten transportiert.
Bereits in den siebziger und achtziger entdeckte das gut organisierte Verbrechen den Markt Europa für Drogen und versuchte dort Handelsbeziehungen aufzubauen oder auszuweiten. Die Mafia in Italien verdiente in diesen Jahren einige Millionen DM. Interpol schätzt, daß für 70 t harte Drogen in der EU ca. 17 Mrd. DM ausgegeben wird sowie 36 Mrd. DM für 4000 t Cannabis.72Der Umsatz von Drogen liegt demnach bei 53 Mrd. DM im Jahr.
Deutschland ist dabei der kaufkräftigste Absatzmarkt, ein bedeutender Hersteller chemischer Grundstoffe, die für die Drogenproduktion benötigt werden, ein Transitland und eines der bevorzugten Länder zur Geldwäsche.
Seit Jahren operiert das organisierte Verbrechen in der EU vornehmlich in den ärmeren Mitgliedsstaaten und benutzt die Handelswege, um ihren Markt auszubauen. Thamm73beschreibt dies wie folgt:
- Seit Jahrhunderten operiert die in Süditalien beheimate Mafia im europäischen Raum. Sie ist heute wie auch die Camorra in Neapel im internationalen Drogengeschäft involviert und unterhält Beziehungen zum Nahen Osten ebenso wie zum Balkan.
- Chinesische Auswanderer in Europa, v.a. in Amsterdam und London, machen Drogengeschäfte durch ihre Verbindungen zu den Triaden in Fernost und beliefern den Markt v.a. mit Heroin.
- Kolumbianer bauen und bauten den Kokainmarkt in der EU von Spanien aus auf und bringen, ausgehend von einigen Städten (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante und Marbella), ihre Ware auf den europäischen Markt.
- Türkische Drogenchefs und -banden sind in halb Europa zu finden, um Heroin über ihre Heimat aus Asien nach Europa einzuschmuggeln.
Die Binnengrenzen haben das organisierte Verbrechen nicht davon abgehalten, auch diesen Markt für sich zu entdecken und Anfang bis Ende der 70er aufzubauen und Ende der 90er bis in alle Bereiche gut zu funktionalisieren. Fällt der Blick auf die Außengrenzen der EU mit allein 10.000 Kilometer Küste in Spanien, erscheint es ganz klar, daß nur etwa 10% der Drogen sichergestellt werden können. Die Unmöglichkeit einer absoluten Abschottung sollte der Politik gewiß sein, selbst wenn in den nächsten Jahren die Grenzkontrollen durch mehr Gelder und Polizei verstärkt werden.
3.3 Angebot und Nachfrage als Marktmechanismus
Drogen sind ein Objekt der Marktwirtschaft geworden. Der weltweite Drogenmarkt funktioniert nach dem legalen Mechanismus einer freien Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Die Nachfrage wird angeheizt durch aggressive Werbung, wie etwa bei Kokain als “schicke Droge für die Szene, durch großzügige Einführungsrabbaten, notfalls auch mit nacktem Terror geregelt.”74
Der Drogenhandel ist gut organisiert und sehr profitabel. Die steuerbefreiten Unternehmer, welche ihn leiten, marschieren mit mehr und mehr Waffen und Aufpassern auf, um ihre Marktanteile gegenüber Mitbewerbern zu schützen. Die Polizei und der Zoll nimmt an, das nur ein Zehntel der vermuteten Drogen sichergestellt wird. Die staatliche Drogenpolitik der Prohibition ist somit zu 90% ein Mißerfolg.
Im Moment wird ein sinnloser Krieg gegen Drogen geführt, den es nicht zu gewinnen gibt. Der Markt ist beides, illegal, aber sehr profitabel. Um im Geschäft zu bleiben, müssen die Händler Gewalt anwenden und ihren Profit in Waffen stecken. Es gilt zu bedenken, daß die illegale Versorgung allein deshalb existiert, um Bedürfnisse zu befriedigen. Sollten Menschen nicht nach Drogen verlangen, gäbe es auch keinen Markt dafür.
Fast alle heute illegalen Drogen waren irgendwann einmal frei verkäuflich auf dem Markt zu haben, während die heute legalen Drogen in der Geschichte irgendwann einmal verboten waren. Es lassen sich heute zwei Märkte beobachten, welche sich eigentliche nur durch ihre Stellung im Gesetz unterscheiden: Der legale Pharmamarkt und der illegale Drogenmarkt. In beiden Industriezweigen werden Herstellung, Vertrieb und Verkauf selbst in die Hände genommen. Beide stiegen in den letzen Jahrzehnten zu internationalen Multikonzernen auf, mit großem Einfluß auf Politik und Wirtschaft. Die Pharmaindustrie benutzt ihren Einfluß, um ihre Produkte weiterhin attraktiv auf den Markt zu bringen, die Verbrecherindustrie des illegalen Drogenmarktes nimmt durch Korruption Einfluß auf die Politik, um ungestört ihre Geschäfte tätigen zu können.75
Hat der Staat bei Pharmaprodukten noch den Einfluß, über Produktbesteuerung, Lizenzvergabe, Staatsmonopol und andere Maßnahmen einen begrenzten Einfluß zu nehmen, so entzieht sich dem illegalen Drogenmarkt fast jede Interventionsmöglichkeit. Rausch beschreibt, daß “durch die Prohibition und der damit verbundene Verzicht auf alle anderen Steuerungsmöglichkeiten die Gesellschaften den Markt mit seinem ungleich verteiltem, freiem Spiel der Kräfte sich selbst überlassen, verzichten damit auf jeglichen Verbraucherschutz und konstituieren eine freie und unsoziale Drogenmarktwirtschaft.”76
3.4 Die Händler und Produzentenseite
Der Handel wird von verschiedenen Gruppen des organisierten Verbrechens77in die Hand genommen, die in verschiedenen Regionen der Welt tätig sind, um ihre Geschäfte zu leiten. Die wichtigsten sind:
- Kokain-Kartelle in Kolumbien und Mexiko
- Triaden aus Honk Kong und Tawain in China
- Yakuza in Japan
- Cosa Nostra in Sizilien und New York
- Mafiagruppen in Rußland und anderen Osteuropäischen
Ländern
Sie sind hierarchisch geführte Organisationen. An die großen Bosse ist meist nicht heranzukommen, da diese nicht direkt mit dem Handel in Verbindung stehen. Der Fahndungserfolg der amerikanischen Behörden im Falle Escobar in Kolumbien ist ein Einzelfall.
Beispiel des Organisationsaufbaus eines Drogenkartells (Abbildung 19)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Lateinamerika, v.a. Kolumbien und Bolivien ist ,ähnlich wie die Mafia in Italien, der Handel und die Produktion von illegalen Drogen gut organisiert und ausgebaut. In Kolumbien zum Beispiel importieren Unternehmer die Kokablätter und verarbeiten sie zu Pulver, dem Kokain, um sie auf raffiniertem Wegen in die USA und in die EU zu exportieren. Die Gewinnspanne geht ins unermeßliche und vertausendfacht sich etwa vom Produzenten über den Großhändler und Importeur bis zum Kleindealer auf der Straße, Die Profite sind mit legalen Geschäften nicht mach- und vergleichbar.
Verteilung der Gewinne aus dem Drogengeschäft
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
70.000 Bauern leben allein in Bolivien vom illegalen Kokaanbau, 10.000 Dschungellabors verarbeiten es zu Kokain.78Dabei bedeutet der Anbau für viele Menschen die einzige Alternative, um ein Leben ohne Hunger zu führen, Trotz Entwicklungshilfe für andere Produkte wie Orangen, Ananas oder Bananen: Kokapflanzen sind lukrativer, so daß viele Familien nur dadurch ihren Lebensunterhalt sichern können.
Die UN schätzt, daß ca. 220.000 Hektar Land für den Kokainanabau kultiviert werden, die Hälfte davon in Peru, fast ein viertel jeweils in Kolumbien und Bolivien. 300.000 Kokablätter wurden dabei 1996 geerntet, ausreichend für 3000 Tonnen Kokain.79
Durch Einschüchterung und Terror sichert die Kokainmafia in diesen Ländern, daß die Bauern weiterhin ihre Produkte anbauen, ebenso aber durch die Finanzierung von notwendigen Infrastruktureinrichtungen80wie Straßen, Schulen und Krankenhäuser. Die arme Bevölkerung wird sich daher nicht von ihren “Gönnern” abwenden und weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten.81
Hinzu kommt eine uralte, geschichtliche und kulturelle Einstellung, zu den in diesen Gebieten angebauten Substanzen. Würde die EU beschließen, daß alle Anbaugebiete für Trauben und Hopfen nun stillgelegt und vernichtet werden, wäre dies genauso ein unmögliches Vorhaben, wie das der UNO, alle Anbaugebiete für Drogen auszurotten. Es kann höchstens um eine Begrenzung der Anbauflächen für den Eigenbedarf der Region oder des Landes gehen Laut einem Bericht des Bundesnachrichtendienstes zur internationalen Lage im Drogenhandel haben sich im Laufe des Jahres 1995 die Kokaanbauflächen um etwa 19% ausgeweitet. Die Produktion wurde seit den 80er immer weiter ausgeweitet, bis eine regelrechte Überproduktion stattfand.
Die Heroinproduktion wird dabei ähnlich organisiert. So werden jedes Jahr ca. 7000 Tonnen Opium geerntet und zu ca. 500 Tonnen Heroin verarbeitet. 90% des Heroins stammt dabei aus Pakistan, aus den Ländern des “Goldenen Dreiecks”, Thailand, Laos und Burma sowie Afghanistan und dem Libanon. Es wird über die Türkei nach Europa eingeschleust und gelangt z.B. über dem Landweg von Deutschland aus in die Niederlande. Afghanistan ist dabei der Hauptlieferant für den europäischen Markt.82
Das Geschäft in Deutschland wird meist von türkischen und albanischen Banden übernommen, zunehmend drängt auch die Russische Mafia verstärkt auf diesen lukrativen Markt.
Cannabis wird hauptsächlich in der Karibik für den amerikanischen und Marokko für den europäischen Markt angebaut und ist wegen seiner geringen Gewinnspanne nicht mehr, wie noch in den 80er Jahren, die bevorzugte Verkaufsdroge, aber trotzdem überall erhältlich. Sie ist leicht zu kultivieren und wird immer mehr auch in den Konsumländern selbst angebaut. In den Niederlanden angebautes Cannabiskraut ist zu einem eigenen Produkt und Markennamen gewonnen und wird nach Deutschland und Frankreich nicht importiert, sondern, weil illegal, eingeschmuggelt.
In den Industriestaaten hat sich eine legale Industrie herausgebildet, welche den Konsum und Anbau der illegalen Droge fördert. In sogenannten “Head-Shops” findet sich von Wasserpfeifen, Jointblättchen bis zu kompletten Anbausystemen alles, was für die Kultivierung und Konsumierung an benötigten Utensilien gebraucht wird.
Ecstasy und Amphetamine werden meistens in kleinen illegalen Labors hergestellt. Die dafür benötigten Chemikalien werden von der legalen Pharmaindustrie geliefert und sind zumeist ohne Schwierigkeiten erhältlich. 60% der Labore zur Ecstasyherstellung wurden in Europa lokalisiert.83Hauptproduzent ist dabei die Niederlande, die dafür notwendigen Substanzen stammen von der chemischen Industrie aus Deutschland und der Schweiz. Bayer, Höchst, BASF als Drogenproduzenten? Nicht direkt, aber doch über Umwege.
Dies ergibt sich v.a. aus der ausgesprochen liberalen Praxis im Chemikalien-Handel. Die Grundstoffe, Reagenzien und Lösungsmittel sind relativ günstig legal zu erwerben. Auch als Hersteller von Ecstasy und Amphetamine spielt Deutschland eine Rolle. Das BKA entdeckte 1998, 15 Rauschgiftlabore, im Jahr 1997, 16.
Bedingt durch das Verbot liegen die Endpreise der Drogen für den Verbraucher so hoch, daß die KonsumentInnen unter einem hohen Finanzierungsdruck stehen. Durch ein wie eingangs bei Kokain schon erwähntes "aggressives Marketing" werden Jahr für Jahr zehntausende neue ErstkonsumentInnen hinzugewonnen.
Nach empirischen Untersuchungen werden Neulinge meistens von süchtigen Kleinhändlern aus dem Bekannten- oder Freundeskreis verführt. Das erste Probieren ist meistens ein Geschenk. Damit entfällt der durch die Prohibition eigentlich erwünschte Abschreckung durch den hohen Preis und erreicht genau das Gegenteil.84
3.5 Korruption und Geldwäsche
In einigen Dutzend Länder der Welt reicht der Einfluß der Drogensyndikate bis in die höchsten Ebenen der Regierung. Sie haben sich dort durch Gewalt und Korruption eingekauft, um in Ruhe produzieren und arbeiten zu können. Dazu gehören demokratische Länder wie Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Kenia, Indien und Pakistan, kommunistische Regime wie Kuba oder Laos, Diktaturen wie Paraguay, linke Regime wie Nicaragua, rechte wie Taiwan oder Thailand.85
Banden beherrschen ganze Städte, ohne deren Wort nichts möglich ist. Medelin oder Kali in Kolumbien, Santa Cruz in Bolivien, Guadalajara in Mexiko. Mit den Drogengeschäften finanzieren sich terroristische Vereinigungen wie die spanische Eta, Gruppen der PLO, schiitische Hisbollah, die PKK in der Türkei sowie die Contras in Nicaragua.86.
Der Einfluß des Drogengeldes, sogenannten Narco-Dollars, ist überall spürbar. Waffengeschäfte sind verfilzt mit dem organisierten Verbrechen, Regierungen und Geheimdiensten. Die jährlichen Gewinne aus dem Drogenhandel belaufen sich in Deutschland auf ca. 1,5 Milliarden DM, weltweit ca. 30 Milliarden.87Das Vermögen des reichsten Kokain-Barons beträgt ca. 3 Milliarden DM.88Wohin fließt dieses illegale Geld?
Der Spiegel beschreibt, wohin. “Von mindestens 40 Banken, darunter die größten Geldhäuser in Amerika, Europa und Australien ist bekannt, daß sie Rauschgiftmilliarden verwahren oder bewegen. Drogengeld steckt in Wolkenkratzern in Manhattan ebenso wie in Frankfurter Hochhäusern, in Touristikkonzernen und Ferienklubs, Spielkasinos und Fluglinien. Eine Drogenmafia betreibt in Amerika 8200 Hotels und Motels.”89
Die Gewinne aus den Drogengeschäften durch Geldwäsche werden einmal in den Ausbau des Unternehmens gesteckt zum anderen in legale Wirtschaftsbetriebe investiert. Von der italienischen Mafia ist bekannt, daß sie ihre illegal erwirtschafteten Gewinne in Hotels und Restaurants, Feriensiedlungen, Industrieanlagen, Supermärkten, Galerien, Weingüter und in den Straßenbau gesteckt hat.90 41
In der ganzen Welt werden die Narco-Dollars nach dem gleichen Muster gewaschen:91
- Finanzspezialisten übernehmen die Geldwäsche
- Drogenhändler und Geldwäscher sind nicht direkt miteinander verbunden
- Das Land, indem die Gewinne gewaschen werden ist nicht identisch mit dem Drogenland.
- Das Reinwaschen erfolgt zumeist über viele Transaktionen und Umwandlungsprozesse z.B. von Bargeld in Buchgeld, sowie in Anlagen und Wertpapieren wie Aktien.
- Auf diesem Weg ist der Ursprung der Vermögenswerte meist nicht mehr nachvollziehbar.
- Die Gelder gelangen dann in der letzen Phase zurück in ihr Herkunftsland und von da in den normalen Wirtschaftskreislauf. "Der Kampf gegen den übermäßigen Drogenanbau, die enorme Drogenproduktion und den sehr lukrativen Drogenhandel wird in den Produktions- und den Bearbeitungsländern dadurch sehr behindert, wenn nicht sogar vollkommen verunmöglicht, da in diesen Ländern praktisch der gesammte Staatsapparat korrupt ist, und zwar die Staatsbeamten, die Polizei- und Armeeoffiziere, die Justiz- und Zollbehörde und nicht zuletzt auch die Politiker."92
Diese Aussage verdeutlicht, daß das bisherige Konzept des bedingungslosen Kampfes gegen die Drogenmafia nicht zum erwünschten Erfolg führen kann, den Handel mit illegalen Drogen völlig zu unterbinden. Die Prohibition kann nicht gegen das organisierte Verbrechen gewinnen.
Die Verdienstmöglichkeiten sind zu hoch und die Grenzen zwischen legalem und illegalem Handel zu verschwommen, als daß man erhebliche Erfolge erzielen könnte. Nicht nur das organisierte Verbrechen lebt von diesem Geschäft, sondern auch nicht wenige Freiheits- und Unabhängigkeitskämpfer, Geheimdienste, ja sogar so mancher Staat ist abhängig von den Narco-Dollars, die oftmals die härteste Währung sind.93
Es bleibt zusammenfassend festzustellen, daß der Krieg gegen den Drogenhandel ein aussichtsloser ist, auch wenn mit genügend Geld fast jeder Krieg fortgesetzt werden kann. Ob er allerdings den gewünschten Erfolg bringt, muß vor dem Hintergrund der geschilderten kontraproduktiven Folgen bezweifelt werden. Sicher ist, daß die Zunahme der Repression die Drogen noch teurer und schlechter macht, was nur das schwächste Glied der Kette zu spüren bekommt - die KonsumentInnen.
4 Allgemeine Zielsetzung von Drogenpolitik und -arbeit
Nachdem versucht wurde, zu ergründen, was das Drogenproblem ist und wie der Markt für Drogen funktioniert (Angebots- und Nachfrageanalyse), gilt es sich nun mit der Frage zu beschäftigen, wie die Gesellschaft mit denen für sie problematisch erlebten Drogen mit ihren Folgen umgeht und wie sie an einer Lösung arbeitet. Die Drogenpolitik gibt dabei die Regeln vor, wie sie die Drogenproblematik und den Drogenmarkt handhabt.
4.1 Definition
Allgemein legt die Drogenpolitik den juristischen, finanziellen und institutionellen Rahmen für die Drogenarbeit fest. Sie trifft Entscheidungen auf der politischen Ebene, welche die Konzepte und Angebote der Drogenarbeit fördern oder beschneiden und alle gesetzlichen Regelungen, die den Umgang mit Drogen kriminalisieren und unter Strafe stellen.94 Die Drogenarbeit umfaßt alle Maßnahmen, die auf die Drogennachfrage und die Folgen des Konsums einwirken.
Drogenpolitik und -arbeit bieten dabei sowohl repressive als auch unterstützende Maßnahmen gegenüber den KonsumentInnen. Der Widerspruch zwischen Repression und Unterstützung führt vielfach zu Spannungen innerhalb der Politik eines Landes, z.B. zwischen Polizei und Sozialarbeit, da durch unterschiedliche Vorgaben meist nicht miteinander, sondern gegeneinander gearbeitet werden muß.
Eine engere und besser abgestimmte Zusammenarbeit ist ein muß, um die Probleme für die KonsumentInnen und der Gesellschaft in den Griff zu bekommen.
Abbildung 21 zeigt das Verhältnis zwischen Drogenarbeit und Drogenpolitik im Bedingungsgefüge des Markmechanismus von Angebot und Nachfrage der Drogenproblematik. Drogenarbeit soll dabei durch Prävention und Therapie die Nachfrageseite beeinflussen, die Drogenpolitik durch Repression das Angebot verringern.95
- Soll Prävention erfolgreich sein, muß sie strukturell auf die Nachfrage einwirken, was die Aufgabe der Jugend- und Drogenpolitik ist.
- Therapie als sekundäre und tertiäre Prävention hängt von den Vorgaben der Drogenpolitik ab. Wird durch diese Abstinenz als Ziel postuliert, gilt es dies in Therapie und Drogenarbeit durchzusetzen.
- Strafrecht und Kriminalisierung wird durch Gesetzesbeschlüsse der Politik durchgesetzt und beeinflußt die Therapie und Prävention.
Parameter von Drogenpolitik und Drogenarbeit
(Abbildung 21)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Was passiert, wenn das repressive Element überwiegt, zeigt sich in den USA. Dort sind mehr als die Hälfte aller männlichen Gefängnisinsassen wegen Drogenhandels und -kriminalität verurteilt - die Zahl der Arbeitslosen liegt um einiges niedriger. Seit dem Amtsantritt Bill Clintons stieg die Inhaftierung wegen Cannabis- Delikte um fast das doppelte, 87% davon wegen einfachen Besitzes, 13% wegen Verkauf oder Herstellung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die amerikanischen Gefängnisse sind überfüllt, gerade das repressive Vorgehen gegen einfache KonsumentInnen beweist, wie sinnlos der “War on Drugs” in den USA geführt wird. Amerika als Vorbild. Zumindest für Deutschland traf das ohne Vorbehalte noch vor ein oder zwei Jahren zu. Der Kampf gegen Drogen hatte und hat innenpolitisch gesehen einen höheren Stellenwert als der Terrorismus und wird seit Jahren unerbittlich mit allen verfügbaren Mitteln geführt:
Aussagen zur Drogenpolitik (Abbildung 23)
“Für mich hat der Kampf gegen Rauschgift denselben Stellenwert wie der Kampf gegen Terrorismus.” (Innenminister Baum 1979) “Für mich hat der Kampf gegen Rauschgift denselben Stellenwert wie der Kampf gegen Terrorismus.” (Innenminister Zimmermann 1983) “Der Kampf gegen Drogen ist eine noch größere Herausforderung als der Kampf gegen Terrorismus.” (Innenminister Schäuble 1990) “Der Kampf gegen Drogen ist die dringlichste Herausforderung vor dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus.” (Innenminister Seiters 1992) “Für mich hat der Kampf gegen Rauschgift denselben Stellenwert wie der Kampf gegen Terrorismus.” (Innenminister Kanther 1993)
4.2 Strategie
Das Drogenproblem wird je nach Perspektive von der Politik und der Gesellschaft, in einer Demokratie von dieser bestimmt, unterschiedlich betrachtet. Der Konsum der Drogen wird im Zusammenhang mit der Rechtspolitik als Kriminalität, der Gesundheitspolitik als behandlungbedürftige Krankheit, der Sozialpolitik als Behinderung, der Jugend- und Familienpolitik als Jugendproblem, der Innen- und Außenpolitik als Gefährdung der Sicherheit und der Wirtschaftspolitik als Gefährdung der Leistungsfähigkeit gesehen.
Es lassen sich idealtypisch zwei gesellschaftliche Betrachtungsweisen zum Drogengebrauch unterscheiden:96
1. DasAbstinez-Paradigma, welches den Drogengebrauch ablehnt und ein Leben ohne Drogen zum Ziel hat. Dies kann kurzfristig oder langfristig geschehen, am Ende steht immer die Beendigung des Konsums.
2. DasAkzeptanz-Paradigma, welches den Konsum von Drogen nicht verurteilt und auf dieser Basis die KonsumentInnen, egal ob diese Drogen gebrauchen oder nicht, eine Lösung anbietet, die nicht das Ende des Konsums, sondern vielmehr eine Verbesserung der Situation und der Möglichkeit, ein menschenwürdiges Leben mit oder ohne Drogen zum Ziel hat.
Nach Rausch97und Böllinger98lassen sich drei Strategien der Drogenkontrolle unterscheiden. Diese Ansätze („approaches“) sind nur übertragbar auf den Kreis der KonsumentInnen illegaler Drogen, unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Grundannahme zur Beschaffenheit des Drogenproblems und leiten daraus die entsprechenden Maßnahmen mit unterschiedlicher Reichweite ab.
1. Der legal approach(legalistisch-repressive, kriminalpolitische Ansatz)verfolgt jede Abweichung des Konsums und des Handels von der Norm mit strafrechtlichen Sanktionen. Das Hauptproblem des Drogenkonsums ist die freie Verfügbarkeit der Drogen. Die im Zuge des Konsums stattfindende Folgekriminalität schädigt die Gesellschaft. Es geht hier weniger um die Voraussetzung und Folgen für die KonsumentInnen, sondern nur um die Verwirklichung der Gesetze. Das „ungesetzliche“ Drogenverhalten gilt es durch umfassende und konsequente Sanktionierung und Strafverfolgung zu verhindern.
2. Der social approach(medizinisch-psychologische, sozialpolitische Ansatz)beinhaltet alle Maßnahmen zur Betreuung und Behandlung von Drogenabhängigkeit und - konsum. Mit Hilfe der Prävention soll die Nachfrage nach Drogen reduziert werden, mit der Medizin die körperlichen Schäden repariert und mit sozialpädagogisch-therapeutischen Instrumenten soll die Handlungskompetenz der Klienten gestärkt werden, um ein
Lebensbewältigungskonzept zu erwerben. Es gilt hier die Nachfrage, also die KonsumentInnen zu bearbeiten und nicht das Angebot, die Drogen, mit dem Ziel, Alternativen zum Konsum auf gesellschaftlicher und individueller Ebene zu schaffen. 3. Der libral approach(liberaler, akzeptierender Ansatz) versucht aufzuzeigen, daß das Problem des Drogenkonsums in der Stigmatisierung und Kriminalisierung der KonsumentInnen liegt. Die schädlichen Folgen der Kriminalisierung99sollen vermieden werden. Das Recht auf Selbstbestimmung hinsichtlich des Konsums von Drogen rückt in den Vordergrund. Bessere Aufklärung über weniger gesundheitsschädlichen, kulturell integrierten Gebrauchsformen ist möglich. Kriminal ,-sozial ,-gesundheitspolitische und sozialpädagogische Maßnahmen sollen den Problemdruck auf die KonsumentInnen langfristig vermindern und Drogengebrauch nicht problematisieren sondern akzeptieren. Ziel ist die Entkriminalisierung des Drogengebrauchs, die Abgabe von Ersatzdrogen oder Orginalstoffen und als letztes die Freigabe aller Drogen.
In der Wirklichkeit sind diese Ansätze nicht getrennt voneinander, sondern „nur als Mischformen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Anteilen aus den drei Strategien vorzufinden.“100Auf internationaler Ebene, ja selbst innerhalb der einzelnen Staaten der EU ist die Drogenpolitik nicht einheitlich, sondern von unterschiedlicher Gewichtung der Interessen geprägt. Das liberale Element ist meist nicht aufzufinden. Selbst große regionale Unterschiede lassen sich ausmachen, betrachtet man in Deutschland nur die Politik der Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg mit der von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.
5 Internationale Lösungsstrategien
Im folgenden soll nun die Drogenpolitik detaillierter beschrieben werden. Zunächst wird von der internationalen Ebene ausgegangen. Sie ist die Grundlage für die Vorgaben der EU und ihrer einzelnen Mitgliedstaaten.
5.1 Internationale Maßnahmen
Internationale Strategien werden vom Suchstoffkontrollrat in Wien ausgearbeitet, welches eine Institution der UNO ist. In der Hauptsache handelt es sich um kriminalpolitische Maßnahmen, also um die Verfolgung des Umgangs mit Drogen. Der Einfluß der USA auf diese Politik wurde schon einige Male angesprochen. In den 90er Jahren wurden 90% der Rauschgiftbekämpfungsgelder für die Prohibition ausgegeben, 10% für Behandlung und Prävention.101Dieses Verhältnis zeigt die Bedeutung der strafrechtlichen Verfolgung.
5.1.1 Abkommen und Verträge
In allen Staaten der EU sowie in fast allen Ländern der Erde ist der Umgang mit Drogen kriminalisiert. Dabei beruhen die nationalen Drogengesetze wie z.B. das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) in Deutschland auf internationalen Verträgen und Abkommen zur Bekämpfung der Drogen.
Im wesentlichen basieren sie auf dem Einheitsabkommen von 1961, dem Zusatzabkommen über psychotrope Substanzen von 1971 und dem Wiener Abkommen von 1988.
Die Geschichte der Prohibition ist so alt wie die Geschichte der Drogen. Seit Menschen psychotrope Substanzen konsumieren, wurden diese alle irgendwann und irgendwo verboten, teilweise mit dem Tode bestraft. 1633 erließ der Sultan des osmanischen Reiches ein Gesetz, wonach daß Rauchen von Tabak bei Todesstrafe verboten war.102
Alle heute illegalen Drogen waren dabei irgendwann einmal erlaubt, Tabak, Kaffee und Alkohol irgendwann einmal verboten. Erst im 20. Jhrd. wurden verschiedene Abkommen geschlossen, welche die heute illegalen Drogen verboten. Abbildung 25 gibt einen kurzen Überblick über das Geschehen.
Schritte der Prohibition im 20 Jahrhundert
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Opiumkonferenz von Shanghai ist das erste internationale Abkommen zur Beschränkung von Betäubungsmitteln, initiiert auf Drängen der USA, und gilt als Geburtsstunde der Prohibitionspolitik im 20. Jahrhundert. Entscheidend für die von den Vereinten Nationen, der EU und ihren Mitgliedsstaaten eingeschlagene Weg der Drogenpolitik seit den 60er Jahren sind folgende Verträge: Einheitsübereinkommen (Single Convention) Die “Single Convention on Narcotic Drugs” faßt alle bisherigen Abkommen und Protokolle der Betäubungsmittelgesetzgebung zur besseren Übersichtlichkeit zusammen und wurde im März 1961 auf Drängen der Vereinten Nationen in New York abgeschlossen und trat im Dezember in Kraft. Anlaß ist die Sorge um die körperliche und sittliche Gesundheit der Menschheit Sie ist Grundlage der heutigen nationalen Rechtsnormen und wurde von 152 Staaten, darunter alle Mitglieder der EU, ratifiziert und beauftragt die beteiligten Staaten, Gesetze zu schaffen, um die empfohlenen Maßnahmen wirkungsvoll durchzusetzen.103
Produktion, Distribution, Handel, Gebrauch und Besitz der von der WHO definierten illegalen Substanzen ist auf wissenschaftliche und medizinische Zwecke einzuschränken. Ein Verbot erfolgt nach Artikel 1 nur, wenn “dies in Hinblick auf die in ihrem Staat herrschenden Verhältnisse für das geeignetste Mittel hält, die Volksgesundheit und das öffentliche Wohl zu schützen.”104Nach Artikel 33 und 36 wird das Strafmaß durch das nationale Recht geregelt.
Anhand dieses Abkommens verbleibt den Mitgliedsstaaten ein relativ großer Handlungsspielraum, der sich in den unterschiedlichen nationalen Gesetzen widerspiegelt. Als Beispiel sei hier Holland genannt, wonach Cannabis geduldet wird sowie Frankreich, welches drakonische Strafen hinsichtlich aller Drogen verhängt.
Übereinkommenüber psychotrope Stoffe
Die Kontrolle der illegalen Substanzen wird um folgende Stoffe erweitert: Halluzinogene, u.a. LSD, Aufputschmittel, u.a. Amphetamine, Sedativa, u.a. Benzodiazepine und Barbiturate. WienerÜbereinkommen Das Übereinkommen der UN gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Substanzen, abgeschlossen 1988 in Wien, dient als Ergänzung der bestehenden internationalen Verträge, insbesondere des Einheitsabkommens. Hauptanliegen ist die bessere Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten zur Bekämpfung des internationalen Handels mit diesen Substanzen.
Innerhalb dieses Vertrages werden Maßnahmen beschrieben, die von den Vertragsstaaten durchzuführen sind. Dazu zählen:
- Einführung von Bestimmungen über Beschlagnahmung von Drogengeld und Maßnahmen gegen Geldwäsche
- Rechtshilfe und verstärkte Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung
- verstärkter Informationsaustausch
- Unterstützung von Entwicklungs- und Transitländern, um das Angebot zu reduzieren
- bessere Überwachung des Handels mit Betäubungsmitteln
- Jedes Erlangen und Besitzen von Drogen bestrafen
Die Drogenkontrolle wird hier im Gegensatz zur Single Convention schärfer formuliert. Der Konsum bleibt weiterhin straffrei, allerdings wird jede Handlung, welche dem Konsum vorausgeht, also Erwerb und Besitz, unter Strafe gestellt.105 “Der Trend zu einer gewollten schärferen Kriminalisierung in dieser Konvention ist allerdings nicht zu übersehen.”106
5.1.2 Die Vereinten Nationen
Die internationalen Verträge und Abkommen versuchen, den Verkehr mit illegalen Suchtstoffen auf der ganzen Welt zu unterbinden. Es geht dabei um die drastische Verringerung sowohl des illegalen Drogenangebots als auch der Nachfrage. Die Vereinten Nationen (UN), 1945 als Nachfolger des Völkerbunds gegründet, übernehmen dabei die Funktion der Koordinierung aller Maßnahmen, die dies zum Ziel haben.
Der Ansatzpunkt der UN-Aktivitäten ist, daß die regionalen Probleme nicht mit einseitig ausgerichteten Programmen bekämpft werden können, sondern nur durch ein internationales Vorgehen gegen alle Formen des illegalen Anbaus und der Nachfrage nach Drogen.107Generalsekretär Kofi Annan mahnte „Drogen töten unsere Jugend und unsere Zukunft. Wie brauchen eine internationale Antwort auf die Globalisierung des Drogenhandels.“108
In unregelmäßigen Abständen finden unter Schirmherrschaft der UN Konferenzen zur Weltdrogensituation statt. Das Konzept wird dabei seit Jahren beibehalten: Krieg den Drogen. 1990 wurde in New York das letzte Jahrzehnt des 20. Jhrd. als „UN-Dekade gegen den Drogenmißbrauch“ eingeläutet, die „den Sieg der Menschheit über die Sucht“ einläuten sollte. 1998 fand die bisher letzte Konferenz statt, und der Zeit- rahmen wurde noch einmal um acht Jahre, bis zum Jahr 2008, verlängert.109
Es wurdensechs Schwerpunktthemenbeschlossen:
1. Reduzierung der Drogennachfrage
2. Bekämpfung des Anbaus und der Herstellung illegaler
Drogen
3. Kampf gegen die Geldwäsche
4. Zurückdrängen von Amphetaminen und Ecstasy
5. Verbesserte Kontrolle von Chemikalien, die für die
Verarbeitung der Drogen-Rohstoffe nötig sind
6. Ausbau der internationalen Rechtshilfe und
Polizeizusammenarbeit
Neuere Methoden, die sozialen Folgen der Sucht wie Verelendung und Beschaffungskriminalität durch verschiedene Hilfsmaßnahmen zu verbessern, spielen im Programm der UN keine Rolle. Die Strategie ist fast rein auf prohibitive Maßnahmen ausgerichtet. Dabei spielen verschiedene Gremien der UN eine Rolle, um sie in die Tat umzusetzen.
Die allgemeinen Grundsätze der Drogenbekämpfung werden vom Wirtschafts- und Sozialrat der UN festgelegt. Die konkrete Programme werden von der Suchtstoff-Kommission der UN (CND) ausgehend von diesen Grundsätzen ausgearbeitet. Sie Unterstützt die UN bei allen Fragen der Drogenbekämpfung.
Die Suchstoff-Abteilung (DND) mit Sitz in Wien ist die zentrale Informations,- Innovations,- und Koordinationsstelle der UNO, setzt deren Beschlüsse praktisch um und entwickelt Instrumente zur Durchsetzung der UN-Drogenpolitik.
Der Fond zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs (UNFDAC) unterstützt ärmere Länder, Programme zur Eindämmung der Nachfrage, des Handels und der Produktion zu installieren. Mit Entwicklungsgeldern und -hilfe wird versucht , das Angebot und die Nachfrage zu reduzieren. Dazu gehört z.B. die Erntevernichtung von Opium in Thailand oder Subventionszahlungen für andere Produkte in Kolumbien.
Das Internationale Suchtstoff-Kontrollamt besteht aus 13 vom Wirtschaftsrat gewählten Mitgliedern, die sich in der Hauptsache mit der Überwachung des Anbaus drogenhaltiger Pflanzen und deren legalen medizinischen Verwendung befassen. Das Kontrollamt überwacht die Einhaltung der Vertragsverpflichtungen der Mitgliedsstaaten. Das einzige probate Mittel einer Drogenpolitik ist demnach die verstärkte Zusammenarbeit der Staaten mit gleichzeitig verstärkten Kontrollmaßnahmen. Eine Liberalisierung oder Lockerung der Drogenpolitik wäre nicht machbar, es gäbe keine Alternative zu den bestehenden Drogenkontrollverträgen.
Die Weltgesundheitsorganisation110wurde 1947 gegründet und ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie entscheidet im wesentlichen, welche Substanzen in die internationalen Verträgen aufgenommen werden. Kriterium ist die Abhängigkeitsgefahr und die erwarteten Probleme des Mißbrauchs.
Die Politik der Vereinten Nationen besitzen einen deutlich prohibitiven Charakter. Finanziert im wesentlichen von Ländern, deren Politik als repressiv gilt, v.a. von den USA, wird deren Position am stärksten vertreten.
Die Strategie zielt deshalb nicht auf eine Verringerung der Nachfrage in den Industrieländern ab, z.B. durch verstärkte Präventionsförderung, sondern gibt im wesentlichen den armen Erzeugerländern die Schuld. Auf diese wird Druck ausgeübt, um mit allen repressiven Mitteln das Angebot zu zerstören, vernachlässigt aber, daß es eine steigende Nachfrage v.a. in Europa und Amerika gibt.
Es erscheint fraglich, ob das weltweite Angebot an Drogen durch internationale Maßnahmen beseitigt werden kann. Der weltweite Jahresumsatz mit illegalen Drogen ist 300-600 mal so groß wie das Jahresbudget der Vereinten Nationen111.
Die Profite aus den Drogengeschäften112sind zu gewinnbringend - für arme Bauern aus den Entwicklungsländern ist sie oftmals die einzige Einnahmequelle. Erntesubventionen sind viel zu teuer, um den Anbau von Pflanzen zur Drogenherstellung nicht mehr lukrativ erscheinen zu lassen. „Die Vereinten Nationen konnten bis heute nicht auf dem Gebiet der Suchstoffe kontrollierend einwirken.“113Ob dies jemals gelingen wird, kann aufgrund der hohen Finanzkraft der Drogenmafia in Frage gestellt werden.
Ausgehend von den internationalen Vereinbarungen, soll im folgenden die Strategie der EU dargestellt werden. Ausgangspunkt sind die Vorstellungen der UN, da alle Mitgliedsstaaten die verschiedenen Abkommen ratifiziert haben.
5.2 Strategie der EU
Mit Realisierung des europäischen Binnenraums durch das Schengener Abkommen soll Europa unter Führung der EU zusammenwachsen. In jedem der einzelnen Staaten gelten eigene nationale Gesetze und Traditionen, die das Zusammenleben der Menschen regeln, eingeschlossen der sozialen Probleme, zu denen auch die Drogenproblematik zählt.
Die Integration vereint die einzelnen Staaten und versucht, diese auf den verschiedenen Ebenen zusammenzuführen. Dazu gehörte als erster Schritt der Wegfall der Grenzen mit der Folge der Freizügigkeit für alle EU-Bürger und der Einführung einer gemeinsamen Währung. Als zweites der weit schwierigere Teil: Das Herausbilden einer eigenen Identität, mit einer gemeinsamen Politik und Vorgehensweise, welche die verschiedenen gesellschaftlichen Identitäten umfaßt und berücksichtigt.
Die EU mit Sitz in Brüssel koordiniert und leitet verschiedene Maßnahmen ein, die im Ansatz eine Vereinheitlichung zum Ziel haben, in der Praxis aber oft diffus und bürokratisch erscheinen. Hinsichtlich der Drogenpolitik wurden in den letzten zwölf Jahren einige Maßnahmen und Beschlüsse eingeleitet, hin zu einer einheitlichen Politik:
10 Jahre Drogenbekämpfung der EU (Abbildung 26)
Die europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) nimmt an der Wiener Konferenz über den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Substanzen teil. Erstmals werden Mittel für die internationale Zusammenarbeit der UN zur Drogenbekämpfung aus dem Haushalt bereitgestellt Die EWG unterzeichnet das Übereinkommen der UN gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchstoffen und psychotropen Substanzen. Auf Betreiben des europäischen Parlaments wird ein eigener Haushaltsetat für Maßnahmen zur Drogenbekämpfung herausgegeben.
Der europäische Ausschuß zur Drogenbekämpfung (CELAD) wird eingesetzt. Der Vertrag von Maastricht wird unterzeichnet und erwähnt u.a. die Drogenbekämpfung. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBBD) in Lissabon wird eingerichtet. Ein neuer globaler Aktionsplan im Bereich der Drogenbekämpfung (1995-1999) wird beschlossen.
Das Europol-Übereinkommen wird ratifiziert, es werden mehrere Abkommen zur besseren Koordinierung der Tätigkeit der Polizei- und Zollbehörde geschlossen. Das erste Aktionsprogramm zur Prävention des Drogenmißbrauchs wird geschlossen.
In Amsterdam einigen sich die Staats- und Regierungschefs auf eine Verbesserung im Kampf gegen die Drogen.
Das Vokabular ist das gleiche geblieben wie in den zwölf Jahren zuvor. Kampf gegen die Drogen und Drogenbekämpfung sind nach wie vor die Schlagworte. Die Konzeption der EU-Drogenpoltik wird im „Aktionsplan der Europäischen Union im Kampf gegen Drogenmißbrauch“ ersichtlich, verfaßt für den Zeitraum von 1996- 2000. Er versucht, die Richtlinien für die einzelnen Staaten vorzugeben und bemüht sich insgesamt um eine bessere Zusammenarbeit. Inwieweit die Umsetzung gelingt, muß sich noch zeigen. Verschiedene Institutionen sind damit beauftragt.
Das Europäische Parlament ist die legislative Kraft und gibt hauptsächlich den finanziellen Rahmen für die Drogenpolitik vor. Der Europäische Rat definiert die allgemeinen Richtlinien der Politik und trifft mindestens zweimal im Jahr zu einem Gipfeltreffen zusammen. Die Europäische Kommission ist mit der Einleitung und Ausführung der Richtlinien in konkrete Programme beauftragt. Sie besteht aus verschiedenen Ressorts, innerhalb derer die verschiedenen Programme umgesetzt werden. Zum Beispiel ist für die Reduzierung der Nachfrage das Amt für Arbeit und Soziales zuständig.
5.2.1 Der Europäische Aktionsplan
Was konkret für Maßnahmen geplant sind, faßt der „Aktionsplan der EU im Kampf gegen den Drogenmißbrauch“ zusammen. Die neuste Fassung ist für den Zeitraum 1996 - 2000 gültig. Drei Hauptschwerpunkte werden daraus ersichtlich114.
1. Maßnahmen zur Reduzierung der Nachfrage
2. Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels
3. Maßnahmen auf internationaler Ebene DieMaßnahmen zur Reduzierung115zielen auf drei Bereiche ab:
- Zum einen sind dies präventive Maßnahmen. Dazu gehören die Aufklärung von Risikogruppen, die Gesundheitserziehung v.a. in Schulen, Berufsbildungsprogramme und die Fortführung der Arbeiten zur Früherkennung und Überwachung von Drogenkonsum.
- Zum zweiten Programme zur Förderung der sozialen und beruflichen Rehabilitation von Abhängigen mit Unterstützung von Initiativen zur Wiedereingliederung, v.a. Arbeit und Wohnen.
- Als drittes spezifische Maßnahmen: Dies umfaßt den Bereich der Betreuung besonders gefährdeter Risikogruppen in spezifischen Situationen.
Das Endziel ist dabei die Beendigung des Konsums und damit Abstinenz. Zwischenschritte sind aber erlaubt, die den Schaden für die KonsumentInnen reduzieren. Sie sollen die Todesrate senken, das Verbreiten von Infektionskrankheiten, insbesondere AIDS eindämmen und andere Risikobelastungen vermindern. Die Erwähnung von schadensminimierenden Maßnahmen im Aktionsplan der EU ist ein Fortschritt, der für zukünftige Strategien hoffen läßt. Das Abstinenzparadigma ist nicht verschwunden, wurde aber diversifiziert und differenziert, folgt damit neuesten Entwicklungen in der praktischen Drogenhilfe.
Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Handels116von betäubenden Drogen und psychotropen Substanzen betreffen
- erstens eine bessere Zusammenarbeit von den Innen- und Justizministern, gestützt auf die in Holland eingerichtet Drogenabteilung EUROPOL, koordiniert mit verstärkten Druck direkter Zoll und Polizeieinheiten auf die Drogenmafia,
- zweitens die Ausweitung und Intensivierung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und
- drittens Maßnahmen gegen die Verbreitung von Ausgangsstoffen zur Herstellung illegaler Drogen.
Leitlinien sind dabei:
1. Der Interdisziplinäre Austausch auf dem Gebiet des Drogenproblems zwischen Akteuren und den, für die Reduzierung der Drogennachfrage und des Drogenangebotes verantwortlichen Berufsorganisationen.
2. Die Schaffung eines europäischen Forums für Austausch und Mehrstädtezusammenarbeit, das die Städte in Europa in ihren Bemühungen um eine Verbesserung ihrer integrierten örtlichen Strategie zur Drogen- und Kriminalitätsbekämpfung unterstützt.
Maßnahmen auf internationaler Ebene117erstrecken sich auf die Erzeugerländer von Drogen, die meistens zu den Entwicklungsländern zählen und sehen folgende praktische Hilfen vor:
- Unterstützung bei der Reduzierung des Anbaus von Mohn- und Koka-Pflanzen. Bei diesen Hilfen kann es sich um Ausgleichszahlungen für Bauern handeln, die auf den Anbau von Drogenpflanzen verzichten, sowie um Infrastrukturmaßnahmen wie den Bau von Straßen, um die Märkte mit legalen Erzeugnissen zu beliefern.
- Ergänzung des Hilfsangebots durch günstige Handelsbedingungen für legale landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Obst, Gemüse und Blumen sowie andere Erzeugnisse der Region.
- Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Erarbeitung eines Rechtsrahmens sowie bei der Verbesserung ihrer Infrastruktur und ihres Rechtssystems. Unterstützung von Maßnahmen gegen Geldwäsche, gegen die Verbreitung von chemischen Ausgangsstoffen für Suchtstoffe sowie gegen den Drogenhandel. Die tägliche Zusammenarbeit zwischen den nationalen Strafverfolgungsbehörden wird durch den Infor- mationsaustausch und gegenseitiger Amtshilfe bei der Bekämpfung des internationalen Drogenhandels verbessert werden.
- Da die Entwicklungsländer zunehmend mit pflanzlichen und synthetischen Drogen überschwemmt werden, konzentrieren sich die EU-Hilfen auf die Prävention des Drogenkonsums, die Rehabilitation von Drogenabhängigen und die Reduzierung drogenspezifischer Probleme wie AIDS im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit.
Die Arbeit der EU findet im Zusammenhang mit anderen Antidrogenmaßnahmen der Industriestaaten, v.a. mit den USA, und internationalen Organisationen, v.a. den Vereinten Nationen und deren Unterorganisation, der WHO, statt. Die Politik der Europäischen Union wird dabei im wesentlichen von folgenden Institutionen unterstützt:
- EUROPOL
- Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und
Drogensucht
- POMPIDOU-Gruppe
5.2.2 Europol
EUROPOL kann als die europäische Rauschgiftzentrale angesehen werden. Sie untersucht grenzüberschreitende Delikte mit Drogenbezug. In ihre Zuständigkeit fällt ebenso die Geldwäsche sowie Aspekte des organisierten Verbrechens im Zusammenhang mit dem Drogenhandel.
Das Hauptziel von EUROPOL ist der Verbesserung der Effizienz und Zusammenarbeit der zuständigen Behörden in den Mitgliedsstaaten zur Bekämpfung spezifischer Formen des organisierten Verbrechens, die die EU betreffen. Bei der Gründung 1994 wurde als erstes eine Antidrogeneinheit eingerichtet. EUROPOL unterstützt die Arbeit der Polizei und anderer zuständiger Behörden und gewährleistet unter anderem:118
- Den Austausch und die Analyse von Erkenntnissen
über den Drogenhandel;
- Die Ausbildung von Bediensteten der Polizei und
ähnlicher Einrichtungen.
Die im niederländischen Den Haag ansässige Behörde besteht aus Verbindungsoffizieren, welche aus den EU-Ländern kommen und den Kontakt mit diesen sichern sowie eigenen Beamten. Der Mitarbeiterstab besteht insgesamt aus 135 Personen. Das Budget beläuft sich auf insgesamt 15,6 Millionen DM und wurde für 1998 auf insgesamt 19,8 Millionen DM erhöht.119
Haupttätigkeit ist ein Informationsaustausch zwischen den Polizeiorganisationen der Mitgliedsstaaten und den Verbindungsbeamten. Dazu wird ein Computersystem genutzt, welches v.a. personenbezogene Daten zur Fahndung an die verschiedenen Polizeibehörden der Länder weiter reicht. Manche Quellen sprechen davon, daß insgesamt 7 Millionen Personen im Datenraster gespeichert sind.120
Die Wichtigkeit von EUROPOL wird innerhalb der EU- Richtlinien immer wieder betont. Welche Kompetenzen die Behörde genau hat, kann nicht gesagt werden. Es gibt immer nur einzelne Vorgaben, die nicht genau festlegen, inwieweit eine Kontrolle von EUROPOL gewährleistet ist.
EUROPOL dient ausschließlich der Repression. Sie kann, soviel ist sicher, jederzeit Daten an die einzelnen Polizeibehörden weiterreichen ohne mit dem Datenschutz im Konflikt zu kommen. Ihre Existenz ist nicht unumstritten. Es kann festgestellt werden, daß die Europäisierung der Fahndungs- und Überwachungsmethoden durch Computerunerstützung mit großem finanziellen und personellen Aufwand vorangetrieben wird. Dies bringt auch Bewegung in die nationalen Polizeiapparate, die in allen Mitgliedsstaaten weiter ausgebaut werden. Die Akzentuierung strafverfolgender Strategien ist dabei unübersehbar.
5.2.3 Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) wurde 1994 in Lissabon eingerichtet und ist eine Informationszentrale der EU. Ihre Aufgabe besteht darin, „objektive, zuverlässige und auf europäischer Ebene vergleichbare Informationen über die Drogensuchtproblematik und ihren Folgen“ zu liefern.121
Sie sammelt und verbreitet Informationen und Daten zu folgenden Punkten122:
1. Drogennachfrage und Maßnahmen zur Reduzierung;
2. nationale und gemeinschaftliche Strategien und Politiken (Aktionspläne, Rechtsvorschriften, Maßnahmen sowie internationale, bilaterale und gemeinschaftliche Übereinkünfte);
3. internationale Zusammenarbeit und Geopolitik des Drogenangebots insbesondere Kooperationsprogramme und Information über Erzeuger- und Transitländer;
4. Überwachung des Handels mit Suchtstoffen, psychotropen Substanzen und Vorprodukten:
5. Folgen der Drogenproblematik für die Erzeuger-, Verbraucher-, und Transitländer.
Das Hauptanliegen besteht darin, „Entscheidungsträgern und sonstigen Interessenten eine Informationsgrundlage zu verschaffen, die ihnen einen Vergleich der Wirksamkeit von Strategien und praktischen Maßnahmen ermöglicht.“123 Die Aufgaben der EBDD lassen sich unter vier Schwerpunkten zusammenfassen:124
1. Sammlung und Analyse der vorhandenen Daten:Die Beobachtungsstelle sammelt und analysiert Daten, die von den Mitgliedsstaaten übermittelt werden; sie führt Umfragen und Untersuchungen durch und bietet organisatorische und technische Hilfssysteme an, die Informationen über Programme und Aktionen in die Mitgliedsstaaten liefern kann. Im Moment wird der Aufbau eines europäischen Informationsnetzes für Drogen und Drogensucht (REITOX) in Angriff genommen.
2. Methodische Verbesserung des Datenvergleichs:Die EBDD gewährleistet eine bessere objektive Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit der Daten auf europäischer Ebene durch gemeinsame Erarbeitung von Indikatoren und Kriterien. 3.Verbreitung der gesammelten Informationen:Die Beobachtungsstelle stellt die von ihr gesammelten Informationen den einzelnen Mitgliedsstaaten, der EU und den zuständigen Organisationen sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung.
4. Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Einrichtungen und Organisationen sowie Drittländern:Hier ist insbesondere die Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen wie der WHO und UNDCP sowie mit den europäischen Regierungs- und Nichtregierungsstellen, die sich mit dem Thema Drogen befassen, gemeint. In Deutschland findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Institut für Therapieforschung statt.
Die Bedeutung der EBDD als zentrale Beobachtungsstelle
liegt darin, daß hier ein Schritt getan wurde hin zu einer längst überfälligen Harmonisierung der europäischen Drogenpolitik mit einer erstmals stattfindenden grenzüberschreitenden Forschung. Bisher wurde nur im Bezug des Strafrechts, also auf der repressiven Seite, in dieser Hinsicht etwas getan. Die Arbeit der Beobachtungsstelle ist nicht unabhängig, sondern unterliegt der Europäischen Kommission, die bisher für ein weiterführen der repressiven Strategie eintritt.
5.2.4 Pompidou-Gruppe
Die Pompidou-Gruppe wurde auf Initiative des französischen Präsidenten Pompidou 1971 gegründet und war zunächst auf die Europäische Gemeinschaft beschränkt, weitete ihre Arbeit dann aber auf ganz Westeuropa aus. Heute zählen 26 Staaten zu ihren Mitgliedern und ist dem Europarat unterstellt. Die EU berät sich bei allen Maßnahmen mit der Pompidou-Gruppe und arbeitet mit ihr zusammen. Nichts wird innerhalb der EU beschlossen, ohne sich mit der Pompidou-Gruppe abzusprechen. In ihrer langjährigen Arbeit untersuchte sie die Probleme zur Drogenabhängigkeit und dem illegalen Handel.125
Die Initiative des Europarates zum Drogenproblem stellte auf europäischer Ebene die ersten Kooperationsversuche dar und gingen den Aktivitäten der EG weit voraus. Auf verschiedenen Konferenzen wurde sich gegen eine Legalisierung des nicht medizinischen Gebrauchs von illegalen Drogen ausgesprochen. An diesen Konferenzen sind neben den Mitgliedern des Europarates insgesamt 40 Länder beteiligt, darunter Rußland, Albanien, Ukraine und Kroatien.
Die Beschlüsse werden in einem Aktionsprogramm
zusammengefaßt. Im Vordergrund stehen die Reduzierung der Drogennachfrage durch verstärkte Prävention, Sozialarbeit und schadensminimierende Maßnahmen, um die Gesundheit von Abhängigen zu verbessern. Gleichzeitig wird der Wunsch geäußert, durch bessere Kooperation und Koordination den Erfahrungs- und Informationsaustausch über illegalen Drogenschmuggel und -handel zu verbessern.
Die Diskussionen im Europarat zeigen, daß es dort zwei
Ansätze gibt. Das Konzept der akzeptierenden Drogenarbeit
wird von den Niederlanden, Spanien und Italien vertreten; eine repressive Politik wird insbesondere von den skandinavischen und osteuropäischen Ländern gefordert. Deutschland, die Schweiz und Großbritannien treffen sich in der Mitte dieser beiden Ansätze. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden, obwohl dies von der Pompidou-Gruppe ausdrücklich gefordert wird.
5.2.5 Bewertung der EU-Strategie
Bewertet man die Konzeption der EU, so ist auch hier der prohibitive Charakter klar ersichtlich, allerdings in etwas abgeschwächterer Form im Vergleich zu der Strategie der Vereinten Nationen.
Die EU lehnte bisher eine Diskussion über die
Entkriminalisierung und Liberalisierung ihrer Politik ab. Die Trennung der Märkte in weiche und harte Drogen oder eine Orginalstoffabgabe an Süchtige wurde kategorisch als der falsche Weg bezeichnet. Evaluierung auf diesem Gebiet wird als nicht erzielendswert betrachtet. So wurde 1994 im Europäischen Parlament einem Antrag zugestimmt, wonach der Konsum und der Besitz verbotener Drogen auch in kleinen Mengen zur persönlichen Verwendung weiterhin illegal bleiben müsse. Damit bekräftigt das Parlament seinen Entschluß von 1992, daß die Legalisierung nicht als geeignete Lösung des Drogenproblems bezeichnet werden kann.126
Im Katalog der EU finden sich aber Tendenzen für eine
erweiterte Sichtweise. Allein mit repressiven Maßnahmen läßt sich das Drogenproblem nicht anpacken. Bei den Maßnahmen der Drogenreduzierung finden sich gewisse Ansatzpunkte.
Ein Ausschuß des Parlaments kam 1996 zu dem Entschluß, daß Erfahrungen mit Liberalisierungsmaßnahmen erst in beschränkten Rahmen vorliegen und noch nicht alle Risiken geklärt worden wären. Es sei aber wichtig, diese Frage in Zukunft zu vertiefen. Eine Unterscheidung weiche - harte Drogen fand nicht statt. Ein Alleingang der EU, unabhängig von den internationalen Gremien, wird nicht erwartet.127
Innerhalb des Ausschusses wurde auch geäußert, daß die
bisherige Drogenpolitik der Repression weitgehend gescheitert und nicht zu dem erhofften Ergebnis gekommen sei. Die Politik des strafrechtlichen Bekämpfung und des Verbots können das Drogenproblem nicht lösen. Es muß deshalb nach Alternativen gesucht werden. Der Besitz und Konsum kleiner Mengen zur persönlichen Verwendung sollte nach Meinung des Ausschusses im Prinzip nicht strafrechtlich verfolgt werden. Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen und den internationalen Drogenhandel muß dagegen intensiviert werden.128
Ein bemerkenswert progressiver Schritt der EU-Politik ist der Vertragsentwurf von Amsterdam, der 1999 in Kraft treten soll. Dort heißt es, daß die EU die in den Mitgliedsstaaten bereits praktizierten schadensminimierenden Maßnahmen unterstützt. Das ist insofern bemerkenswert, da bisher noch in keinem Vertrag im europäischen Einigungsprozeß bisher Maßnahmen zur Verringerung drogenspezifischer Schäden festgeschrieben wurden. Risikoverminderung und Schadensbegrenzung gehörten bisher nicht zum Vokabular der EU-Verträge.
Der Hauptschwerpunkt des Vertragswerkes ist die
Bekämpfung der Kriminalität und verstärkte Prävention. In diesen Bereichen will die EU vermehrt aktiv werden. Dabei spielt die bessere Zusammenarbeit zwischen den nationalen Polizeibehörden und EUROPOL sowie eine Angleichung des Strafrechts die Hauptrolle. Präventive Maßnahmen sollen weiterhin auf das Langzeitziel Abstinenz ausgerichtet sein.
Insbesondere der Drogenverkauf an öffentlichen Orten sowie der Drogentourismus sollen in Zukunft eingeschränkt werden, da sie die öffentliche Ordnung und Sicherheit der EU-Bürger gefährden.129Diese in der breiten Öffentlichkeit bestimmt populären Maßnahmen sollen der EU den Rückhalt der Bevölkerung für weitere Maßnahmen sichern.
Liberale Tendenzen sind nur bedingt ersichtlich. Für die
Zukunft ist eher zu erwarten, daß die EU zwar weiterhin
bemüht ist, die bereits in einigen Ländern geführte prag-
matische Arbeit mit DrogenkonsumentInnen zu unterstützen. Ein Schwerpunktthema wird dies wohl aber nicht werden. Im 59
nächsten Kapitel soll deshalb gezeigt werden, wie unterschiedlich die 15 Mitgliedsstaaten mit der Drogenproblematik umgehen und versuchen, einen Lösungsansatz zu finden.
6 Nationale Lösungsstrategien
In allen Mitgliedsstaaten sind die Zuständigkeiten im Bereich Drogen auf die nationale, die regionale und die lokale Ebene aufgeteilt. So werden im allgemeinen die großen politischen Leitlinien auf nationaler Ebene festgelegt, während die Durchführung einzelner Aktionen, regionalen oder lokalen Einrichtungen obliegt. Die Finanzierung ist ähnlich aufgeteilt wie die Zuständigkeit, wobei in einigen südlichen Ländern, z.B. in Griechenland, der nichtstaatliche Beitrag einen größeren Umfang einnimmt.
In ganz Europa entwickeln sich die Hilfsdienste im Sinne einer Expansion, Diversifizierung, Dezentralisierung und zunehmender Differenzierung. Drogenhilfsdienste sorgen eher für die Befriedigung individueller Bedürfnisse und arbeiten immer mehr mit Gesundheitsdiensten, sozialen Diensten, Erziehungsdiensten und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. In einigen Ländern werden die Aufgaben der Drogenhilfe nicht von staatlicher Seite wahrgenommen, sondern von freien Trägern, die in diesem Bereich involviert sind. Die Ansätze unterscheiden sich hinsichtlich der Reichweite und dem Lebensstil der Zielgruppe.
In allen europäischen Drogengesetzen wird auf dieErhaltung der
Volksgesundheitund denSchutz der Gesundheit und Jugendhingewiesen. Diese Stichwörter sind die Legitimation der strafrechtlichen Verbote der illegalen Drogen. Die Eingangs schon erwähnte Doppelmoral in dem Konstrukt Volksgesundheit, indem gewisse Drogen verboten und andere erlaubt sind, läßt die Fürsorgepflicht des Staates unglaubwürdig erscheinen.130Einige Experten sehen darin eine „Zwei-Klassen-Sucht- Gesellschaft“.131
Die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahr spricht 1998 von ca. 2,5 Millionen Alkoholkranken, ca. 6,7 Millionen starken Rauchern, die 20 oder mehr Zigaretten am Tag konsumieren sowie von ca.1,5 Millionen Menschen, die medikamentenabhängig sind.132Vergleicht man dazu die Zahlen der illegalen Drogen, so erscheint dies nur als kleines Problem, wenn man von den geschätzten 500.000 bis 1 Million KonsumentInnen harter Drogen in der gesamten EU ausgeht. Inwieweit Cannabis die Volksgesundheit angreift, ist eine andere Frage. Der Staat müßte einsehen, daß durch die legalen „Gifte“ eine weit größere Gefahr ausgeht.
Zur „Erhaltung der Volksgesundheit“, also der Drogenbekämpfung, werden von den einzelnen Staaten verschiedene Mittel eingesetzt. Diese sollen im folgenden genauer beleuchtet werden. Dieses Maßnahmenpaket stützt sich auf vier Bereiche, die in der Schweiz als „Vier-Säulen-Theorie“ bezeichnet wird:133
-Repression
-Prävention
-Reintegration und Rehabilitation
-Schadensminderung(harm reduction)
Alle Aktionen der 15 EU-Staaten richten sich auf diese Bereiche aus. Kein Gebiet kann dabei unabhängig von dem anderen gesehen werden. Allerdings variieren die Tragweite und Schwerpunktsetzung. Eine Drogenpolitik, die sich gleichmäßig auf alle vier Bereiche stützt, ist nicht zu finden. Allgemein wird beispielsweise Prävention als wichtiger Bestandteil einer umfassenden Strategie genannt, in der Praxis finden sich selten umfassende Konzepte.
Betrachtet man die Finanzierung, so wird der Bereich der Repression mit dem größten Budget ausgestattet.
6.1Repression
Die großen drogenpolitischen Auseinandersetzungen finden meistens bei der Erörterung der verschiedenen Repressionsmaßnahmen statt, weil es hier v.a. darum geht, wie stark der Polizeiapparat, die Strafjustiz und die Strafvollzugsbehörden zur Bekämpfung der Drogen eingesetzt werden sollen. Es geht dabei primär um strafprozessuale Fragen. In diesem Bereich gehört aber auch die Grundsatzfrage, ob der Drogenkonsum überhaupt mit strafrechtlichen Maßnahmen bekämpft werden soll.
Der weitaus größere Anteil der DrogenkonsumentInnen dürfte eher mit dem Strafvollzugssystem in Berührung kommen als mit Therapiediensten und Drogenberatungsstellen. In dem System der Repression werden sie dann an die Gesundheits- und Sozialdienste überwiesen.
6.1.1 Betäubungsmittelgesetzgebung
Grundlage für die Drogengesetzgebung sind die internationalen Verträge.134Alle Staaten der EU haben diese unterzeichnet. Trotzdem gehen die Länder in der Kriminalisierung unterschiedliche Wege, teils wegen unterschiedlicher drogenpolitischer Grundüberzeugung, teils durch die historische Entwicklung, teils wegen verschiedener verfassungsrechtlicher Konzeptionen. Im folgenden sollen die Unterschiede in der Betäubungsmittelgesetzgebung herausgearbeitet werden. Welche Bestrafung für welche Delikte ist vorgesehen, welche Tatbestände wirken sich strafmildernd oder strafverschärfend aus? Alle Länder der EU unterscheiden hinsichtlich der Bestrafung zwischen KonsumentInnen und DrogendealerInnen. In der Praxis ist aber oftmals schwer zu ermitteln, wann professionelle Dealerei vorliegt. Bedingt durch die Illegalität und die hohen Schwarzmarktpreise, finanzieren sich viele Abhängige ihre Sucht durch den Verkauf von Drogen im kleinen Rahmen. Der daraus erzielte Gewinn ist das notwen- dige Geld, um den Eigenbedarf zu decken. Diese
„Konsumdealerei“ bringt die Abhängigen in die Gefahr, als Dealer eingestuft und hart bestraft zu werden. In den Gesetzen wird dies berücksichtigt, in dem bei abhängigen StraftäterInnen Therapie statt Strafe verhängt werden kann.
In Frankreich und Schweden beispielsweise gilt immer der Grundsatz „Therapie statt Strafe“, was mit einer Zwangstherapie gleichzusetzen ist.135 In Deutschland wird nach §35 BtMG Therapie nur angewendet, wenn der/die ProbandIn eine geringe Haftstrafe verhängt bekommt, nämlich unter 2 Jahren.136In den Niederlanden gibt es keine Zwangstherapie. Nach 6 Monaten Haft wird dem/der StraftäterIn angeboten, in eine Therapie auf freiwilliger Basis einzuwilligen.137
In einigen Ländern, z.B. Italien, besteht Straffreiheit für den Konsum, in anderen wird zwar nicht der Konsum, dafür aber der Besitz und Erwerb bestraft, was im Endeffekt das gleiche ist, da diese Handlungen dem Konsum vorausgehen. Drogenhandel wird in allen Ländern bestraft, es wird aber differenziert zwischen der verkauften oder importierten Menge.138In den meisten Ländern wird nicht zwischen „weichen“ und „harten“ Drogen unterschieden, sondern nur hinsichtlich des Strafmaßes. Abbildung 27 verdeutlicht dies.
Eigenerwerb und Besitz zum eigenen Konsum sind in allen Ländern privilegiert, d.h. besitzen eine Sonderstellung, indem entweder eine Straffreiheit garantiert wird oder zumindest ein potentielles Absehen von einer Verfolgung garantiert ist.
In Deutschland wird beispielsweise durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes (BVG) die Strafbarkeit von Cannabis bestätigt, gleichzeitig soll aber von einer Verfolgung abgesehen werden, wenn es sich um eine geringe Menge zum Eigenbedarf handelt. Begründet wurde dies, weil eine Bestrafung unangemessen erscheint. Die Länder wurden zu einer einheitlichen Praxis verpflichtet, die noch nicht gegeben ist. Die Menge wurde nicht festgelegt. In Bayern liegt diese bei einem Gramm, in Schleswig-Holstein bei 30g. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen kann zusätzlich bei Besitz von einem Gramm Heroin oder Kokain von einer Strafverfolgung abgesehen werden, wenn diese Drogen zum Eigenverbrauch dienen und andere Menschen nicht gefährdet werden.
In den Niederlanden werden bis zu 30g Cannabis geduldet sowie der Besitz von 0,5g Heroin nicht strafrechtlich verfolgt. Es besteht sogar Straffreiheit bei Einfuhr zum eigenen Gebrauch, obwohl ansonsten die Einfuhr mit der Höchststrafe geahndet wird.
Der Verkauf von Cannabis ist dabei nur in Gaststättenbetrieben ohne Alkoholausschank und Spielautomaten, den sogenannten Coffeeshops139, sowie in Jugendzentren durch einen Hausdealer unter strengen Voraussetzungen erlaubt - keine Werbung, kein Verkauf harter Drogen, keine negativen Begleiterscheinungen, kein Verkauf an Jugendliche unter 18 Jahren, kein Verkauf von mehr als 5g.140Durch Druck der EU, v.a. von Deutschland und Frankreich, wurde vor zwei Jahren die Verkaufsmenge in den Coffeeshops von 30g auf 5g reduziert sowie alle Betriebe an den Grenzen verboten, was zu mehr illegalen und damit schwerer kontrollierbaren Verkaufsstellen direkt an der Grenze führte.
Die Absicht der Niederlande ist die Trennung der Märkte zwischen weichen und harten Drogen, einhergehend mit einer Entkriminalisierung des Besitzes kleiner Mengen weicher Drogen für den Eigenverbrauch und die Duldung von Verkaufsstellen. Dies führte nicht zu einem besorgniserregenden hohen Konsumniveau unter Jugendlichen.141Die holländische Regierung stellte außerdem fest, daß Jugendliche, die in einer bestimmten Lebensphase weiche Drogen konsumieren, in der Regel nicht dazu neigen, mit harten Drogen wie Kokain und Heroin zu experimentieren; dies entspricht der mit der Trennung der Märkte verfolgten Absicht.
In den Niederlanden wird das Drogenproblem nicht mehr primär als akute Bedrohung der Volksgesundheit, sondern als soziale Belastung erfahren.142Hier tragen auch die Drogentouristen v.a. aus Deutschland und Frankreich bei, welche der Regierung und der Bevölkerung ein Dorn im Auge ist. Dies deckt sich mit der allgemeinen Aussage, daß Länder mit einer liberaleren Gesetzgebung gegenüber den KonsumentInnen mit vermehrten Zuzug aus der Drogenszene rechnen müssen, v.a. aus Ländern mit hohen Haftstrafen und repressiver Politik.
Spanien und Großbritannien unterscheiden ebenfalls bei der Strafzumessung zwischen verschiedenen Substanzen nach deren Gefährlichkeit, wobei Delikte im Zusammenhang mit Cannabis weniger bestraft werden. In Spanien werden 30-40g Cannabisbesitz und 1g Heroin geduldet. In Portugal und Belgien herrschen hinsichtlich Cannabis eine ähnlich Regelung wie in Deutschland, der Eigenbedarf ist potentiell straffrei, darüber hinaus auch die zweifache Tagesdosis an Heroin. Allerdings gibt es keine genauen Regelungen, so daß dies im Ermessen der Justiz im Einzelfall liegt. Eine Unterscheidung weiche - harte Drogen findet nicht statt.143
In Frankreich und Luxemburg wird nur zwischen Konsum- und Händlerkriminalität unterschieden. Der Handel wird dabei schärfer bestraft. In Frankreich wurden 1993 die Gesetze für Drogeneinfuhr verschärft und die Höchststrafe von 15 auf 30 Jahre heraufgesetzt.144
Das Mengenproblem bei der Strafzumessung ist in den meisten Ländern ungeregelt im Hinblick darauf, was eine „Normalmenge“ ist. Strafverschärfend wirkt sich die „nicht geringe Menge“145, die „besonders große Menge“146und die „Menge von offenkundiger Bedeutung“147aus, die deutlich über der „Normalmenge“ liegen muß. Diese Differenzen sind ein Beleg für die Uneinigkeit in der europäischen Drogenpolitik.
Strafverschärfend ist in allen Ländern der Verkauf an Minderjährige, in einigen Ländern die Begehungsweise durch eine kriminelle Vereinigung, bei Rückfall oder gewerbsmäßigen Handel.148
Der allgemeine Strafrahmen in der Drogengesetzgebung Europas variiert sehr stark, wobei es nicht klar ist, inwieweit er auch tatsächlich ausgeschöpft wird. In Deutschland wird beispielsweise der Besitz von Drogen mit 1 Monat bis 5 Jahre oder einer Geldstrafe bestraft, bei schwereren Fällen, d.h. gewerbsmäßigen Handel, 5 - 15 Jahre. In Großbritannien liegt die Strafe bei Besitz zum Zwecke des Inverkehrsbringens von Drogen der Klasse A bei lebenslänglich und/oder einer Geldstrafe, in den Niederlanden für die Einfuhr harter Drogen in nicht geringen Mengen bei 16 Jahren oder Geldstrafen.149 Der Aussagewert zum gesetzlichen Strafrahmen eines Landes ist als gering zu betrachten. Die richterliche Bestrafungspraxis innerhalb dieses Rahmens geht daraus nicht hervor. Ein Vergleich der EU-Staaten wäre nur möglich, wenn die Strafe des gleichen Deliktes untersucht würde. In der Praxis legen die Gerichte den Strafrahmen je nach Ermessen unterschiedlich aus, so daß ein Vergleich unmöglich ist. Selbst regional, wie schon erwähnt, finden sich große Differenzen. Die Bestrafung in Bayern unterscheidet sich von der in Nordrhein-Westfalen in erheblichem Umfang.
Einige nationale Betäubungsmittelgesetze beinhalten Regeln zur Verfolgung von im Ausland begangenen Straftaten (Weltrechtsprinzip), die sehr unterschiedlich gestaltet sind sowie Kronzeugenregelungen, die aussagewilligen Straftätern teilweise straflos läßt, teilweise nur strafmildernd ist. Zumindest innerhalb der EU müßten im Zuge einer gewollten Integration die Drogenstraftaten einheitlich verfolgt werden.150
6.1.2 Prozeßrechtssysteme
Entscheidenden Differenzen bestehen hinsichtlich der Prozeßrechtssysteme. In Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Österreich, Schweden und Spanien gilt das Legalitätsprinzip. In Belgien, Dänemark, Großbritannien, Irland, Frankreich, Luxemburg, Finnland und den Niederlanden das Opportunitätsprinzip.151
Nach dem Legalitätsprinzip müssen die Ermittlungsbehörden bei bestehendem Anfangsverdacht in jedem Fall nach Recht und Gesetz ermitteln, ob eine strafbare Handlung vorliegt. Daraufhin kommt es zur Anklage. Alle offenkundigen Straftaten müssen ermittelt und recherchiert werden, auch bei unerheblichen Fällen. Im Falle des Legalitätsprinzipes wird die Polizei und die Justiz dazu angehalten, jeden Delikt zu unter- suchen, was einen enormen Aufwand und Kosten verursacht, die bei der Verfolgung des organisierten, professionell betriebenen Handels mit Drogen fehlen.
Das Opportunitätsprinzip kann von einer Strafverfolgung absehen, wenn sie nach dem Ermessen der Ermittlungsbehörde und der Polizei größere Nachteile, v.a. sozialer Art, als die Nichtverfolgung hat. Die Staatsanwaltschaft kann deshalb aufgrund ihres Weisungsrechts an die Polizei diese anweisen, bei bestimmten Straftaten überhaupt nicht mehr zu ermitteln oder im Falle einer Anzeige solche Verfahren einstellen.
Wie unterschiedlich das Opportunitätsprinzip zur Anwendung kommt, zeigt sich im Vergleich Niederlande - Frankreich. Die holländische Ermittlungsbehörde bringt kaum noch konsumorientierte Drogendelikte zur Anklage, in Frankreich trifft dies nach wie vor sehr häufig zu.
Im Hinblick auf den europäischen Einigungsprozeß und der damit notwendigen Angleichung der Drogengesetzgebung dürften sich deshalb einige Schwierigkeiten ergeben. Ein europäisches Einheitsgesetz kann nur einem Prozeßrechtssystem folgen: Dem Opportunitäts- oder Legalitätsprinzip. Die Durchsetzung einer Linie dürfte in den Ländern mit dem bisherigen System zu verfassungsrechtlichen Problemen führen. Es wird ein langer Weg zu einem einheitlichen Europa werden.
6.2 Prävention
Auf nationaler, aber ebenso auf europäischer und internationaler Ebene ist Anfang der achtziger Jahre der Ruf nach Präventionsmaßnahmen immer lauter geworden, v.a. um die Kosten der Rehabilitation zu senken. Prävention wird dabei unterteilt in primäre, tertiäre und sekundäre Maßnahmen. Diese im einzelnen zu erläutern, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Suchtprävention im eigentlichen Sinne gehört zur Primärprävention und bedeutet hierbei, die Lebensbedingungen („Verhältnisprävention“) und Verhaltensweisen („Verhaltensprävention“) der Bevölkerung so zu gestalten, daß kein Drogenmißbrauchsverhalten entsteht. „Die Entwicklung ging dabei von drogenspezifischen zu unspezifischen Programmen, von der Abschreckung zur ursachenbezogenen, kompetenzorientierten Prävention.“152Es geht hier um die Reduzierung der Nachfrage.
Leider sind über die allgemeine Entwicklung hinaus nur wenige detaillierte Informationen über präventive Maßnahmen in den einzelnen Ländern vorhanden. In den achtziger Jahren wurde im Gegensatz zur Rehabilitation die Prävention aus finanziellen Gründen mehr schlecht als recht durchgeführt. Wirksam können Präventionskonzepte aber nur sein, wenn sie längerfristig angelegt sind. Die wichtigsten Präventionsmaßnahmen bestanden aus Abschreckung, Bestrafung und Verboten.153
Offiziell werden präventive Aufgaben von den Jugendämtern, Schulen, Suchtberatungsstellen, Krankenkassen und Gesundheitsämtern wahrgenommen, zumeist aber wegen fehlender Konzeptionen oder aus Kostengründen nur unzureichend erfüllt.154 In den neunziger Jahren ist eine Ausweitung der Programme mit umfassenden Konzepten zu beobachten. Einige Länder, die über genügend Budget verfügen, haben Programme beschlossen und grundlegende konzeptionelle Standards definiert. Es steht nicht mehr der Verweis auf die körperlichen und seelischen Folgen des Drogenkonsums an erster Stelle, sondern die Hilfe zur Selbsthilfe und Stärkung der Handlungskompetenz. Die Betrachtungsweise richtet sich mehr auf die Lebenswelt und bezieht alle Drogen, legale und illegale, in die Konzeption mit ein.
Ein wichtiger Trend ist die zunehmende Professionalität der Präventionsbeauftragten, die daher rührt, daß sich das Angebot an speziellen Ausbildungsmaßnahmen und Planstellen verbessert hat. Es wird davon ausgegangen, daß Prävention an der Basis am wirkungsvollsten ist. Der Schwerpunkt liegt bei den präventiven Konzepten in allen Ländern in der Gesundheitserziehung an den Schulen, umfaßt aber auch die Bereiche Arbeit, Freizeit und Familie.
Dazu gehören Schriften zur Information und Aufklärung, Filme und Fernsehspots, Telephonberatungen, Internetaufklärung oder Plakate. Im folgenden sollen die Präventionskonzepte dreier Länder ausführlicher beschrieben werden:
InDeutschlandversucht die BZgA diese Aufgaben wahrzunehmen. Das IfT in München überprüft die Wirksamkeit der Maßnahmen und gibt Empfehlungen zur fachlichen Ausrichtung. Hier seien auf die Kampagnen „Kinder stark machen“ und „Keine Macht den Drogen“ hingewiesen, in denen die Bundesregierung versucht, für Abstinenz zu werben. Letzteres Modell wurde vor einigen Jahren eingestellt. An den Schulen existieren seit den achtzigern formal ein „Drogenberatungslehrer“, der Ansprechpartner sein soll und die schulische Prävention koordiniert. Dazu findet zumindest einmal in der neunten oder zehnten Klasse präventiver Unterricht statt. Eine fachliche Ausbildung des Erziehers ist dabei meist nicht gegeben, so daß die Wirksamkeit eher fraglich ist.
In denNiederlandenbefaßt sich das TRIMBOS-Institut mit dem Entwickeln von Programmen und Materialien für die Prävention. Der Schwerpunkt liegt dabei an den Schulen. Für die Ausbildung der Präventivfachkräfte gibt es eine eigene Universität. Die Drogenberatungsstellen wenden sich dabei an Personen, die eine Mittlerfunktion haben, bevorzugt Lehrer, Jugendpfleger und praktische Ärzte. Ein Gesetz verpflichtet die Gemeinden zur Ausarbeitung und Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Diese beginnt schon im Vorschulalter und wird regelmäßig an den Schulen durchgeführt.157
Das staatliche Projekt VIDA (Leben) leitet und koordiniert in Portugalalle präventiven Maßnahmen. Allerdings steckt die Prävention dort noch in den Kinderschuhen und beschränkt sich meist auf die Verteilung von Flugblättern, in dem auf die schädliche Wirkung von Drogen aufmerksam gemacht wird. Seit drei Jahren findet das Projekt CRISTAL statt, welches für die Zielgruppe der 10- 15jährigen Schülern konzipiert ist und gleichzeitig Eltern und Lehrer miteinbezieht. Hier wird auf die Stärkung der Handlungskompetenz eingewirkt. Die Prävention in Portugal ist geprägt durch ein geringes finanzielles Budget.158
Eine ausführliche Darstellung aller in den EU-Staaten durchgeführten präventiven Maßnahmen ist aufgrund der Quantität unmöglich. Zusammenfassend läßt sich aber sagen, daß in ganz Europa fehlende Darstellungen, Vergleiche und Evaluationen der Präventionsmaßnahmen es gegenwärtig nicht erlauben, Ausmaß, Qualität und Wirksamkeit der einzelnen Programme zu beurteilen. Eine alleinige drogenspezifische Aufklärung ohne Berücksichtigung der gesellschaftlichen Struktur und der persönlichen Motive für den Konsum ist allerdings nicht ausreichend und sollte nicht als Suchtprävention benannt werden. Bezeichnend sind die Ausführungen
Schmidbauers159, daß Abschreckung und reine Informationsvermittlung, wie dies v.a. in den Medien oftmals dargestellt wird, entweder zum Ausweichen auf legale Drogen oder zur gesteigerten Attraktivität der hervorgehobenen Drogen führen kann.
6.3Reintegration und Rehabilitation
Reintegration und Rehabilitation von Abhängigen wurde in Europa lange Zeit als das entscheidende Handlungsfeld der professionellen Drogenhilfe betrachtet. Das Ziel besteht darin, Drogenabhängige zur Beendigung ihrer Abhängigkeit zu motivieren. Dies geschieht durch Vermittlung in eine Therapie, in der sie längere Zeit behandelt werden. Am Ende steht ein drogenfreies Leben, die Wiederaufnahme einer Arbeit und der Wiederaufbau sozialer Bindungen.
Die Konzeption basiert auf dem Abstinenzparadigma und fordert,
ohne Drogenkonsum ein angepaßtes, in der Gesellschaft integriertes Leben zu führen. Der Ansatz ist ein medizinisch-psychologischer, sozialpädagogisch-therapeutischer. Sucht und Abhängigkeit wird als Krankheit betrachtet, die es zu behandeln gilt. Der/die Drogen- abhängige wird als krank und behandlungsbedürftig gesehen, gekennzeichnet durch psychische Störungen bzw. Entwicklungsdefiziten.
Alle EU-Staaten haben eigene Strategien entwickelt, die sich durch drei Faktoren unterscheiden:160
- Freiwilligkeit der Behandlung
- Kategorisierung der Problematik
- Eingesetzte Methoden
So konkurrieren in den Ländern verschiedene Therapie-Schulen, die in ihrer Konzeption verschiedene theoretische Annahmen der Abhängigkeitsnatur und unterschiedliche Wertvorstellungen besitzen. Frankreich, Portugal und Griechenland verlassen sich in der Hauptsache auf ein medizinisches Modell mit dem Psychiater im Mittelpunkt des Systems. Deutschland vertraut auf eine psychopathologische Sicht, in der Suchtkranke sich eine gründliche Persönlichkeitsveränderung, meist in einer stationären Langzeit- therapie, unterziehen. Am anderen Ende der Skala befindet sich die Niederlande mit der Betonung, die Menschen in der Gemeinde zu erreichen, dort Hilfe anbieten und Informationen zu verbreiten.161
Die Maßnahmen und Aktivitäten sind in einigen Ländern vielfältig und umfassend ausgestaltet. Abbildung 28 verdeutlicht dies für Deutschland. Dabei können einige Maßnahmen sowohl der Rehbilitation und Integration als auch der Schadensminimierung zugerechnet werden. Beispielsweise kann eine
Substitutionsbehandlung als Ziel Abstinenz beabsichtigen, aber
ebenso zur körperlichen und sozialen Stabilisierung der Abhängigen beitragen ohne das eine Abstinenz erreicht werden soll.
Der Weg zur Reintegration und Rehabilitation ist im Idealfall eine „therapeutische Kette“162, die von einer
- Kontaktphase in einer Kontakt- oder Beratungsstelle,
- Entzugsphase in einer Entzugsklinik,
- Entwöhnungsphase in einer stationären Therapie,
- Nachsorgephase durch eine soziale und berufliche Integration
ausgeht.
Die Aktivitäten aller Länder innerhalb dieser Kette darzustellen,
würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Eine Fokusierung erscheint deshalb notwendig. Exemplarisch wurden die Länder Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Frankreich, Spanien und Portugal ausgewählt. Leider lagen keine Informationen zu den skandinavischen Ländern vor.
6.3.1 Ambulante Beratung, Betreuung und Behandlung
Die Kontaktphase erfolgt in der Regel durch eine ambulante Einrichtung. In Europa umfassen diese Stellen ein großes, gemeindeorientiertes Angebot an Beratung, Betreuung, und Behandlung für DrogenkonsumentInnen und ihrer Familien. Sie bieten individuelle, auf den einzelnen zugeschnittene Unterstützung, Krisenintervention und Überweisungen an andere Behandlungsnetzwerke. Einige werden von öffentlichen Trägern betrieben, andere von karitativen oder privaten. Abhängig davon, ob das Ziel eine unterstützende Beratung oder Suchtbehandlung ist, wird die Einzelfallhilfe von ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, PsychologInnen oder SozialarbeiterInnen,-pädagogInnen wahrgenommen, die teilweise als Team intervenieren.
Einige Einrichtungen bieten Wege aus der Sucht auf ambulanter Basis an, v.a. in den Niederlanden wird innerhalb dieser Konzeption gearbeitet. Andere versuchen, den/die Abhängigen auf eine nachfolgende Behandlung innerhalb einer stationären Therapie vorzubereiten und zu motivieren. In Deutschland und Frankreich ist die ambulanten Hilfe eng vernetzt mit stationären Einrichtungen, wie Krankenhäusern oder Therapiezentren.
InDeutschlandgibt es Ende der 90er Jahre ca. 1100 ambulante Beratungsstellen, die 72.000 KlientInnen betreuen, jede Einrichtung im Schnitt 250.163Die Finanzierung erfolgt über die Länder, den Bund und die Kommunen, dominierend sind die konfessionellen Träger164, die wie nirgendwo sonst in Europa finanziell gut ausgestattet sind. Über die angewandten Methoden der TherapieutInnen gibt die EBIS-Statistitk Aus- kunft, eine jährliche Auswertung aller Klientenkontakte der Wohlfahrtsverbände. 21% der Therapeuten wenden tiefenpsychologische Therapieformen an, 20% gesprächs- therapeutische und 12% verhaltenstherapeutische. Fast die
Hälfte aller Berater verfügt über ein anderes oder überhaupt kein ausdifferenziertes Methodeninstrumentarium.165
Alle Maßnahmen sollen auf freiwilliger Basis erfolgen. Es zeigt sich aber in der Praxis, daß sehr wenige aus eigenem, freien Entschluß sich in eine Beratungsstelle bewegen, sondern zumeist entweder wegen einer Auflage des Gerichtes dort erscheinen oder vom sozialen Umfeld Eltern, Schule, Freunde den Anstoß dazu bekommen. Die Reichweite der Drogenarbeit scheint trotz des breiten, aber hochschwelligen Angebotes niedrig zu sein. Schätzungen sprechen davon, daß nicht mal die Hälfte, knapp 40%, der Abhängigen die Angebote annehmen.166Allerdings gibt es keine genaue Dokumentation des Erfolges der Drogenhilfe. Dies kann auch für die anderen Länder bestätigt werden.
Großbritannienstuft das Drogenproblem vorrangig als medizinisches ein. ÄrztInnen spielen deshalb eine große Rolle im Drogenhilfesystem. Daneben bestehen nichtmedizinische Angebote der Beratung, Lebenshilfe, Krisenintervention, Rechtshilfe oder Therapie, die meisten davon entstanden in den siebziger Jahren. Fast alle Maßnahmen der Beratung werden von staatlichen Dienststellen, „Drug Treatment Clinics“, unterhalten. Der staatliche Sozialdienst kümmert sich um alle Behandlungsfragen von Drogenabhängigen, wie um die Probleme der Wiedereingliederung.167
Spanienunterhält 500 ambulante Einrichtungen, die zu 86.000 DrogengebraucherInnen Kontakte unterhalten und von den Kommunen getragen werden. Es bestehen große regionale Unterschiede. Geographische Gegebenheiten bestimmen die noch schlecht ausgebaute Drogenhilfe. Verstärkt werden Formen der aufsuchenden Arbeit eingesetzt. Die Rolle der Familie in der spanischen Gesellschaft spiegelt sich auch in der Drogenhilfe wieder, die hier aktiv an der Rehabilitation mitarbeitet.168
Frankreichbesitzt 184 Abhängigkeitsbehandlungszentren, in denen sowohl ambulant als auch stationär gearbeitet wird. Jedes Zentrum umfaßt medizinische, psychologische, soziale, erzieherische und familiäre Hilfsangebote. Eine entscheidende Rolle spielen die Gesundheitsämter und Vertrauensärzte, an die die Gerichte Abhängige zuerst überweisen müssen. Es besteht keine große Variationsbreite von Maßnahmen und keine umfassende Infrastruktur der Drogenarbeit. Es werden auch höchstens ein Viertel der Drogenkonsumenten durch die drogenfreien Programme erreicht.169
Eine Ausnahmestellung ist dasniederländische System, indem primär nicht die Abstinenz im Vordergrund steht, sondern die Einsicht, daß bei vielen Drogenabhängigen ab einem gewissen
Alter eine selbst gewünschte und erreichte Distanzierung von der Droge bis zum völligen Entzug eintritt, die auch ohne professionelle Hilfe möglich ist. Ein differenziertes System ist deshalb die Folge dieser Betrachtungsweise. Alle Drogenab- hängigen müssen erreicht werden. Etwa 75% der Abhängigen kommen in irgendeiner Form mit Institutionen der Rehabilitation oder Behandlung in Kontakt.170
Hilfsmaßnahmen bei Drogenproblemen sind in den
Niederlanden Aufgabe der Gemeinden. Gesundheitsbehörden und Polizei arbeiten in einem integrativen Konzept zusammen. Die meisten Institutionen haben einen gemeinnützigen und privaten Charakter, finanziert durch den Staat. Eine Differenzierung der Therapieziele, v.a. in Hinblick auf die Gesundheitserhaltung und Akzeptierung der Sucht, scheint nicht kontraproduktiv gegenüber dem Ziel der Drogenfreiheit zu sein und kann gleichzeitig die Reichweite der Drogenarbeit erhöhen.171
Portugalbesitzt ein großes, staatliches, ambulantes
Betreuungszentrum in Lissabon mit Namen TAIBAS, welches verschiedene kleinere regionale Büros in ganz Portugal unterhält. Die genaue Zahl der Einrichtungen konnte nicht ermittelt werden. Ziel ist ein drogenfreies Leben. Durch psychiatrisches Intervenieren sollen Abhängige aus ihrer Sucht herauswachsen und in die Gesellschaft reintegiert werden. Wieviele KonsumentInnen durch die Drogenhilfe erreicht werden, ist unbekannt.172
6.3.2 Entzug
Entzugsmaßnahmen beabsichtigen einen drogenfreien Zustand, indem Entzugssymptome und Drogensehnsucht zurückgehalten werden. Obwohl es in allen Ländern als eine wichtige Komponente im Drogenhilfssystem gesehen wird, ist nur in vier Staaten eine Ausweitung der Programme zu beobachten.
Die Entzugsmaßnahmen werden zumeist medizinisch
beaufsichtigt und beinhalten oftmals eine Behandlung mit
Substitutionsmitteln, die innerhalb einer bestimmten Frist auf null reduziert werden. Nicht-medikamentöse Entgiftungen, ein sogenannter „kalter Entzug“, basieren auf Akupunktur oder anderen Methoden, die die Entzugserscheinungen oder die Sehnsucht nach den Drogen lindern sollen, besonders in Bezug zu Drogen wie Kokain, bei denen keine akzeptierten Substitutionsmittel in die Behandlung mit einfließen.
Die Entgiftung ist meistens eine Vorbereitung für eine
Langzeittherapie mit dem Endziel der Abstinenz. Der Entzug findet zumeist in Drogenbehandlungszentren, speziellen 71
Entgiftungseinrichtungen, einer Entgiftungsstation eines
Allgemeinkrankenhauses oder einer Psychiatrie statt. Dies
kann ambulant, wie in den meisten südeuropäischen Ländern, oder stationär geschehen. In einigen privaten Institutionen173findet der Entzug vor einer umfassenden Therapie innerhalb der Einrichtung statt.174
Deutschland besitzt ungefähr 1500 Entgiftungsplätze. In den Niederlanden werden in 19 Kliniken Entzugsbehandlungen durchgeführt. In Portugal werden alle Maßnahmen von staatlicher Seite nur ambulant durchgeführt, spezielle Einrichtungen stehen nicht zur Verfügung. Frankreich verfügt über 54 Kliniken, in denen Entzugsmaßnahmen neben anderen Hilfen angeboten werden.175Die Wartezeiten sind in allen Ländern lang, teilweise müssen bereitwillige Abhängige bis zu zwei Monate auf einen Platz warten. Was in dieser Zeit mit ihnen geschieht, kann nicht beantwortet werden.
Die Dauer einer Entgiftung dauert 8-10 Tage in Portugal,
mindestens 11-14 Tage in Deutschland, drei Wochen in den Niederlanden und bis zu sechs Wochen in Großbritannien.176 Dem Entzug wird in einigen Ländern, v.a. in den Niederlanden, eine Beratung und psychosoziale Unterstützung beigefügt, in anderen Ländern findet überhaupt kein Arbeiten mit den KandidatInnen statt, v.a. in Portugal und Spanien, aber auch in Deutschland. Die Drogenabhängigen werden sich selbst überlassen . „Abhängen“ ist angesagt, die Zeit bleibt ungenutzt und ist demotivierend für eine Weiterbehandlung. „Der Entzug wird oft erlebt als erste Phase einer fremdbestimmten Therapievorbereitung und nicht als zumindestens denkbare Stabilisierungsphase, als Hilfe und Vorbereitung zur Selbsthilfe.“177
6.3.3 Entwöhnung
Entwöhnung bedeutet zumeist eine stationäre Therapie, in denen die PatientInnen sich 24 Stunden aufhalten und durch eine multidisziplinäre Behandlung in speziellen Abteilungen allgemeiner oder psychiatrischer Krankenhäuser, speziellen Drogeneinrichtungen oder therapeutischen Gemeinschaften auf ein drogenfreies Leben vorbereitet werden.
Die Ansätze variieren von einer nur entgiftenden über eine umfassende therapeutische Therapie bis zu Zentren für spezielle Gruppen wie Jugendliche, Paare oder Frauen. Dabei gibt es sehr viele therapeutische Modelle, die sehr umfangreich sind und im einzelnen nicht dargestellt werden können. Die meisten sind pragmatisch orientiert und haben bestimmte Auswahlkriterien, beispielsweise einen Cleananspruch bei Aufnahme. Einige besitzen strenge Regeln und hierarchische Strukturen mit einen festgelegten Tagesablauf für die PatientInnen. So führt bei einigen ein Rückfall sofort zum Hinauswurf, bei anderen kann durch ein erneutes Gespräch eine Wiederaufnahme erfolgen.
In Deutschland und den Niederlanden werden zur Zeit einige neue Konzeptionen ausprobiert. In sogenannten „Cleaning Houses“ oder „Motivation Centers“ sollen Abhängige ihren Konsum stabilisieren und testen, ob eine Langzeittherapie für sie in Frage kommt. Der Aufenthalt ist zumeist auf bis zu drei Monate begrenzt. In dieser Zeit besteht kein Cleananspruch. In diesen Ländern wird seit einigen Jahren auch eine ambulante Therapie angeboten, die wesentlich kostengünstiger arbeitet und die Abhängigen in ihrem bisherigen sozialen Umfeld beläßt. Zahlen zum Ausmaß und Erfolg liegen noch nicht vor.
InDeutschlandist eine drogenfreie Rehabilitation nach wie vor der „Königsweg“. Durch eine meistens stationäre Langzeittherapie, die bis zu 12 Monate andauern kann, sollen die Abhängigen wieder sozial integriert werden. Die Finanzierung erfolgt über die Versicherungsträger, die auch entscheiden, ob ein Therapiekonzept genehmigt wird.
Am Beispiel der Konzeption des Phönix-Hauses soll exemplarisch eine Therapie dargestellt werden.178Das Programm besteht aus Psychotherapie durch Einzel- und Gruppensitzungen, Arbeitstherapie sowie Soziotherapie, die den/die Abhängige in seiner Freizeitgestaltung und dem Aufbau von Beziehungen und Freundschaften helfen soll. Das Konzept ist in vier Phasen unterteilt:
1. Phase 1: Orientierung: bis 1. Monat: Eingewöhnung und Einleben in die therapeutische Gemeinschaft. 2. Phase 2: Stabilisierung I: 1. bis 6. Monat: Mehr Rechte und zunehmend Verantwortung.
3. Phase 3: Stabilisierung II: 6. bis 8. Monat: Erweiterte Übernahme von Verantwortung und wachsende Selbständigkeit.
4. Phase 4: Ablösung: 8. Bis 12. Monat: Selbständiges Leben in der Außenwohngruppe - Vorbereitung der beruflichen und sozialen Wiedereingliederung.
Es findet zunächst eine „Entmündigung“ der Abgängigen statt, indem ihnen fast alle Rechte abgesprochen werden, die sie sich dann nach und nach erarbeiten müssen, um am Ende dann als „mündige“ Bürger dazustehen..
Es gibt insgesamt 5230 Plätze. Damit ist für 3,5% der
Drogenabhängigen die Möglichkeit einer stationären Therapie gegeben, bei der eine 3-9monatige Wartezeit besteht.17970% der Betten sind ständig von PatientInnen belegt, die unfreiwillig nach §35 BtMG eine Therapie statt einer Strafe vorziehen und häufig abbrechen. Insgesamt liegt die Abbruchsquote bei allen Therapiewilligen bei 65-70%.18075% 73
derjenigen, die die Therapie beenden, werden wieder
rückfällig, so daß im Endeffekt knapp ein Prozent nach der
Therapie ein abstinentes Leben führt. Man geht davon aus, daß knapp 2-3% aller Drogenabhängigen ohne therapeutische Intervention durch verschiedene Lebensumstände ihre Sucht beenden und abstinent werden.181
InGroßbritannienunterscheidet sich das Angebot der
stationären Einrichtungen kaum von denen in Deutschland. In Frankreichwird der stationäre Therapiebereich von 54 Entwöhnungszentren abgedeckt. Die Verweildauer liegt bei 2 bis 24 Wochen. Von großer Bedeutung ist die Therapiekette PATRIARCHE, die privat finanziert wird, zu der aber keine genaueren Zahlen vorliegen.182InPortugalfindet eine Entwöhnung entweder in kirchlichen Einrichtungen mit strengen Regeln statt oder durch PATRIARCHE. Eine Zahl der Plätze konnte nicht ermittelt werden.Spanienhat 95 öffentliche oder private Institutionen, die insgesamt 7235 Betten zur
Verfügung haben.183
DieNiederlandebesitzen19 staatliche Kliniken, die eine drei- Wochen-Entgiftung, eine Kurzeittherapie bis zu drei Monaten, oder eine längere Behandlung bis zu einem Jahr anbieten. Die Anzahl der Betten umfaßt ungefähr 1000.184 Darüber hinaus gibt es verschiedene private Therapiegemeinschaften, über die kein Datenmaterial vorlag.
Bei der psychischen Entwöhnung herrschen bezüglich der Wahl der Methoden, wie in fast allen Bereichen, große Unterschiede und Uneinigkeiten und werden meist subjektiv eingesetzt aufgrund unterschiedlicher Wertvorstellungen und Erfahrungen. Es gibt keine gesicherten Aussagen darüber, welcher Weg der beste ist. Die Instrumente reichen von der Psychoanalyse über Gesprächs- und Verhaltenstherapie bis zu arbeits- und sozialtherapeutischen Instrumenten sowie Entspannungstechniken wie Yoga, Akupunktur usw.
6.3.4 Nachsorge
Der letzte und abschließende Bereich ist die Nachsorge. Was passiert mit dem/der Abhängigen, wenn er/sie erfolgreich eine Therapie abgeschlossen hat? Gerade die Nachsorge spielt eine große Rolle, soll das Ziel Abstinenz erreicht werden. Es geht um das Schaffen von Perspektiven, um das bisher geführte Leben in der Drogenszene aufgeben zu können. Ein Leben nach der Abhängigkeit muß ermöglicht werden.
Durch Rehabilitationsmaßnahmen und Hilfen zur
Wiedereingliederung sollen die Ex-DrogenkonsumentInnen in die Gesellschaft integriert werden. Konkrete Maßnahmen sind 74
das Beschaffen von Arbeit und einer Wohnung, die Stabilisierung der psychosozialen Situation und das Verhindern einer erneuten Suchtproblematik.
Die Anzahl und Strukturierung der Programme sind in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Sie reichen von vereinzelten Trainingsprogrammen bis zur umfassenden Aktivitäten in den Bereichen Wohnung, Erziehung, Freizeit, Arbeit und gesichertes Einkommen. Einige Modelle bieten psychosoziale und psychotherapeutische Unterstützung unter Berücksichtigung der sozialen Situation und des Status. Es gibt therapeutische Heime und Wohngemeinschaften sowie spezielle Hilfen und Einrichtungen hinsichtlich einer Berufsfindung.
Am wichtigsten wird in allen Ansätzen die Beschaffung eines Arbeitsverhältnisses gesehen, da es für ehemalige Abhängige, die zwar bereitwillig und fähig für eine Arbeit sind, es meistens schwer ist, einen passenden Beruf zu finden.
In mehreren größeren Städten inDeutschlandbildeten sich
deshalb nicht-kommerzielle Projekte, die darum bemüht sind, ehemalige Abhängige in das Berufsleben zu reintegrieren. Anfangs sollen nur eine geringe Anzahl an Arbeitsstunden abgeleistet werden, um dann nach ungefähr sechs Monaten in ein volles Beschäftigungsverhältnis zu wechseln. Arbeit wird teilweise selbst als Therapie betrachtet. In Bayern gibt es seit 1992 ein Projekt, in dem Abhängige nach erfolgreicher oder nicht-erfolgreicher Therapie auf einem Bauernhof arbeiten.185
Weitere Maßnahmen sind die Vermittlung in
Selbsthilfegruppen mit sozialarbeiterischer Betreuung, die Nachsorge in einer Wohngemeinschaft, in denen die Mitglieder sich gegenseitig in der Strukturierung ihres Tagesablaufs unterstützen sowie verschiedene Berufs- und Schulausbildungsmaßnahmen.186Die große Palette täuscht darüber hinweg, daß mit Ausnahme der Wohnprojekte die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen nicht gesichert und kein flächendeckendes Angebot, v.a. in ländlichen Regionen gewährleistet ist.187
Die Konzeption in denNiederlandenähnelt der von
Deutschland. Hier wie dort werden verschiedene Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung angeboten. Ein nationales Programm versucht, verschiedene Arbeitsstellen für Abhängige zu fördern in Abstimmung mit regionalen Initiativen, um die drogenbezogene öffentliche Störung zu reduzieren. Es finden sich verschiedene Wohnprojekte und Ausbildungsmaßnahmen.188
InSpanienexistiert ein Berufstrainingsprogramm für 12.000 Abhängige mit Blick auf den Rückerwerb von sozialen Fertigkeiten, indem auch Nichtdrogengebraucher mit einbezogen werden sowie weitere private Elterninitiativen, die als Gastfamilien ehemalige Abhängige bei sich aufnehmen.189
Portugalbesitzt kein nationales oder regionales Programm für eine Wiedereingliederung. Die Kirche bietet einige Wohnheime für Abhängige, die aber aufgrund rigider Strukturen nicht sehr populär sind. Einige ehemalige DrogengebraucherInnen werden auch in Familien untergebracht, ähnlich wie in Spanien.190
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß jedes Land seine eigene Strategie im Umgang mit DrogenkonsumentInnen besitzt. Es bestehen überall Defizite in der Evaluierung aller Maßnahmen, sowohl der Beratung, Betreuung, Behandlung, der Entwöhnung, der Entgiftung und der Nachsorge. Im Bereich der Suchtforschung ist generell von einem Informationsdefizit auszugehen, eine Verbesserung ist dringend notwendig.
6.4Schadensminimierung
Die Strategie der Schadensminimierung oder harm reduction, in
Anlehnung eines Konzeptes aus Liverpool, beinhaltet, daß Abstinenz nicht die einzige Zielsetzung einer Drogenpolitik sein kann. Es geht darum, auch Drogenabhängige zu erreichen, die (noch) nicht aus ihrer Abhängigkeit austreten können oder wollen. Es wird davon ausgegangen, daß durch das bisher vorherrschende
Abstinenzparadigma höchstens die Hälfte aller Abhängigen erreicht wird. Alle Maßnahmen sind anforderungsarm und sollen auch diejenigen einbeziehen, die bisher vom traditionellen, ausschließlich abstinenzorientierten Drogenhilfesystem nicht erreicht wurden.191 Unter Harm reduction werden alle Maßnahmen zusammengefaßt, die unter das Akzeptanzparadigma fallen. Es handelt sich um einen liberalen, akzeptierenden Ansatz.
Das Modell der Schadensminimierung ist unter dem Eindruck der Folgeerscheinungen einer wachsenden Kriminalisierung und Stigmatisierung der KonsumentInnen von illegalen Drogen entstanden. In die praktische Arbeit integriert wurde es durch die Zunahme der Mortalität sowie Infektionskrankheiten wie AIDS und Hepatitis Ende der achtziger, Anfang der neunziger und einer vermehrten Verelendung der DrogengebraucherInnen trotz oder wegen der verstärkten Repression.
Hinter dem Modell steht die Vorstellung, daß wir in einer
pluralistischen Gesellschaft leben, in der Konsum von Drogen auf
verschiedene und nicht vorhersehbare Arten auftritt.192Wegen der
Komplexität des Drogenproblems ist eine Reihe verschiedener, auf die Bedürfnisse der Drogenabhängigen zugeschnittenen Maßnahmen 76
notwendig. Es wird versucht, den verschiedenen Lebensstilen und den unterschiedlichen Persönlichkeitsentwicklungen der Menschen Rechnung zu tragen. D.h. der/die Drogenabhängige wird als Individuum behandelt und seine/ihre Selbstbestimmung wird respektiert.193
Abhängigkeit wird weder als Krankheit noch als Kriminalität
betrachtet, vielmehr kümmert sich die Drogenhilfe um die praktische Bewältigung und um die Vorbeugung aller Schäden, die im Zusammenhang mit Drogenkonsum entstehen können mit dem Hintergedanken, daß davon eine therapeutische Wirkung ausgeht, da sich das Umfeld ändert und der Druck einer Schuldzuweisung weggenommen wird. Dadurch, daß auf die verschiedenen individuellen Bedürfnisse eingegangen wird, muß auch das Angebot an Tätigkeiten stark differenziert werden.
Das Konzept der harm reduction umfaßt sowohl präventive
Maßnahmen als auch niedrigschwellige Hilfsangebote, die die Lebensqualität Abhängiger stabilisieren oder verbessern sollen. Dieses Konzept sieht u.a. auch das Verteilen steriler Spritzen oder Experimente mit kontrollierter Drogenabgabe an Abhängige in schlechtem Gesundheitszustand vor. Abbildung 29 gibt einen Überblick:
Aufsuchende Arbeitist eine gemeindenahe Aktivität, die versucht,
KonsumentInnen zu erreichen, die bisher noch nicht effektiv mit dem traditionellen Drogenhilfesystem in Kontakt kamen. Das Angebot reicht von Prävention bis zur Lebenshilfe und Beratung. Grundlage ist Akzeptanz und Verständnis für den Lebensstil der Drogenge- braucherInnen. Die Zielgruppe reicht von Jugendlichen bis zu langjährigen Drogenabhängigen. Der Kontakt findet durch Sozialarbeiter auf der Straße, szenenahen Kneipen, in Institutionen und in Wohnungen statt.
Dieser Ansatz hat im allgemeinen in allen Ländern mit einer offenen Szene an Bedeutung gewonnen, besonders in Großstädten. In Nord- und Mitteleuropa, v.a. Schweden, Großbritannien, die Niederlande und Deutschland, ist die aufsuchende Arbeit gut strukturiert und ausgereift. Im Süden, mit Ausnahme Italiens, finden sich starke Defizite und nur vereinzelt Pilotprojekte oder unstrukturierte Initiativen.194
Niedrigschwellige Angebotesind einfach zu erreichende Hilfen, die keine oder geringe Anforderungen an die KonsumentInnen stellen. Ziel ist es, auch diejenigen zu kontakten, die bisher durch die hochschwelligen Angebote mit Abstinenzanspruch nicht erreicht werden konnten. Für sie ist ein drogenfreies Leben (noch) nicht möglich.
Der Service umfaßt grundlegende Lebenshilfen wie Unterkunft,
Hygiene und Essen, Hilfen zum täglichen Überleben und einem
Entgegenwirken einer weiteren Verschlechterung, bedingt durch den 77
Lebensstil des ständigen Beschaffens und Konsumierens von Drogen, mit teilweiser schlechter Qualität. Einige Einrichtungen bieten allgemeine medizinische Hilfen an für diejenigen, denen es nicht möglich ist oder die nicht gewillt sind, eine allgemeine gesundheitliche Versorgung zu erlangen. Teilweise wird das Angebot ergänzt durch eine kostenlose Rechtsberatung. Alle Maßnahmen sind eine wichtige Ergänzung, um Drogenabhängigen mit schlechter gesundheitlicher und sozialer Verfassung zu helfen.
In Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien hat sich ein gut strukturiertes Angebot an niedrigschwelligen Hilfen etabliert, was zu einem wesentlichen Teil zu einer Verbesserung der Lage der DrogenkonsumentInnen beiträgt.195In den anderen Ländern finden sich aufgrund finanzieller oder ideologischer Barrieren nur vereinzelt Projekte, die Maßnahmen in diesem Bereich unterstützen. In Portugal beispielsweise findet sich keine einzige Institution, die ein solches Angebot bereithält. In einigen Städten bietet die Kirche lediglich Notschlafstellen an.196
Kontrovers wurde in manchen Ländern das Einführen von
Programmen zum Spritzentausch diskutiert; dies würde einen Aufruf zum Konsum gleich kommen. Ob mehr Personen Drogen, v.a. Heroin, Kokain und Amphetamine, intravenös konsumieren, weil sie kostenlos an sterile Spritzen kommen, kann unter Betrachtung der Realität mit nein beantwortet werden. Obwohl in den achtziger Jahren keine Sprit- zen verteilt wurden, hat sich der Konsum immer mehr erhöht.
Um aber wirkungsvoll einem Ausbreiten von HIV und Hepatitis
entgegenzuwirken, sind diese Maßnahmen sinnvoll und notwendig, so daß sich in den meisten Staaten dieses Angebot durchgesetzt hat. In einigen Ländern wurde selbst das Aufstellen von Automaten zum Spritzentauschen akzeptiert. In allen Ländern ist aber die Abgabe von sterilen Spritzen in Gefängnissen verboten, obwohl bekannt ist, daß auch dort Drogen vorhanden sind. Hier muß über eine Liberalisierung nachgedacht werden.
Die momentane Diskussion befaßt sich mit dem Thema, ob das
Eröffnen von sogenannten Gesundheits- oder Fixerräumen als neue Methode ein akzeptables Mittel ist. Es geht darum, Einrichtungen zu schaffen, in denen i.v.-DrogengebraucherInnen unter hygienischen Bedingungen und unter ärztlicher Aufsicht Drogen konsumieren können. Einmal würde so die Gefahr einer Überdosis reduziert, gleichwohl die Reichweite der Drogenarbeit erhöht und Infektionskrankheiten und anderen Krankheiten, die unter unhygienischen Umständen die Gefahr einer gesundheitlichen Verschlechterung mit sich bringen, vermieden. Gesundheitsräume bringen v.a. in Städten mit einer offenen Szene den Vorteil, daß nicht mehr so häufig an öffentlichen Plätzen konsumiert wird und damit ordnungspolitisch der in den Augen vieler MitbürgerInnen störende Junkie seine Nadel nicht mehr direkt vor ihren Augen in die Venen
drückt. Bisher steht das Einrichten solcher Lokalitäten noch nicht auf einer legalen Basis.
Städte wie Hamburg und Frankfurt haben aber bereits
Gesundheitsräume in ihr Drogenhilfesystem eingebaut und Erfolge erzielt. Nach einem Beschluß der Bundesregierung sollen diese nun auf eine legale Basis gestellt werden.197Inwieweit in anderen Ländern solche Maßnahmen geplant sind, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. In einigen Städten in Europa wird dies aber bereits praktiziert. Zahlen und Evaluierungsdaten sind noch nicht vorhanden.
Ein Streitpunkt ist ebenfalls die Frage, ob durch eine staatliche
Drogenabgabe, entweder durch die Substitution mit Ersatzstoffen oder Orginalstoffen dem Ziel der meisten Regierungen, ein drogenfreies Leben, nicht entgegengewirkt wird. Es besteht immer noch die Leidensdrucktheorie, nach der ein/eine Abhängige erst völlig am Boden sein muß, um bereitwillig ein abstinentes Leben führen zu wollen. Maßnahmen wie eine Drogenabgabe, steriles Spritzenbesteck und Gesundheitsräume würden dem entgegenwirken. Dies entspricht nicht gerade dem Grundsatz einer humanitären Gesellschaft und steht der vom Staat hochgehaltenen Aufrechterhaltung der Volksgesundheit entgegen.
Hinsichtlich der Substitutionsbehandlung mit Ersatzstoffen finden sich nach anfänglichen Bedenken in allen Ländern Programme, die v.a. Methadon, L-Polamidon, Codein oder Buprennorphin an Abhängige abgeben. Die Ziele sind überall die gesundheitliche Verbesserung und Stabilisierung, die soziale Reintegration und die Beendigung des Drogenkonsums, insbesondere des Konsums illegaler Drogen, eine Schadensbegrenzung sowie HIV-Prophylaxe.198
In der Praxis divergieren die Programme der einzelnen Länder durch unterschiedliche Anforderungen, Effekten und Reichweite. Je liberaler die Handhabung, desto größer die Zahl der Interessenten. Abbildung
30 gibt einen Überblick.
Großbritannien, die Niederlande und Italien haben relativ geringe
Anforderungen bei der Behandlung. In Italien wenden die staatlichen Drogeneinrichtungen Methadonprogramme nach keiner einheitlichen Richtlinie und genauen Abgaberegeln an. Aus Personalmangel findet zumeist auch keine oder wenig Betreuung statt. Darüberhinaus wird verstärkt auch Naloxone199verschrieben. In Großbritannien können ÄrztInnen mit spezieller Erlaubnis relativ frei Methadon an
Abhängige verschreiben.200
In den Niederlanden wurde das erste Methadonprogramm 1968 in Amsterdam eingerichtet. Eine Grundsatzdiskussion hat es dabei nie gegeben. Man wahr statt dessen immer der Auffassung, daß Methadon einen humanitären Beitrag in der Drogenbehandlung leisten kann. Ziel der Behandlung ist, wegen der Einsicht, daß Drogenprobleme nicht gelöst werden können und akzeptiert werden müssen, die Sicherung eines bestimmten Lebensniveaus und die Reduktion der negativen 79
Begleiterscheinungen des Drogenmißbrauchs. Drogenfreiheit ist nicht das vorrangige Ziel der Behandlung, Methadon für Süchtige sei ein Recht, keine Therapieform.201
In Deutschland wurden Ersatzdrogen lange Zeit untersagt. Erst im Zuge der Ratlosigkeit nach dem auftreten von AIDS wurden auch in Deutschland Programme eingeführt. Als erstes Bundesland führte Nordrhein-Westfalen 1988 einen Modellversuch durch, allerdings mit hohen Auflagen. Der 1990 gestartet Versuch in Hamburg hatte dagegen Modellcharakter für ganz Deutschland. Der Zugang für Methadon war anfangs noch mit hohen Auflagen verbunden, u.a. mindestens zwei gescheiterte Abstinenztherapien sowie keine bestehende Mehrfachabhängigkeit, so daß in der Regel das freier zugängliche Kodein verschrieben wurde. Die neue Bundesregierung plant nun, die Substitutionsbehandlung auszuweiten und leichter zugänglich zu machen, da sie sich ihrer Meinung nach als wichtiger Faktor im Drogenhilfesystem erwiesen hat und nicht unerheblich dazu beiträgt, daß eine bessere Zusammenarbeit zwischen ÄrztInnen und Drogenhilfe stattfindet.202
In den anderen südeuropäischen Ländern und Frankreich wurden seit 1993 Methadonprogramme eingerichtet und haben sich mittlerweile etabliert.203
Im Moment wird in allen Ländern kontrovers diskutiert, ob eine
Orginalstoffabgabe an Drogen ein weiteres Angebot wäre, die
Drogenhilfe zu unterstützen. Durch die Behandlung mit Ersatzstoffen konnten nicht alle Abhängigen erreicht oder deren Zustand nicht verbessert werden. Viele langjährige DrogengebraucherInnen befinden sich zwar in den Substitutionsprogrammen, konsumieren aber neben den Ersatzstoffen weiterhin illegale Drogen, v.a. Heroin, da die Ersatzstoffe für sie nicht ausreichend sind. Um auch diese Gruppe zu erreichen oder zu helfen, wurde von verschiedenen pragmatisch orientierten Helfern in der Drogenarbeit überlegt, ob eine Orginalstoffabgabe eine zusätzliche Hilfe wäre.
Dabei stützt man sich auf einen Modellversuch in der Schweiz, in dem Heroin an Schwerstabhängige abgegeben wurde, die langjährig süchtig und mehrere Therapien hinter sich hatten. Die Idee ist nicht neu. In Großbritannien wird seit den zwanziger Jahren Heroin und Morphium ambulant verschrieben. Seit 1967 findet eine kontrolliertere, durch lizenzierte ÄrztInnen in 39 Behandlungszentren stattfindende Verschreibungspraxis statt.204Diese kontrollierte Vergabe von Heroin wird nicht als Behandlung im eigentlichen Sinne verstanden, sondern als erste grundlegende soziale und medizinische Hilfe für Abhängige.
Die Erfahrungen zeigen, daß die Vergabe von Heroin mindestens so erfolgreich eingesetzt werden kann wie andere Behandlungsformen. Prävalenzdaten belegen, daß durch das System einer Heroinabgabe die Problematik einschließlich des Schwarzmarktes eingeschränkt und
kontrolliert werden kann. Zudem hat Großbritannien mit 5% AIDSinfizierten Drogenabhängigen205eine der niedrigsten Raten in der industrialisierten Welt.
In Deutschland und den Niederlanden soll im Rahmen eines
Modellversuchs eine staatlich kontrollierte heroingestützte
Behandlung mit schwerstabhängigen OpiatgebraucherInnen ,
medizinisch und psychosozial begleitet, dieses Jahr anlaufen. Die Bundesregierung plant, die legalen Voraussetzungen dafür zu schaffen.206Ein Umdenken hin zu einer pragmatisch akzeptierenden Drogenpolitik scheint sich in einigen Ländern, nicht mehr nur in den Niederlanden, durchzusetzen, wobei bei weitem noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
Sekundärpräventive Maßnahmensollen diejenigen aufklären, die
bereits Drogen konsumieren. Es soll ihnen vermittelt werden, welche Risiken sie beim Konsum von Drogen eingehen, und wie sie diese Risiken reduzieren können. Dies umfaßt eine sachgerechte Substanzaufklärung und Anleitung zu risikoramen Konsumformen, bei Heroin beispielsweise Rauchen statt injizieren. Ziel ist die Vermittlung regelorientierter und möglichst gesundheitsschonender Gebrauchsformen im Sinne von Safer-Use-Praktiken.
Es werden sehr viele und unterschiedliche Maßnahmen in diesem
Präventionsbereich ergriffen. In letzter Zeit befassen sich viele private Organisationen mit dieser Aufgabe. Neuere Konzepte setzen auf eine „peer-group-education“, um direkt in der Szene für Prävention zu werben. Grund ist eine bessere Glaubwürdigkeit und Erreichbarkeit.
Als Beispiel sei der Verein Eve&Rave benannt, der sich mit
präventiven Maßnahmen in der Techno-Szene befaßt. In dieser
Konzeption versuchen Mitglieder aus der Szene selbst die Risiken v.a. bei Ecstasykonsum zu mindern, in dem sie in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern auf Raves die KonsumentInnen aufklären, auf was sie bei Gebrauch bestimmter Drogen achten sollten, z.B. kein Mischkonsum mehrere Drogen oder ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
Um das HIV und Hepatitisrisiko zu mindern, befassen sich
verschiedene Konzepte damit, die i.v.-gebrauchende KonsumentInnen über verschiedene Gebrauchsformen und -regeln zu unterrichten, die eine Ansteckungsgefahr mindern oder unterbinden. Dazu gehört u.a. der Hinweis, Spritzen nicht zu tauschen oder Heroin nicht zu injizieren, sondern zu rauchen sowie den, der Prostitution nachgehenden drogenabhängigen Frauen über Safer-Sex-Regeln zu informieren.
In Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland ist dieser Bereich bereits relativ gut strukturiert, in den südlichen Ländern herrschen hier noch große Defizite, ebenso in Frankreich. Die nordeuropäischen Staaten haben mit dem Aufbau von sekundärprä- ventiven Maßnahmen vor einiger Zeit begonnen.207 81
7 Abschlußbetrachtung
Eine abschließende Betrachtungsweise der Lösungsstrategien zur
Drogenproblematik verdeutlicht prinzipiell zwei Tendenzen: eine
Verschärfung und weitere Aufrüstung im Kampf gegen die Drogen oder die Abrüstung und zunehmende Liberalisierung durch eine
schadensminimierende, pragmatische und akzeptierende Politik.
Wie in der Analyse dargestellt, wird weiter von der Vorstellung ausgegangen, daß die Repression das wichtigste Mittel ist und Vorrang vor gesundheitlichen und sozialen Interventionen besitzt. Alle repressiven Maßnahmen konnten dabei in den letzten Jahren das Problem weder lösen noch eine Ausweitung verhindern. Der Konsum von Drogen bewegt sich nach wie vor auf hohem Niveau, die Zahl der KonsumentInnen ist nicht rückgängig. Selbst Maßnahmen wie der „große Lauschangriff“ und damit die Aufweichung einiger Grundrechte zeigen, daß die organisierte Kriminalität einfach über die besseren Ressourcen verfügt und am längeren Hebel sitzt.
Ein Blick in die Zukunft läßt vermuten, daß auf diesem Weg das
Drogenproblem nicht zu lösen ist. Es ließe sich aber begrenzen. Dies setzt aber zunächst einmal voraus, daß ein Umdenken in allen Teilen der Gesellschaft nötig ist und zwar nach dem Motto „mit Drogen leben“, nicht die Drogen mit allen staatlichen Mitteln bekämpfen. Angesichts einer europäischen Einigung sollte die EU darauf hinarbeiten, ein einheitliches, umfassendes Konzept zu erarbeiten. Mit dem Hintergrund, daß das Drogenproblem von einer europäischen und weltweiten Dimension ist, muß der Ansatz ein internationaler sein.
Eine neue Konzeption muß sich deshalb von der Abstinenz zur Akzeptanz wandeln, von der Repression zur Liberalität. Dazu ist eine internationale, zumindest europäische Vereinheitlichung und Harmonisierung in der Drogenpolitik notwendig. Alle weiteren Maßnahmen sollten auf jeden Fall versuchen, den Abhängigen so weit wie möglich zu helfen, dabei aber weiterhin gegen das internationale Verbrechen vorzugehen und Gewinne aus dem Drogenhandel unmöglich zu machen. Das Drogenproblem als solches ist nicht lösbar. Der Schaden läßt sich aber auf ein erträgliches Maß begrenzen. Der Grundsatz muß Integration und Vorbeugung statt Ausgrenzung und Bestrafung der KonsumentInnen sein.
Dabei muß innerhalb der EU das Strafrecht harmonisiert werden. Eine
Angleichung ist sowohl aus der Sicht des Verfolgungssystem durch eine
bessere Optimierung als auch der Betroffenen notwendig. Sie muß der Potenz der Drogenkartelle als auch des Elends der Abhängigen gerecht werden. Konkret impliziert dies eine Entkriminalisierung der KonsumentInnen, einhergehend mit gezielter Repression gegen das Organisierte Verbrechen, und zwar ausschließlich gegen dieses.
Dazu sollte als erster Schritt eine Trennung der Märkte erfolgen, am Beispiel Holland orientiert, bis hin zu einer Überlegung der Freigabe aller Drogen, je nach Gefährlichkeit mit unterschiedlichen Zugangs- und
Kontrollmöglichkeiten. Die Abgabe von Heroin an Schwerstabhängige ist eine der ersten Maßnahmen.
Der Vergleich der Drogenproblematik der EU hat gezeigt, daß zur
Durchsetzung der Abstinenz die harte Linie genauso erfolglos ist wie die liberale. Ob eine gezielte Drogenfreigabe ein wirksames Mittel ist, um den Schwarzmarkt zu zerstören, muß sich noch herausstellen. Dies kann nur durch verschiedene Modellprojekte mit einer Evaluierung geschehen, die als Grundlage dienen können, um weitere Bestrebungen in Gang zu leiten. Großbritannien und die Schweiz haben darin schon einige Fortschritte mit durchaus positiven Erfolgen vorzuweisen.
Allerdings gilt es zu bedenken, daß gewöhnliche Wähler Angst vor Drogen haben und DrogenkonsumentInnen ablehnend gegenüberstehen. Die bestehende Politik der Prohibition zu verändern ist sehr einfach falsch zu interpretieren als nachlässige Art im Umgang mit Drogen. Eine umfassende Konzeption muß deshalb auch verstärkt präventive Maßnahmen fördern, um den KonsumentInnen den richtigen Umgang mit Drogen zu lehren und darf nicht mit rein abschreckenden Aufklärungskampagnen, die mehr Schaden anrichten als das sie nützen, eine Hetzjagd auf Drogen und ihre Opfer in Gang setzen.
Eine Aufklärung sollte nicht stigmatisieren und manchmal sogar
kriminalisieren. Nicht die Droge an sich ist gefährlich, sondern nur ihr
Umgang und die gesellschaftliche Kriminalisierung durch die Illegalität. Es soll auch nicht darum gehen, eine Verharmlosung von Drogen oder ein Aufforderung zum Konsum zu leisten, sondern eine an die Lebenswelt der KonsumentInnen orientierte Aufklärung. Dies erfordert auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung, Drogenabhängige nicht als Randgruppen auszugrenzen, sondern sie in die Gesellschaft zu integrieren und teilhaben zu lassen.
Mit Drogen leben, mit ihnen Umgehen zu können und denjenigen mit allen verfügbaren Mitteln helfen, die Probleme mit Drogen haben. So sollte eine zukünftige Politik aussehen. Ein langer Weg, vielleicht ebenso eine Utopie wie die drogenfreie Gesellschaft, aber um einiges wirklichkeitsnaher und realistischer als das, was durch den bisherigen Kampf gegen die Drogen erreicht wurde.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: WHO-Drogentypologie. Quelle: Böllinger, L.: Drogenpraxis, Drogenrecht, Drogenpolitik, Frankfurt 1995,S. 26
Abbildung 2: Drogenwirkungsweise. Quelle: Zurhold H.:, Drogen konkret, Münster 1996 Abbildung 3: Drogenerfahrung (Lifetime-Prävalenz). Quelle: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.16
Abbildung 4: Drogenkosum innerhalb der letzten 12 Monaten. Quelle: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.16
Abbildung 5: Drogenerfahrung mit Cannabis im Jugendalter. Quelle: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.17
Abbildung 6: Drogenerfahrung auf Lebenszeit von 15-16jährigen Schülern. Quelle: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.18
Abbildung 7: Lifetime-Prävalenz 12-25jähriger in Westdeutschland. Quelle:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 1997, Köln 1998, S.52
Abbildung 8: 12-Monats-Prävalenz bei Technobesuchern. Quellen: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.75; Tossmann, P.: Repräsentative Befragung von Mitgliedern der Techno-Szene, Köln 1998, S.30
Abbildung 9: Konsumenten harter Drogen. Quelle: Interpol (Hrsg.): The drug problem: facts and figures, New York, 1998, o.S.
Abbildung 10: Drogentote in Europa. Quelle: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.25
Abbildung 11: Drogentote pro hunderttausend Einwohner. Quelle: BKA (Hrsg.): Rauschgiftjahresbericht 1997, Wiesbaden 1998, Tabelle 33
Abbildung 12: Drogentote in Europa. Quellen: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.25; BKA (Hrsg.): Rauschgiftjahresbericht 1997, Wiesbaden 1998, Tabelle 33 Abbildung 13: Beschlagnahmte Menge an Cannabis in Europa. Quellen: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.35f; BKA (Hrsg.): Rauschgiftjahresbericht 1997, Wiesbaden 1998, Tabelle 34
Abbildung 14: Menge des beschlagnahmten Heroins in Europa. Quellen: EMCDDA:
Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.35f; BKA (Hrsg.): Rauschgiftjahresbericht 1997, Wiesbaden 1998, Tabelle 34
Abbildung 15: Beschlagnahmte Menge an Kokain in Europa. Quellen: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.35f ; BKA (Hrsg.): Rauschgiftjahresbericht 1997, Wiesbaden 1998, Tabelle 34
Abbildung 16: Beschlagnahmte Menge an Amphetamine in Europa: Quellen: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.35f ; BKA (Hrsg.): Rauschgiftjahresbericht 1997, Wiesbaden 1998, Tabelle 34
Abbildung 17: Länder mit der größten beschlagnahmten Menge Ecstasy 1997. Quellen: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.35f; BKA (Hrsg.): Rauschgiftjahresbericht 1997, Wiesbaden 1998, Tabelle 34
Abbildung 18: Gesellschaftliche Kosten der Prohibition. Quelle: Der Spiegel: Tödlich guter Stoff, Hamburg 5/1997, S.46
Abbildung 19: Beispiel des Organisationsaufbaus eines Drogenkartells. Quelle: Thamm, B. G.: Drogenfreigabe, Hilden 1989, S.235
Abbildung 20: Verteilung der Gewinne aus dem Drogengeschäft. Quelle: EU (Hrsg.): Die Europäische Union im Kampf gegen Drogen, Luxemburg 1998, S.14 Abbildung 21: Parameter von Drogenpolitik und Drogenarbeit. Quelle: Rausch, C.: Drogenarbeit und Drogenpolitik in Europa, Berlin 1995, S.5
Abbildung 22: Inhaftierung wegen Cannabis-Delikte in den USA. Quelle: Hanf (Hrsg): Inhaftierung wegen Cannabis, o.O. 1/99 S.13
Abbildung 23: Aussagen zur Drogenpolitik. Quelle: Behr, H.-G.: Von Hanf ist die Rede, Frankfurt 1995, S.368
Abbildung 24: Schritte der Prohibition im 20. Jahrhundert. Quelle: Delachaux, M.: Drogues et législation, Lausanne 1977, S.234
Abbildung 25: Gremien der Vereinten Nationen zur Drogenkontrolle. Quelle: Rausch, C.: Drogenarbeit und Drogenpolitik in Europa, Berlin 1995, S.132
Abbildung 26: 10 Jahre Drogenbekämpfung der EU. Quelle: Europäische Kommission: Die EU im Kampf gegen Drogen, Luxemburg 1998, S.6.
Abbildung 27: Drogenklassifizierung in einigen Ländern. Quelle: EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.96
Abbildung 28: Reintegration, Rehabilitation und Beratungsmöglichkeiten in Deutschland Abbildung 29: Schadensminimierende Maßnahmen
Abbildung 30: Anzahl der Personen in Substitutionsbehandlung. Quelle: Vgl.. EMCDDA: Annual report of 1997, Lissabon 1998, S.57
Literaturliste
Aeberhard, P. J.: The politics of harm reduction in France, In: International journal of drug policy o.O. 4/1996
Bauer, C.: Heroinfreigabe. Möglichkeiten und Grenzen einer anderen Drogenpolitik, Hamburg 1992
Behr, H.-G.: Von Hanf ist die Rede, Frankfurt 1995
Beith, A.:, The drugs policy dilema In: Drugsedition 1998 o.O.
Böllinger, L.: Drogenpraxis, Drogenrecht, Drogenpolitik, Frankfurt 1995
Bundesgesundheitsministerium (Hrsg.): Drogen- und Suchtbericht 1998, o.O. 1999 Bundeskriminalamt (Hrsg.): Kurzbericht zur Rauschgiftlage 1998, Wiesbaden 1999 Bundeskriminalamt (Hrsg.): Rauschgiftjahresbericht 1997, Wiesbaden 1998
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 1997, Köln 1998
Cattacin, S.: Drogenpolitische Modelle. Eine vergleichende Analyse sechs europäischer Realitäten, Zürich 1996
Rossi, C.: Evaluating world drug policies, In: International journal of drug policy, o.O. 5/1996
Commission of the european communities (Hrsg.): Communication from the commission to the council and the european parliament on a european union action plan to combat drugs, Brüssel 1994
Da Costa, N.: National drug research situation and idendification of research needs in Portugal, Lissabon 1996
Delachaux, M.: Drogues et législation, évolution des mesures de controle er des mesures répressives prévues par les conventions internationales er la législation féderale sur les stupéfiants, Lausanne 1977
Der Spiegel Spezial: Geißel Rauschgift; Hamburg 1/1989
Der Spiegel: Illusionen von gestern, Hamburg 24/1998, S.86-87 Der Spiegel: Tödlich guter Stoff, Hamburg 5/1997, S. 36 - 54 Drugsedition (Hrsg.): Drug use in member states, o.O. 1998
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) (Hrsg.):
Zusammenfassung über den Stand der Drogenproblematik in der EU 1997, Lissabon 1998
Europäische Kommission (Hrsg.): Die Europäische Union im Kampf gegen Drogen, Luxemburg 1998
Europäische Kommission (Hrsg.): Konferenz über Drogenpolitik in Europa, Brüssel 1996 Europäisches Parlament (Hrsg.): Der Kampf gegen Drogen, Brüssel 1996
European monitoring centre für drugs and drug addiciton (EMCDDA) (Hrsg.): Annual report on the state of the drugs problem in the european union for 1997, Lissabon 1998
Europäische Union (Hrsg.): Die Europäische Union im Kampf gegen Drogen, Luxemburg 1998
EUROPOL (Hrsg.): Jahresbericht 1997, Den Haag 1998 Fachlexikon der Sozialen Arbeit, Frankfurt 1993 Gabriel, O.: Die EU-Staaten im Vergleich, Opladen 1994
Hamacher, H.-W.: Tatort Bundesrepublik: Organisierte Kriminalität, Hilden 1986 Hanf (Hrsg): Inhaftierung wegen Cannabis, o.O. 1/99 S.13
Harman, N.: Why politicians won´t legalise drugs, in: Drugsedition 1998 o.O.
Hug-Beeli, G.: Handbuch der Drogenpolitik. Tatsachen, Analysen, Lösungsvorschläge, Bern 1995
INDRO e.V. (Hrsg.): Reader zur niedrigschwelligen Drogenarbeit, Berlin 1994
Institut für Therapieforschung (IFT) (Hrsg.): Evaluation des Präventionsprojektes Mind Zone, München 1997
Interpol (Hrsg.): The drug problem: facts and figures, New York, 1998
Junge Linke (Hrsg.): Kein Mensch ist illegal. Handbuch gegen Abschottung, Selektion & Überwachung, Berlin 1998
Kamen, T.: Die Niederländische Drogenpolitik. Kontinuität und Wandel, in: Drugtext 6/95 o.O.
Phönix-Haus (Hrsg.): Rahmenkonzept, Remagen 1997
Observatoire Francais des Drogues et des Toxocomanies (OFDT) (Hrsg.): Drugs and drug addicition - indicators and trends, Paris 1996
Rabes M. und Harm W.: XTC und XXL. Wirkungen, Risiken, Vorbeugungsmöglichkeiten und Jugendkultur, Reinbek b.Hamburg 1997
Rausch, C.: Drogenarbeit und Drogenpolitik in Europa, Berlin 1995
Reuband, K.-H.: Drogenkonsum und Drogenpolitik. Deutschland und Niederlande im Vergleich, Opladen 1992
Schneider, W.: Der gesellschaftliche Drogenkult, Berlin 1996
Schneider, W.: Brennpunkte akzeptanzorientierter Drogenarbeit, Berlin 1997 Schmidbauer, W.: Handbuch der Rauschdrogen, Frankfurt 1998
Schmidt-Semisch, H.: Drogenpolitik. Zur Entkriminalisierung und Legalisierung von Heroin, Berlin 1990
Schnibben, C.: Unser Mann in La Paz. In: Der Spiegel, Hamburg 51/1997, S.116 - 126 Seeffelder, M.: Opium - Eine Kulturgeschichte, Frankfurt 1990.
Smoltczyk, A.: Tropenschnee via Afrika. In: der Spiegel, Hamburg 48/1997, S.138 - 167
SPD (Hrsg.): Drogenpolitik in Rheinland-Pfalz. Bestandsaufnahme und Perspektiven, o.O.1995
Süddeutsche Zeitung (Hrsg.): Ein Bayer an der Höllenpforte, Stuttgart 12/1993
Supp, B.: Der Drogenkrieg ist verloren. In: Der Spiegel, Hamburg 47/1997, S. 142 - 158
Thamm, B. G.: Drogenfreigabe - Kapitulation oder Ausweg?. Pro und Contra zur
Liberalisierung von Rauschgiften als Maßnahmen zur Kriminalitätsprophylaxe, Hilden 1989
Tossmann, P.: Repräsentative Befragung von Mitgliedern der Techno-Szene, Köln 1998 TRIMBOS Institute (Hrsg.): The drug situation in the Netherlands, Utrecht 1997
Uchtenhagen, A. u.a.: Medically controlled prescription of narcotics. A swiss national project, in: International journal of drug policy, 12/95 o.O.
United Nations (Hrsg.): Report of the international narcotics control board for 1997, Wien 1998
Vereinte Nationen (Hrsg.): Bericht des Internationalen Suchtstoffkontrollrats für 1990, Wien 1991
Vogt, I./Scheerer, S.: Drogen und Drogenpolitik. Ein Handbuch, Frankfurt/New York 1989 World Health Organisation (WHO) (Hrsg.): Public Health Report 1998, New York 1999 Zurhold, H.: Drogen konkret, Münster 1996
155
Typische Zielsetzungen sind:156
- Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstachtung
- Entwicklung von persönlichen und sozialen Fähigkeiten, mit
kritischen Lebensereignissen und Gruppendruck umzugehen
- Herausbilden einer kritischen Einstellung und Entschlußkraft zur eigenen und der Gesundheit anderer.
Durch umfangreiche staatliche Maßnahmen und Aktivitäten
versuchen mittlerweile einige Länder die Nachfrage zu reduzieren. 66
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Drogenproblem laut diesem Dokument?
Das Drogenproblem wird als ein vielschichtiges Problem dargestellt, das sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Folgen hat. Es betrifft nicht nur die Konsumenten selbst, sondern auch die Gesellschaft durch Kriminalität, Gesundheitskosten und soziale Ausgrenzung. Das Dokument beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Drogenkonsums, von den Substanzen selbst über den Drogenmarkt bis hin zu den Lösungsansätzen.
Welche Drogen werden in diesem Dokument hauptsächlich behandelt?
Das Dokument konzentriert sich auf illegale Drogen wie Cannabis (Haschisch, Marihuana), Heroin, Kokain (Crack), Amphetamine (Speed, Pep), Ecstasy und LSD. Es werden Wirkungsweisen, Risikopotential, Konsumformen und die rechtliche Situation dieser Drogen beschrieben.
Wie ist der Drogenmarkt in der EU organisiert?
Der Drogenmarkt in der EU wird als ein international operierender Wirtschaftsapparat beschrieben, der nach den Mechanismen einer freien Marktwirtschaft funktioniert. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Verschiedene kriminelle Organisationen sind am Drogenhandel beteiligt, und die Gewinne werden oft durch Geldwäsche in legale Wirtschaftsbereiche investiert.
Welche internationalen Lösungsstrategien zur Drogenbekämpfung gibt es?
Die internationalen Strategien basieren hauptsächlich auf den Abkommen und Verträgen der Vereinten Nationen (UN), wie dem Einheitsabkommen von 1961, dem Zusatzabkommen über psychotrope Substanzen von 1971 und dem Wiener Abkommen von 1988. Die UN koordiniert Maßnahmen zur Reduzierung des Drogenangebots und der Nachfrage. Die EU beteiligt sich ebenfalls an der Drogenbekämpfung durch verschiedene Institutionen und Aktionspläne.
Welche nationalen Lösungsstrategien zur Drogenbekämpfung gibt es?
Die nationalen Lösungsstrategien stützen sich auf vier Bereiche: Repression, Prävention, Reintegration und Rehabilitation sowie Schadensminimierung. Die einzelnen Staaten der EU setzen unterschiedliche Schwerpunkte in diesen Bereichen, wobei die Repression oft die größte finanzielle Unterstützung erhält. Die Betäubungsmittelgesetzgebung, die Prozessrechtssysteme und die verschiedenen Therapieangebote variieren in den einzelnen Ländern.
Was versteht man unter "Schadensminimierung" (Harm Reduction)?
Schadensminimierung ist eine Strategie, die darauf abzielt, die negativen Folgen des Drogenkonsums zu reduzieren, auch wenn eine Abstinenz nicht erreicht wird. Dazu gehören Maßnahmen wie die Verteilung steriler Spritzen, die Einrichtung von Gesundheitsräumen (Fixerräumen) und die Substitutionsbehandlung mit Ersatzstoffen wie Methadon.
Welche Rolle spielt die Substitutionstherapie in der Drogenpolitik der EU-Staaten?
Die Substitutionstherapie mit Ersatzstoffen wie Methadon hat sich in den meisten EU-Staaten etabliert. Die Ziele sind die gesundheitliche Verbesserung, die soziale Reintegration und die Beendigung des Konsums illegaler Drogen. Die Anforderungen und die Reichweite der Programme variieren in den einzelnen Ländern.
Wie unterschiedlich sind die Gesetze gegen Drogen in Europa?
Die Strafen sind sehr unterschiedlich. So werden geringe Mengen für Eigenbedarf in manchen Ländern geduldet oder nicht verfolgt, in anderen aber sehr streng bestraft. Der Handel und die Produktion von Drogen ist in allen Ländern illegal. Hier gibt es aber auch verschiedene Abstufungen, je nach Menge und Art der Droge.
Was sind die Schlussfolgerungen dieses Dokuments?
Das Dokument schließt mit der Feststellung, dass ein Umdenken in der Drogenpolitik notwendig ist. Anstatt auf Repression zu setzen, sollte eine akzeptierende und pragmatische Politik verfolgt werden, die den Fokus auf Schadensminimierung legt. Die EU sollte eine einheitliche Strategie entwickeln und die verschiedenen Länder harmonisieren ihre Gesetze. Das Drogenproblem kann nicht gelöst werden, aber der Schaden lässt sich auf ein erträgliches Maß begrenzen.
- Quote paper
- Holger Faust (Author), 1998, Drogen ohne Grenzen - Drogenarbeit und Drogenpolitik in der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105694