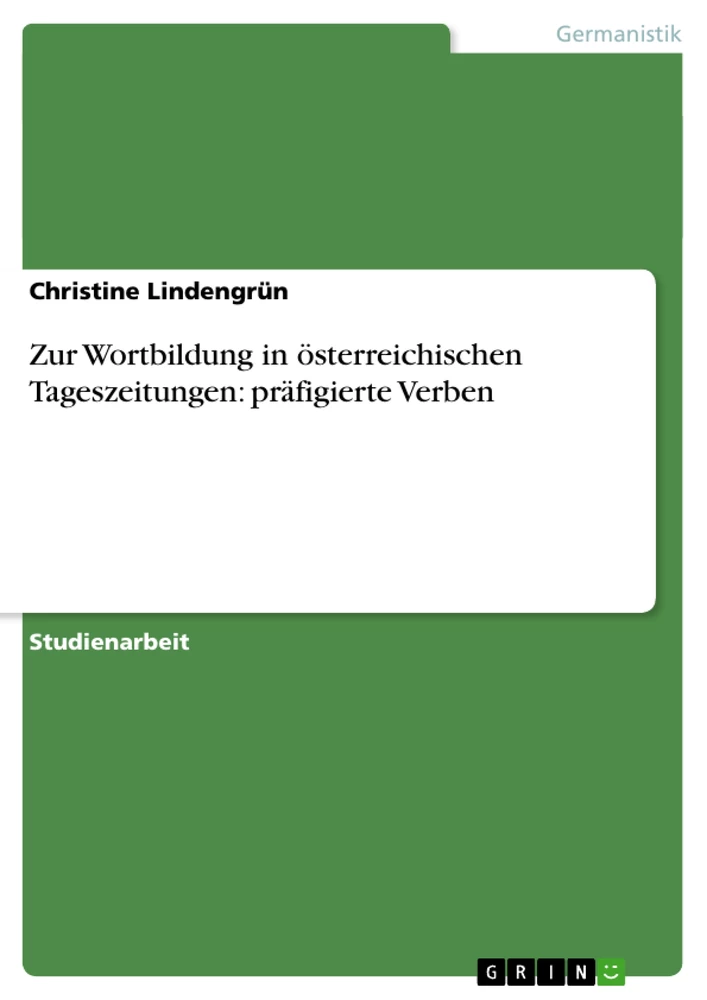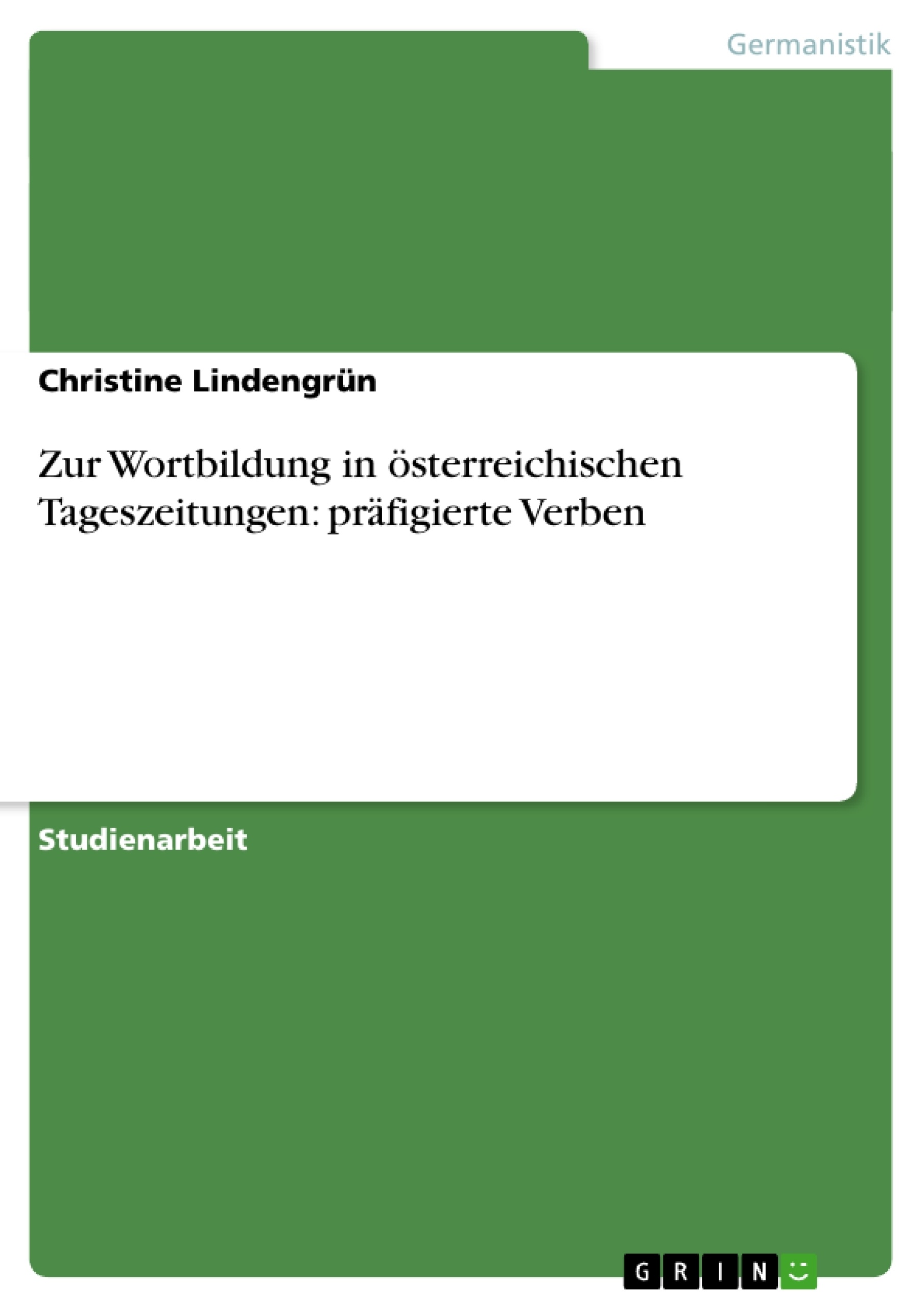Sprache formt Realität – oder ist es umgekehrt? Tauchen Sie ein in eine faszinierende Analyse der deutschen Verbpräfigierung, aufgespürt in den Tiefen einer österreichischen Tageszeitung. Diese linguistische Detektivarbeit enthüllt nicht nur die Häufigkeit verschiedener Präfixe im Kontext der Universitätsreformdebatte des Jahres 2001, sondern entschlüsselt auch die subtilen semantischen Veränderungen, die sie bewirken. Entdecken Sie, wie trennbare und untrennbare Präfixe die Bedeutung von Verben auf überraschende Weise modulieren, von räumlichen Nuancen bis hin zu modalen Abstufungen. Die Untersuchung deckt auf, dass die Wahl des Präfixes weit mehr als nur grammatikalische Konvention ist; sie ist ein Fenster zur kognitiven Verarbeitung von Ereignissen und Beziehungen. Das Herzstück dieser Analyse ist die Entwicklung eines umfassenden Klassifikationssystems, das darauf abzielt, die semantischen Funktionen aller Verbpräfixe zu erfassen – ein ehrgeiziges Unterfangen, das selbst vermeintlich idiomatisierte Verben zugänglich macht. Vergleiche mit anderen Textsorten und linguistischen Studien offenbaren dabei unerwartete Verschiebungen in der Häufigkeitsverteilung und semantischen Gewichtung einzelner Präfixe, insbesondere des omnipräsenten "be-". Ist "be-" tatsächlich das semantisch leerste aller Präfixe, oder verbirgt sich hinter seiner scheinbaren Bedeutungslosigkeit eine tieferliegende syntaktische und wortbildende Funktion? Die Antwort liegt in der innovativen Gegenüberstellung von semantischer Transparenz und motivierender Kraft, die diese Arbeit zu einem Muss für Linguisten, Germanisten und alle macht, die sich für die feinen Unterschiede und verborgenen Mechanismen unserer Sprache interessieren. Lassen Sie sich von der Präzision der Analyse und der Fülle an Erkenntnissen überzeugen, die weit über die bloße Erfassung von Sprachdaten hinausgehen und ein neues Licht auf die kreative und ökonomische Natur der deutschen Wortbildung werfen. Eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Kraft der Präfixe, die zeigt, wie scheinbar kleine sprachliche Elemente unsere Denkweise beeinflussen und unsere Welt formen. Diese Arbeit ist somit ein unverzichtbarer Beitrag zur germanistischen Linguistik und bietet wertvolle Einblicke in die Funktionsweise des deutschen Sprachsystems. Ergründen Sie die Geheimnisse der Verbpräfigierung und entdecken Sie, wie diese subtilen sprachlichen Elemente unsere Wahrnehmung der Welt prägen. Ein Muss für jeden, der die deutsche Sprache wirklich verstehen will, über den alltäglichen Gebrauch hinaus.
0. EINLEITUNG
0.1. Allgemeines
In der deutschen Sprache spielt die Präfigierung bei der Wortbildung des Verbs eine dominante Rolle. Im Gegensatz zur nominalen Wortbildung, die Suffigierung bevorzugt, sind es bei der verbalen Wortbildung die Präfixverben, die den Wortschatz enorm erweitern und differenzierte Ausdrucksweisen ermöglichen. Verbale Suffixe sind nur beschränkt produktiv. Dagegen gibt es kaum ein deutsches Verb, das nicht präfigiert werden kann. Die Produktivität der deutschen Präfixverben steht auch im Gegensatz zu anderen germanischen Sprachen, und zwar schon auf den Altstufen.
Trennbare und untrennbare Präfixe an Verben erfüllen zwei Funktionen: Sie modifizieren das Basisverb syntaktisch und/oder semantisch. Die semantische Funktion wird in dieser Arbeit im Vordergrund stehen.
0.2. Thematik und Zielsetzung
Im Rahmen dieser Arbeit werden präfigierte Verben in einer österreichischen Tageszeitung untersucht. Es wird der prozentuale Anteil der einzelnen Präfixe festgestellt und mit vorhandenen Daten verglichen.
Anschließend werden die ermittelten Verben in Hinblick auf ihre Semantik untersucht. Präfixe und Partikel verändern die Bedeutung des Basisverbs und erfüllen somit eine Funktion, die als semantische Modifikation bezeichnet wird. In der Literatur werden semantische Parameter und Klassen für jeweils einzelne Präfixe geschaffen. Darauf aufbauend wird nun versucht, ein Klassifikationssystem zu konstruieren, das alle Verbpräfixe inklusive Partikel erfasst. Zielsetzung ist es, alle Verben des Korpus in dieses System einzuordnen. Es werden sich dabei
Unterschiede zwischen echten Präfixverben und sogenannten Partikelverben ergeben. Besonderes Augenmerk wird auf die doppelförmigen Präfixe gelegt, da sie aus synchroner Sicht einen Übergang zwischen Präfix und Partikel darstellen. Wir gehen von der Annahme aus, dass die semantische Klassifikation bei untrennbaren Verbpräfixen schwieriger sein wird, da die so gebildeten Verben häufig idiomatisiert sind, ihre Motivation also nicht mehr ersichtlich ist.
1. KORPUS
1.1. Korpusgewinnung
Zur Gewinnung eines Korpus wurde die Tageszeitung Standard im Zeitraum 1. bis 31.März 2001 gewählt. Herangezogen wurden die Artikel zum Thema Dienstrechtsreform an den Universitäten. Die Textsorten umfassen Berichte und Kommentare. Leserbriefe zu diesem Thema wurden nicht berücksichtigt. Die am 1.März erschiene Beilage Uni-Standard wurde nicht in die Untersuchung miteinbezogen.
In den Korpus aufgenommen wurden alle präfigierten Verben, die im Text in einer finiten oder infiniten Form erscheinen, auch attributiv oder adverbial verwendete Partizipien. Die ermittelten tokens wurden in Lexeme umgewandelt und sind in dieser infiniten Form im Anhang ausgewiesen, alphabetisch geordnet und mit Quellenangaben versehen. Homonyme, also gleichlautende Lexeme mit unterschiedlicher Bedeutung, wurden als verschiedene Einträge gewertet und mit Indices unterschieden.
1.2. Begriffsbestimmung Verbpräfigierung und daraus resultierende Abgrenzung des Korpus
Unter präfigierten Verben verstehen wir verbale Wortbildung mit Präfixen. Darunter fallen nach Stiebels1:
-echte Präfixverben: Präfix und Basis sind nicht trennbar
-Partikelverben: Präfix und Basis sind
-) morphologisch trennbar, und zwar :
im Infinitiv (aufzuspringen)
im attributiv verwendeten Partizip I (auszubildende(r/s))
im Partizip II (aufgesprungen)
in bestimmten Nominalisierungen (das Aufgeheule)
-) syntaktisch trennbar: in der Verbklammer (springt auf)
Folgende Morpheme können sowohl als untrennbare Präfixe als auch als trennbare Partikel an Verben auftreten und werden deshalb auch als doppelförmige Präfixe bezeichnet: durch-,über-, um-, unter- und wieder-. Als untrennbare Präfixe sind sie unbetont (umf áßen), als trennbare Partikel betont (sich ú mschauen). Während die Präfigierung mit untrennbaren Präfixen eindeutig der derivationellen Wortbildung angehört, gestaltet sich bei den Partikelverben die Abgrenzung zur Komposition schwieriger. In der Literatur herrscht Übereinstimmung nur betreffend die Partikel: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, nach-, vor-, zu-, durch-,über-, um- und unter-. Diese werden überall als Wortbildungsmorpheme behandelt, damit präfigierte Verben als Derivate. Fleischer/Barz (1995)2 nehmen noch los- in diese Gruppe auf. Bei Erben (1993)3 gehört auch wieder- dazu und Olsen (1998)4 betrachtet auch hinter- und voll- als Verbalpräfixe. Verben mit hin-, her-, entgegen-, mit-, zusammen-, zurück- u.a. werden in der Literatur entweder als Komposita aufgefasst oder als Derivate. In letzterem Fall werden die Präfixe als Halbsuffixe oder Suffixoide bezeichnet.
Für unsere Arbeit richten wir uns nach den folgenden Bedingungen, die ein Wortbildungsmorphem erfüllen muss (nach Fleischer 1983)5:
1.) Es muss reihenbildend sein, d.h. es muss mit vielen Basen verbunden werden können.
2.) Es darf im Satz keine selbständige Funktion erfüllen, d.h. keine Satzgliedfunktion.
3.) Es muss eine Funktion in der Wortbildung haben, d.h. es muss Träger einer Wortbildungsbedeutung sein.
Nach dem Vorausgegangenen gehören Verben, die mit einem Adjektiv (festlegen, freistellen) oder mit einem Adverb (zurückweisen, zusammenfassen) gebildet werden, nicht zu unserem Thema, da sie Bedingung 2 nicht erfüllen. stattfinden und rückerstatten wurden deshalb nicht in den Korpus aufgenommen, weil sie Bedingung 1 nicht erfüllen.
Allerdings wurden in Abweichung von Fleischer/Barz (19952 ) auch die mit mit- gebildeten Verben berücksichtigt, da sie alle drei Bedingungen für Derivation erfüllen. mit ist eine Präposition und verhält sich als Präfix nicht anders als über oder bei.
Abweichend von Fleischer/Barz (19952 ) betrachten wir nicht nur deverbale Bildungen als Präfixderivation, sondern auch desubstantivische (befristen) und deadjektivische (veröffentlichen) Verbbildungen, welche dort als Präfixkonversion bezeichnet werden. In dieser Gruppe wurden von uns auch solche Verben berücksichtigt, die mittels Präfix und Suffix gebildet werden (Präfix-Suffix- Derivation, kombinatorische Derivation), z.B. berechtigen.
Fremdpräfixe wie re- und dis- wurden nicht berücksichtigt, da sie in unserem Korpus nicht an deutschen Basen verwendet wurden. Die Lexeme repräsentieren und reagieren wurden nicht als präfigierte Verben, sondern als zur Gänze entlehnt betrachtet.
2. TYPES UND TOKENS
Unter Berücksichtigung aller Voraussetzungen konnten im Beobachtungszeitraum 264 verschiedene präfigierte Verben ermittelt werden, wobei die Messung der token - Frequenz der einzelnen Verben keine überraschenden Ergebnisse lieferte. In Abhängigkeit vom Thema Universitätsreform waren die Verben anstellen (8mal), bewerben (6mal) und befristen (14mal, davon nur einmal als Verb, 13mal als adjektivisches Partizip II) relativ häufig vertreten. Weiters zeigten die Verben verstehen (8mal) und bestehen, entscheiden, erhalten, erwarten, vorschlagen (je 6mal) eine etwas höhere Frequenz als andere.
Die Messung der Häufigkeit der einzelnen präfigierten Verben als types zeigte folgende Ergebnisse:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Obenstehende Tabelle zeigt, wie oft die einzelnen Präfixe in unserem Korpus an verschiedenen Basisverben eingesetzt wurden. Insgesamt ist das Verhältnis zwischen trennbaren und untrennbaren Verbpräfixen relativ ausgewogen (140:124). Beide Arten der Verbpräfigierung scheinen im Gegenwartsdeutschen produktiv zu sein. Die Wortbildung mittels untrennbarer Präfixe entspricht dem im Deutschen bestehenden Trend zur Bildung fester Wortkomplexe. Gleichzeitig besteht aber ein Trend zur Bildung der Satzklammer. Diesem kommt die verbale Wortbildung mit trennbaren Präfixen entgegen.
Zur Häufigkeit der Verwendung von bestimmten Präfixen gibt es wenig Literatur. Einige Vergleiche können aber doch angestellt werden. Zuerst wurde die Häufigkeitsverteilung innerhalb der untrennbaren Präfixe prozentual errechnet. Anschließend wurden diese Zahlen verglichen mit der nach der Dudengrammatik6 zu erwartenden Verteilung. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse des Kollegen Batinic7 berücksichtigt, der präfigierte Verben in einer anderen österreichischen Tageszeitung untersuchte. Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt nachstehende Tabelle:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Ergebnisse zeigen, dass in Zeitungen eine Verschiebung der Häufigkeitsverteilung zugunsten der Präfixe be - und er - eintritt, während ver - und ent - relativ weniger verwendet werden.
Eine weitere Vergleichsmöglichkeit liefert Fleischer (1983)8: Eine Tabelle der Häufigkeitsverteilungen untrennbarer Präfixe in 4 literarischen Texten zeigt, dass diese sehr schwankt, sogar innerhalb einer Textsorte. Aber immer sind be- und ver die häufigsten, wobei meistens ver- an 1.Stelle liegt. Bei uns aber be -. Die Vorliebe für be -Verben scheint also spezifisch für die Textsorte Zeitungsartikel zu sein. Überlegungen dazu werden später angestellt.
Was die Häufigkeit trennbarer Präfixe betrifft, führt laut Duden ab- (597 Einträge) vor an- (510). Unsere Ergebnisse zeigen jedoch eine Umkehrung dieses Verhältnisses: 24 an- Verben vs. 19 ab- Verben.
3. SEMANTISCHE KLASSIFIKATION
3.1. Zielsetzung
Die gewonnenen Einträge sollten möglichst lückenlos nach ihrer semantischen Funktion klassifiziert werden. Ausgangspunkt meiner Arbeit war die Beobachtung, dass bei Fleischer/Barz (1995) ein Großteil der präfigierten Verben semantisch unklassifizierbar bleibt, mit der Begründung, sie seien zu stark idiomatisiert. Mir fiel auf, dass auch diese Verben zuordenbar werden, wenn man metaphorischen, abstrakten Gebrauch sozusagen wieder rückgängig macht, und sich eine konkretere Vorstellung ihrer Bedeutung macht. So ist zum Beispiel das Verb beibringen bei Fleischer/Barz als idiomatisiert von der Klassifikation ausgeschlossen, hat aber meiner Meinung nach durchaus eine lokal-relationale Bedeutungskomponente, auch wenn das, was zu jemandem gebracht wird, etwas Abstraktes ist, etwa eine Fähigkeit oder eine Meinung.
In der Hoffnung, mehr Lexeme klassifizieren zu können als sie, wurden die von Fleischer/Barz verwendeten Kriterien um einige erweitert.
3.2. Theoretische Grundlagen:
Verbpräfixe verändern das Basisverb semantisch und syntaktisch.9 Diese als Modifikationen bezeichneten Erscheinungen der verbalen Wortbildung sind folgendermaßen definiert:
3.2.1. Syntaktische Modifikation:
Präfixe können die Valenz des Basisverbs verändern. Das präfigierte Verb unterscheidet sich dann vom Basisverb in der Anzahl und Qualität seiner Aktanten. Folgende Phänomene können bei Verbpräfigierung beobachtet werden: Transitivierung: Aus einem intransitiven Verb wird durch Präfigierung ein transitives, z.B. lügen/jmdn.belügen Objektverschiebung: Die Aktanten verändern sich bezüglich ihrer Qualität, z.B. jmdm.etw.liefern/ jmdn. mit etw. beliefern Präpositionaltilgung: Präpositionen werden eingespart, indem ein Präpositionalobjekt zu einem Dativ- oder Akkusativobjekt (gegen jmdn. kämpfen/ jmdn. bekämpfen) oder zu einem passiven Subjekt wird (etw. in ein Beet pflanzen / das Beet bepflanzen).
Argumentsättigung: Ganze Aktanten werden eingespart, z.B. jmdn. etw. schenken/ jmdn. beschenken Durch Präpositionaltilgung und Argumentsättigung tragen präfigierte Verben zur Vereinfachung syntaktischer Strukturen bei. Syntaktische Modifikationen haben somit vielfach eine ökonomische Funktion.
3.2.2. Semantische Modifikation:
Präfixe verändern die Semantik des Basisverbs auf verschiedene Weise. Für unsere Arbeit verwenden wir dafür folgende Kategorien:
1. aktionale Abstufung: Das Präfix differenziert den Handlungsverlauf, ermöglicht eine Abstufung des zeitlichen Geschehens auf verschiedene Arten:
a) ingressiv (inchoativ): Das plötzliche Eintreten des vom Basisverb ausgedrückten Geschehens wird durch das Präfix markiert, z.B. in entbrennen.
b) egressiv (terminativ): Die Beendigung des vom Basisverb ausgedrückten Geschehens wird angezeigt, z.B. in verblühen.
c) resultativ: Das Präfix drückt aus, dass das Geschehen des Basisverbs zu einem Ziel geführt hat. Diese Modifikation ist gleichzeitig auch egressiv, z.B. ersteigern.
d) punktuell: Das Geschehen des Basisverbs wird auf einen kurzen Zeitraum limitiert, z.B. aufschreien.
e) Partialmarkierung (nach Stiebels 199610 ): Die Handlung des Basisverbs wird nicht vollständig ausgeführt, z.B. in anbraten. Diese Markierung enthält meist zugleich eine ingressive Bedeutungskomponente.
Weitere Funktionen der aktionalen Abstufung, die sehr selten sind und für unser Korpus nicht von Belang waren, sind: durativ (z.B. durchfeiern), kausativ (z.B. beschämen) und mutativ.
Die Funktionen in dieser Gruppe sind oft schwer zu trennen. Besonders die Trennung zwischen egressiver und resultativer, sowie zwischen punktueller und ingressiver Modifikation fällt oft schwer, da viele Präfixe beide Funktionen gleichzeitig erfüllen.
2. räumliche Einordnung des Geschehens (Raumbezogenheit)
a) dimensional: Das Präfix macht Angaben zu Lage und Richtung eines Geschehens, z.B. in aufschauen.
b) relational: Objekte werden in Beziehung zum Geschehen gebracht, z.B. in abfahren.
c) dynamisch: Das Präfix verdeutlicht die Entfernung eines Subjekts oder Objekts ohne Ziel der Bewegung, z.B. in verreisen.
Diese lokal-modifizierten Verben sind auch metaphorisch/abstrakt zu verstehen. So enthält das Präfix auf- in zu jmdn. aufschauen eine lokale Bedeutungskomponente, auch wenn dies in diesem Kontext metaphorisch zu verstehen ist. Im Verb annehmen ist immer eine lokal-relationale Bedeutung enthalten, auch wenn der Kontext ergibt, dass etwas Nicht-Konkretes, etwa eine Meinung angenommen wird.
3. temporale Einordnung des Geschehens: Hier wird nicht wie bei der aktionalen Abstufung das Geschehen des Basisverbs zeitlich untergliedert, sondern es wird das Geschehen als Ganzes in eine Beziehung zu einem Vorher oder Nachher gebracht, z.B. in vorgeben oder nachkaufen.
4. modale Funktionen : Hier verändern Präfixe die Art des Geschehens des Basisverbs.
a) reversativ: Das Präfix markiert die Umkehrung des Geschehens des Basisverbs, z.B. in abmelden.
b) Negation: Das Geschehen des Basisverbs wird negiert, z.B. in verachten.
c) "falsch": Das Präfix drückt aus, dass das Geschehen der Basis falsch oder schlecht ausgeführt wird, z.B. in verleiten.
d) "anders": Das Präfix drückt aus, dass etwas in anderer Art geschieht, z.B. in
umschreiben.
Es existieren noch weitere modale Funktionen, die für unsere Arbeit nicht benötigt wurden.
5. Intensivierung: Ein semantischer Inhalt der Basis wird durch die Funktion des Präfixes unterstützt, z.B. abstoppen: stoppen ist egressiv, ab- hier ebenfalls in egressiver Funktion. Intensivierende Präfixe sind redundant, sofern sie nicht noch eine andere Funktion haben.
6. ornative Funktion: Das Präfix drückt aus, dass etwas mit etwas versehen im weitesten Sinne wird. beladen, verschmutzen u.ä. Verben sind hier einzuordnen.
7. Objektbezogenheit
Diese Kategorie wurde von uns, in Analogie zu Raumbezogenheit, speziell für die be- Verben eingeführt, da sich diese selten in die semantischen Kriterien fügen, die für die anderen präfigierten Verben gelten. Objektbezogenheit umfasst jene Bedeutungskomponente, die umschrieben werden kann mit "auf etwas einwirken". Objekte werden durch die Präfigierung stärker in Bezug zur Tätigkeit des Basisverbs gebracht Bei Verben dieser Gruppe spielen syntaktische Modifikationen eine große Rolle. Einerseits können Objekte des Kontextes durch die Präfigierung des Verbs eingespart werden (Argumentsättigung): Bsp.: eine Stelle besetzen vs. jemanden
(AO) an eine Stelle setzen. Andererseits können Präpositionalobjekte in einfache Akkusativobjekte verwandelt werden: Bsp.: etwas (AO) bekämpfen vs. gegen etwas kämpfen.
3.3. Semantische Klassifikation des Korpus
3.3.1. Allgemeine Bemerkungen
Die Einordnung nach semantischen Merkmalen ist immer eine subjektive. Metaphorische, bzw. abstrakte Verwendung musste bei einem Thema wie diesem (Dienstrechtsreform) berücksichtigt werden, da sie in diesem Fall weitaus häufiger ist als die konkrete. So wurden z.B. einfrieren (Geldmittel) oder jmdm.etw.vorwerfen nach ihrer ursprünglichen konkreten Bedeutung bewertet, in der die Präfixe eine lokale Bedeutungskomponente tragen.
Bei der Berücksichtigung der Metaphorik wurde großzügig vorgegangen. So wurden z.B. den Verben aussehen und ausschauen raumbezogene Bedeutung zugestanden, nämlich eine lokal-dimensionale "nach außen".
Bei manchen Verben gestaltete sich die Einordnung äußerst schwierig und erforderte lange Überlegung. So wurden die Verben anrichten (Schaden) und anstehen (im Sinne von fällig sein, ausständig sein) letztlich den lokal-relationalen zugeordnet. Dies kann zugegebenermaßen etwas weit hergeholt erscheinen.
3.3.2. Trennbare Präfixe
ab -
Im Korpus waren insgesamt 19 mit ab - präfigierte Verben enthalten. Acht davon erfuhren durch die Präfigierung eine semantische Modifikation der lokal-relationalen Art im Sinne einer Distanzierung von etwas (sich abzeichnen, abhängen, ablehnen, ablenken, abnehmen, abputzen, abwandern, abweichen). Das Verb abschneiden im Kontext schlecht bei Prüfungen hat eine metaphorische Bedeutung, von der angenommen wurde, dass sie aus einer lokal-relationalen hervorgegangen ist.
Dreimal war die semantische Modifikation eine modal-reversative: Durch das Präfix wird das Geschehen des Basisverbs umgekehrt (abbauen, absagen, abschaffen). Eine egressiv-resultative Komponente ist in den Verben absegnen, abhalten (im Kontext Lehrveranstaltung), abhelfen, abdecken, abschließen und abklären enthalten, wobei bei den letzten beiden die Bedeutung schon im Basisverb liegt und durch das Präfix nur intensiviert wird.
Im Verb abschwächen intensiviert das Präfix die lokal-dimensionale Bedeutung "nach unten" des Basisverbs.
Wir kommen also zu folgendem Ergebnis:
lokale Modifikation (9), aktionale Abstufung (4), modale Modifikation (3), Intensivierung (3) = 19
an -
Von den 24 mit an - präfigierten Verben zeigte die Mehrzahl eine lokal-relationale Bedeutungskomonente im Sinne einer Berührung, Zuwendung oder eines Näherkommens. Es waren dies: anmelden, anwenden, antreffen, anvisieren, anbieten, ankommen, annehmen, anpeilen, anprangern, anschließ en, ansprechen, anstellen und antasten.
Schwierigkeiten bei der Zuordnung ergaben sich bei den Verben anrichten (Schaden) und anstehen (Probleme). Ihnen wurde schließlich eine lokal-relationale Bedeutungskomponente zugewiesen, wenngleich diese sehr abstrakt ist. Eine lokal-dimensionale Modifikation "nach oben", bzw. "Vermehrung" bewirkt das Präfix in anheben und anlaufen (Kosten).
Zu den ingressiven Verben gehören: anfangen (idiomatisiert), angehen (Problem), ankündigen, anregen, sowie anhalten in der Bedeutung von jmdn. aktivieren, etwas zu tun.
Eine Partialmarkierung ist in den Verben anschlagen (Töne) und anzweifeln festzustellen.
Es ergibt sich somit folgende Aufteilung:
lokale Modifikation (17), aktionale Abstufung (7) = 24
auf-
In insgesamt 14 auf- Verben bewirkte das Präfix fünfmal eine egressiv-resultative Modifikation der Basis. Es waren dies: auffangen, auffassen, aufhören, auflösen und aufteilen.
Als ingressiv ist aufhorchen zu bezeichnen, auffordern als ingressiv-punktuell.
Eine lokal-dimensionale Bedeutung "nach oben", bzw. "Vermehrung" enthalten aufbauen, aufheben, auftreiben und aufzählen. In aufschieben ist die lokal- dimensionale Bedeutung eher "Entfernung", was bei auf -Verben sonst wenig üblich ist.
Wir erhalten also:
lokale Modifikation (7), aktionale Abstufung (7) = 14
aus -
18 aus -Verben waren im Korpus enthalten. Eine lokale Bedeutung "Entfernung", bzw. "nach außen" enthielten die Verben ausscheiden, ausschließen, aussprechen, ausstehen (fehlen), ausschreiben (Stelle/Posten) und auslösen. Auch die Verben auslegen, ausschauen, aussehen und aussetzen wurden, obwohl stark idiomatisiert, in diese Gruppe aufgenommen, da die lokal-relationale Motivation noch ersichtlich ist. Als lokal-dimensional ist ausweiten zu betrachten.
Eine egressiv-resultative Bedeutung ist festzustellen in ausbilden, ausgeben, ausgehen (im Sinne von aufgebraucht werden), auslaufen (enden) und austragen (Konflikt).
In zwei Verben hat das Präfix intensivierende Funktion, wobei in ausreichen die resultative Bedeutung der Basis verstärkt wird, in auswählen die lokal-relationale. Für die aus -Verben ergibt sich somit folgende Verteilung:
lokale Modifikation (11), aktionale Abstufung (5), Intensivierung (2) = 18
ein -
ein -Verben haben primär eine lokal-relationale Bedeutung "nach innen/hinein". Dies war der Fall bei einfrieren, sich einfinden, einrichten, einsetzen, einstellen2, einwerben, einsparen und einführen. Letzteres enthält gleichzeitig auch eine ingressive Bedeutung.Unter Berücksichtigung metaphorischer Verwendung sind in dieser Gruppe auch noch einholen, einfallen und einschränken anzuführen. Eine lokal-dimensionale Funktion von ein -Verben wird in der Literatur nicht angeführt. Wir konnten allerdings feststellen, dass in nicht wenigen Verben unseres Korpus das Präfix ein- eine lokal-dimensionale Funktion im Sinne einer Richtungsänderung aufweist. Wir sehen diese Funktion in einlenken, einschlagen (Richtung) und metaphorisch in einwenden, einräumen. Diese Abweichung von Fleischer/Barz u.a. hat aber keine Auswirkung auf unsere Ergebnisse, weil lokal- relationale und lokal-dimensionale Modifikation sogleich zusammengefasst werden. Dasgleiche gilt für die egressive Modifikation, die ich in dem Verb einstellen1 (Betrieb) sehe, und die es in der Literatur für ein- nicht gibt. Da ingressive und egressive Modifikationen bei meinen Ergebnissen letztlich in aktionale Abstufung zusammengefasst wurden, ist diese Diskrepanz nicht weiter von Belang.
Eindeutig ingressive Funktion hat das Präfix in einleiten und sich einschieß en auf etw. (idiomatisiert).
Intensivierung einer wahrscheinlich lokal-relationalen Komponente bewirkt das Präfix in einschätzen.
Nicht klassifizierbar ist für uns das Verb eintreten (für etw.).
Wir kommen schlieslich zu folgendem Ergebnis für die ein- Verben:
lokale Modifikation (15), aktionale Abstufung (3), Intensivierung (1), nicht klassifizierbar (1) = 20
durch - (trennbar)
Das einzige trennbare durch -Verb in unserem Korpus durchgehen (erfolgreich sein) wurde als resultativ-egressiv eingestuft.
aktionale Abstufung (1) = 1
mit -
In nur zwei Verben des Korpus fand sich das Präfix mit-: mitnehmen und mitbestimmen. Bei letzterem ist die Basis selbst schon ein präfigiertes Verb. Beiden wurde eine lokal-relationale Bedeutungskomponente zugesprochen, da durch das Präfix die Handlung der Basis in Bezug zu einem Objekt, bzw. Subjekt gebracht wird, und zwar im Sinne einer Berührung/Vereinigung.
lokale Modifikation (2) = 2
nach -
Von sechs ermittelten Belegen wiesen vier eine Modifikation der temporalen Einordnung auf: nachholen, nachweisen, nachkaufen und nachäffen. Ein Verb hatte lokal-relationale Bedeutung: nachhinken.
In einem Fall hatte das Präfix intensivierende Funktion: nachdenken.
lokale Modifikation (1), temporale Modifikation (4), Intensivierung (1) = 6
um - (trennbar)
Nur einmal wurde das Präfix um- als trennbares Präfix an einem Verb gebraucht: sich umschauen. Es hat hier die lokal-dimensionale Funktion "im Kreis".
lokale Modifikation (1) = 1
vor -
Unser Korpus enthielt insgesamt 12 mit vor - präfigierte Verben. Neun davon zeigten eine lokal-relationale Modifikation: vorfinden, vorgehen, vorlegen, vorherrschen, vorschlagen, vorschweben, vorstellen, vorwerfen, vorziehen.
Drei Verben wiesen temporale Modifikation auf: vorbereiten, vorsehen (planen) und vorgeben.
lokale Modifikation (9), temporale Modifikation (3) = 12
zu -
Fünf der insgesamt sechs ermittelten zu-Verben zeigten lokal-relationale Modifikation "in Richtung auf jmdn./etw.". Es waren dies: zuwenden, zustimmen, zustehen, zuhören und zugeben (abstrakter Gebrauch).
In einem Fall bewirkte das Präfix modale Modifikation "schließen/bedecken": zupragmatisieren.
lokale Modifikation (5), modale Modifikation (1) = 6
3.3.3. Untrennbare Präfixe
be -
Das Präfix be - ist dasjenige, das in unserem Korpus die häufigste Frequenz zeigte. Insgesamt 47 Verben waren mit be - präfigiert. Die semantische Klassifikation dieser Verben ist ungleich schwieriger als die aller anderen Gruppen. Bei Fleischer/Barz (19952 ) finden wir keine Lösung. Sie beschränken sich auf die Aussage, die semantische Modifikation durch be - sei vage, und klassifizieren nach syntaktischen Parametern. Im Gegensatz dazu liefert Schröder (1991)11 ein äußerst umfangreiches Modell. Er stellt insgesamt 16 Klassen von be -Verben auf. Günther (1974)12 findet mit sechs Klassen das Auslangen, wobei er aber nicht die semantische Modifikation der Basis klassifiziert, sondern das abgeleitete Verb als eigene semantische Einheit betrachtet. Seiner Meinung nach kann die Bedeutung eines Präfixverbs nicht zerlegt werden in die Bedeutungen von Präfix und Basis. Sobald ein Verb präfigiert wird, nimmt es eine andere Bedeutungskomponente an, bzw. verliert Komponenten. Günthers Klassifikation erfolgt demnach nicht nach der Beziehung zwischen Basis und Präfix, sondern nach der Beziehung des Derivats zum Kontext.
Für unsere Zwecke sind Schröders und Günthers Klassifikationen zu umfangreich. Wir entnehmen für die be- Verben die Funktion "ornativ" und fassen die restlichen Klassen zusammen unter dem Begriff "Objektbezogenheit", der weiter oben definiert wird.13 In diese Kategorie lassen sich 14 unserer be -Verben einordnen, nämlich: befördern, begr üß en, behandeln, bejammern, bekämpfen, beklagen, beruhigen, beschleunigen, beschwichtigen, besetzen, besprechen, beteuern, bewerben und bezahlen.
Ornative Funktion haben die Verben befristen, begleiten14, begründen, belohnen, berechtigen, beschränken, beteiligen, beurteilen und bevorzugen. Drei Verben enthalten eine resultative Bedeutungskomponente: behalten, beheben und beschließ en.
Eine Intensivierung der Basis ist in befürchten, berufen, bestehen, betreffen und betreiben festzustellen.
Die restlichen Verben beantragen, bedürfen, befürworten, beginnen, behaupten, bekommen, benötigen, berichten, beschäftigen, bestätigen, bestimmen, betonen, betrachten, betragen, beweisen und bezeichnen bleiben nicht klassifizierbar. Das sind 34% unserer be -Verben. Dieses Ergebnis zeigt, dass unser vereinfachtes Klassifikationssystem ausreichend ist: Auch Günthers Modell erfasst nur 65% der be -Verben.
Wir kommen somit zu folgendem Ergebnis:
aktionale Abstufung (3), ornative Funktion (9), Objektbezogenheit (14), Intensivierung (5), nicht klassifizierbar (16) = 47
dar -
Die ermittelten Verben dieser Gruppe darlegen und darstellen zeigen lokalrelationale Modifikation.
lokale Modifikation (2) = 2
ent -
Dieses Präfix war in unserem Korpus siebenmal vertreten. In entfallen und entlassen hat es die lokal-dynamische Funktion "Entfernung", in entschuldigen eine modalreversative Bedeutung, in entstehen und entwickeln ist eine inchoative Komponente enthalten. Unklassifizierbar bleiben entsprechen und entscheiden.
lokale Modifikation (2), modale Modifikation (1), aktionale Abstufung (2), nicht klassifizierbar (2) = 7
er -
Insgesamt 26 Verben des Korpus waren mit er - präfigiert. Eine egressiv-resultative Komponente konnte festgestellt werden in: erarbeiten, ergreifen, erhalten, erkundigen, erreichen, erschöpfen, erwerben, erziehen und erwarten. Zu den Verben ergattern und erlangen existieren zwar keine Simplexverben, dennoch ist auch hier die egressiv-resultative Modifikation intuitiv festzustellen.
Ingressiv-punktuelle Funktion hat das Präfix in ermöglichen, eröffnen, erscheinen und sich erregen.
Eine bloße Intensivierung der Basis beirkt er - in erachten, erbringen, erfolgen, erhöhen, erklären, ernennen, erweitern und sich ergeben.
Die semantische Modifikation in erlauben, ersetzen und erzählen ist nicht mehr klassifizierbar.
aktionale Abstufung (15), Intensivierung (8), nicht klassifizierbar (3) = 26
ge-
Dieses Präfix wird vielfach nicht mehr als solches betrachtet, weil es nicht mehr produktiv ist und die damit präfigierten Verben meist so stark idiomatisiert sind, dass die Motivation nicht mehr ersichtlich ist. Auch bei den ge -Verben unseres Korpus war eine semantische Klassifikation in drei Fällen nicht möglich, weil das Basisverb nicht mehr als Simplex existiert: gelingen, genieß en, geschehen. Im Fall von gebrauchen ist aber eine Modifikation der Objektbezogenheit vorhanden, wie wir sie sonst nur bei den be -Verben finden.
Objektbezogenheit (1), nicht klassifizierbar (3) = 4
über - (untrennbar)
Mit über - präfigierte Verben waren in unserem Korpus neunmal vertreten, ausnahmslos in untrennbarer Verwendung. In sechs Verben zeigte das Präfix lokale Semantik: In überfahren, übergeben, übernehmen, überschneiden und übersehen ist eine lokal-relationale Komponente enthalten, wobei das Verb überfahren im Text metaphorisch gebraucht wurde. In überhöhen liegt eine lokal-dimensionale Modifikation der Basis vor.
Temporale Modifikation zeigt das Präfix in überleben, während überzeugen und überlegen aufgrund starker Idiomatisierung unklassifizierbar bleiben.
lokale Modifikation (6), temporale Modifikation (1), nicht klassifizierbar (2) = 9
um - (untrennbar)
Das doppelförmige Präfix um - wurde in unserem Korpus dreimal untrennbar verwendet. Zweimal bewirkt es eine lokal-relationale Modifikation der Basis mit der Bedeutung "von allen Seiten", und zwar in umfassen und in dem nur adjektivisch verwendeten umstritten. Eine modale Modifikation "anders" liegt in umschr é iben vor.
lokale Modifikation (2), modale Modifikation (1) = 3
unter - (untrennbar)
Das doppelförmige Präfix unter - wurde nur in untrennbarer Form gebraucht und zeigte lokal-relationale Modifikation: unterstützen und unterziehen.
lokale Modifikation (2) = 2
ver-
Diese sehr große Gruppe (38 Verben) war neben den be -Verben diejenige, die bei der Klassifizierung am meisten Schwierigkeiten bereitete. Elf Verben waren nicht klassifizierbar: verdienen, vergewissern, vergleichen, verheiß en, verlangen, vermissen, veranlassen, veröffentlichen, verstehen, versuchen und vertreten.
In sechs Verben war immerhin eine Intensivierung der Basis festzustellen. Es waren dies: verbessern, verhandeln, vermehren, verschulden, versprechen und verstärken. Neun Verben konnte eine egressiv-resultative Bedeutungskomponente zugesprochen werden: verändern, verbinden, vereinbaren, verfließ en, vergehen, verrotten, verschließ en, versperren und verwaisen.
In fünf Verben war eine lokal-dynamische Komponente "Entfernung" enthalten: vergeben, verlagern, verlassen, verteilen und verweisen.
Eine modale Modifikation "falsch" bewirkt ver- in verleiten, , verraten, verstimmen, verwechseln und verzerren. Die Verben verlieren und vergessen sind soweit idiomatisiert, dass das Basisverb nicht mehr erkennbar ist. Dennoch wurden sie in diese Gruppe eingereiht, da die Motivation "falsch" durch die Gesamtbedeutung noch klar ersichtlich ist.
Wir kommen also für die ver -Verben zu folgendem Ergebnis:
lokale Modifikation (5), aktionale Abstufung (9), modale Modifikation (7), Intensivierung (6), nicht klassifizierbar (11) = 38
wider -
Das einzige mit wider - präfigierte Verb unseres Korpus widersprechen zeigte die für dieses Präfix typische lokal-relationale Bedeutung.
lokale Modifikation (1) = 1
zer -
Auch dieses Präfix war nur einmal vertreten (zerschlagen) und hatte hier resultative Bedeutung.
aktionale Abstufung (1) = 1
3.3.4. Zusammenfassung
Die Einzelergebnisse der semantischen Klassifikation des Korpus wurden in prozentuale Anteile umgerechnet und sind in folgender Tabelle einander gegenübergestellt.
Semantische Funktion der einzelnen Präfixe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anm.: Bei den nicht fettgedruckten Präfixen gab es weniger als 5 Belege im Korpus.
Aus obenstehender Tabelle wird bereits ersichtlich, dass trennbare Präfixe wesentlich andere semantische Funktionen haben als untrennbare. Um diesen Unterschied deutlicher zu machen, wurden die Einzelergebnisse zusammengefasst und trennbare Präfixe den untrennbaren gegenübergestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. DISKUSSION
4.1. Semantische Transparenz
Wie aus den beiden obenstehenden Tabellen ersichtlich wird, besteht eine klare Diskrepanz zwischen trennbaren und untrennbaren Präfixen, was ihre semantischen Funktionen betrifft.
Trennbare Verbpräfixe sind semantisch transparenter als untrennbare. Ein hoher Prozentsatz hat die lokale Semantik der Präpositionen, aus denen sie hervorgingen, behalten. Wenn man metaphorische Verwendung berücksichtigt, sind sie meist auf diese zurückzuführen.
Doppelförmige Präfixe bilden den Übergang zwischen trennbaren und untrennbaren Präfixen. So werden die Präfixe unter - und um - in unserem Korpus zwar untrennbar an ihre Basen gebunden, sie sind aber im Vergleich zu den anderen untrennbaren Präfixen semantisch transparenter. Sie sind lokalen oder aktionalen Funktionen zuordenbar. Dafür gibt es folgende Erklärungen:
1.) um - und unter - gehören zur Gruppe der doppelförmigen Präfixe, d.h. sie sind an anderen Basisverben trennbar.
2.) Wie die trennbaren Präfixe werden sie in Form freier Lexeme als Präpositionen verwendet und haben (noch) überwiegend lokale Funktion.
Allerdings ist die Anzahl der Belege in unserem Korpus zu gering, um hier allgemeine Aussagen treffen zu können.
Etwas anders liegt der Fall bei den mit über- präfigierten Verben: über- wird häufiger als untrennbares Präfix eingesetzt als andere doppelförmige Präfixe und hat in vielen Fällen schon seine semantische Transparenz verloren, z.B. überlegen,überzeugen.
Bei den untrennbaren Präfixen sind es er-, be - und ver-, die am häufigsten verwendet werden. Auch sie sind ursprünglich aus Präpositionen hervorgegangen, haben aber eine Bedeutungsverschiebung erfahren. Sie sind bezüglich ihrer semantischen Modifikation schwer zuzuordnen, wenn, dann eher aktionalen Funktionen als lokalen.
Ein relativ hoher Prozentsatz dieser Präfixe ist redundant, weil nur intensivierend.
Insgesamt 26% aller untrennbaren Präfixe des Korpus konnten nicht klassifiziert werden, weil ihre Motivation nicht mehr ersichtlich ist. Dieser Prozentsatz steigt noch an, wenn man nur die häufig verwendeten Präfixe in dieser Gruppe (er-, ver- und be -) betrachtet. 1/3 aller be -Verben bleiben nicht klassifizierbar, auch wenn man neue Kategorien einführt (wie hier ornative Funktion und Objektbezogenheit). Ein Grund für die semantische Opakheit untrennbar präfigierter Verben liegt darin, dass sie älter sind als solche mit trennbaren Präfixen. be - ist schon im Althochdeutschen ein untrennbares Verbpräfix. Die semantische Motivation war höchstwahrscheinlich einmal vorhanden, ist aber im Lauf der Zeit verschwommen. Etymologisch haben die untrennbaren Präfixe be -, ver - und er - oft perfektiven Aspekt, d.h. sie zeigen einen abgeschlossenen Zustand an. Wenn Derivate schon lange Zeit im Wortschatz bestehen, gehen semantische Inhalte verloren, Bedeutungen nutzen sich ab. Teilweise kann die Motivation überhaupt nicht mehr nachvollzogen werden, weil die Basisverben gar nicht mehr als Simplexverben existieren. Dies ist der Fall bei insgesamt 14% aller untrennbar präfigierten Verben in unserem Korpus: erlangen, erlauben, beginnen, vergessen etc.
4.2. Intensivierung
4% der trennbaren Präfixe hatten eine intensivierende Funktion, d.h. sie bewirken eigentlich keine Bedeutungsveränderung des Basisverbs, sondern verstärken eine Bedeutungskomponente der Basis. Im Gegensatz zu den intensivierenden untrennbaren Präfixen lässt sich diese Bedeutung des Basisverbs, die verstärkt wird, ebenfalls einordnen in Raumbezogenheit oder aktionale Abstufung. So ist z.B. das Präfix aus- in ausreichen redundant, und daher nur intensivierend. Aber das Basisverb reichen enthält eine egressiv-resultative Bedeutung. Letztlich ist also in diesem Fall doch eine Zuordnung zur Klasse aktionale Abstufung möglich.
Bei den zur Intensivierung verwendeten untrennbaren Präfixen war eine solche Zuordnung meist nicht möglich, z.B. befürchten, verstärken, erbringen, erfolgen etc. Burghart Voigt (1992)15 nimmt daher neben semantischer und syntaktischer Modifikation noch eine dritte Funktion von Verbpräfixen an, nämlich eine stilistischpragmatische. So haben viele präfigierte Verben einen höheren stilistischen Wert als das Simplexverb. Als Beispiele führt er an: schaffen/erschaffen, retten/erretten, bauen/erbauen, bleiben/verbleiben, heben/erheben.
4.3. Aussersemantische Funktionen der be -Verben
Wie aus der Literatur und aus unserer eigenen Untersuchung hervorgeht, ist be - das bedeutungsärmste verbale Präfix. Obwohl die be -Verben so häufig demotiviert sind, sind sie (zumindest in der Textsorte Zeitung) die am häufigsten verwendeten präfigierten Verben. Man muss also annehmen, dass bei be -Verben andere Funktionen im Vordergrund stehen als semantische:
4.3.1.Syntaktische Funktion
Eine große Rolle spielen sicher die syntaktische Funktionen : Argumentsättigung, Tilgung von Präpositionen und damit Vereinfachung syntaktischer Strukturen16. Die in der Textsorte Bericht geforderte Satzkürze wird u.a. durch den Einsatz von be - Verben erreicht.
4.3.2. Denominale Wortbildung
Eine andere wichtige Funktion der be- Verben ist die der verbalen Wortbildung aus Substantiven und Adjektiven17. Während bei den trennbaren Verben nur 3 (nachäffen, anprangern und anvisieren) direkt von Substantiven abgeleitete sind, ohne dass ein Simplexverb dazu existiert, sind es bei den untrennbaren 26, also immerhin 18% (!), die als desubstantivische, bzw. deadjektivische Wortbildungen zu betrachten sind. 16 von diesen 26 sind be -Verben, z.B. beteuern, beschränken, bevorzugen etc.
Es stellt sich nun die Frage, warum die denominale Verbbildungen so häufig mit Präfixen versehen werden, wo doch einfache Konversion genügen würde. Warum heißt es also beruhigen und nicht * ruhigen. Susan Olsen (1990)18 gibt für dieses Phänomen drei Gründe an:
1) Durch ein Präfix wird ein Verb deutlicher als solches gekennzeichnet.
Punkt 3 erklärt viele Beispiele aus unserem Korpus wie benötigen, beruhigen, vergewissern, veröffentlichen, erweitern und entschuldigen: Wo die nominale Basis selbst schon ein komplexes Wort ist, muss das abgeleitete Verb ein präfigiertes sein.
5. ZUSAMMENFASSUNG
In dieser Arbeit wurden präfigierte Verben in einer österreichischen Tageszeitung untersucht. Die Häufigkeit der einzelnen Präfixe wurde ermittelt und dabei festgestellt, dass hier Diskrepanzen zu anderen Textsorten bestehen. Insbesonders ist es das Präfix be -, das auffällig häufig verwendet wird.
Die einzelnen Belege wurden nun semantisch klassifiziert. Zielsetzung war eine möglichst lückenlose Klassifikation, welche aber nur bei den trennbaren Präfixen erreicht werden konnte. Diese haben vorwiegend lokale Bedeutungskomponenten. Untrennbare Präfixe sind zu einem großen Prozentsatz demotiviert. Besondere Beachtung sollte den doppelförmigen Präfixen zukommen, was aber nicht möglich war, da sie mit Ausnahme von über - eine sehr geringe Frequenz aufwiesen. Hingegen ergab sich eine gesonderte Betrachtung der be -Verben aus zwei Gründen: be - ist das in unserem Korpus am häufigsten verwendete Präfix und es ist auch das Präfix, das sich am häufigsten der semantischen Klassifikation entzieht. Semantische Modifikation spielt hier offenbar eine weniger wichtige Rolle. Syntaktische Modifikation und denominale Wortbildung sind die Funktionen der be -Verben, die im Vordergrund stehen.
Sowohl trennbare als auch untrennbare präfigierte Verben weisen eine hohe type - Frequenz in der Textsorte Zeitungsbericht auf. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Verbpräfigierung eine der produktivsten Formen der deutschen Wortbildung ist. Sie erfüllt zwei wesentliche Anforderungen der Sprachentwicklung, nämlich Ausdifferenzierung semantischer Inhalte und Ökonomie des Ausdrucks.
Literaturverzeichnis
Duden (19955 ):Die Grammatik
Erben, Johannes (19933 ): Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. Berlin: Schmidt (Grundlagen der Germanistik 17)
Fleischer, Wolfgang (Hg)(1983): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer
Fleischer, Wolfgang u. Irmhild Barz (19952 ): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer
Günther, Hartmut (1974): Das System der Verben mit BE- in der deutschen Sprache der Gegenwart. Ein Beitrag zur Struktur des Lexikons der deutschen Grammatik. Tübingen: Niemeyer (Linguistische Arbeiten 23)
Olsen, Susan (1990): Konversion als ein kombinatorischer Wortbildungsprozeß. In: Linguistische Berichte 127. S.185-216
Olsen, Susan (Hg.) (1998): Semantische und konzeptuelle Aspekte der Partikelverbbildung mit ein-. Tübingen (Studien zur deutschen Grammatik 57)
Schröder, Jochen (1988): Präfixverben mit ver - im Deutschen. DaF 25. S.92-95, 172- 177, 204-208, 295-299
Schröder, Jochen (1991): Wieder einmal: BE-Verben. DaF 28. S.27-30
Stiebels, Barbara (1996): Lexikalische Argumente und Adjunkte. Zum semantischen Beitrag von verbalen Präfixen und Partikeln. Berlin (studia grammatica 39)
Voigt, Burghart /1992): Präfigierung und Abwandlung (Modifikation).DaF29.S.100- 104
ANHANG
Präfigierte Verben des Korpus in infiniter Form 19 mit Datum und Seitenangabe, z.B. 17./18.3/7(2mal) bedeutet: Das Verb wurde in der Ausgabe vom 17./18.März auf Seite 7 zweimal verwendet. Aus der Seitenangabe wird auch ersichtlich, ob es sich bei der Textsorte um einen Bericht oder einen Kommentar handelt: Seitenangaben zwischen 1 und 20 beziehen sich auf Berichte, bei Texten auf den Seiten 20 bis 40 handelt es sich um Kommentare.
Kontext oder Paraphrase werden in Klammern angegeben, wenn dies für die semantische
Klassifizierung des Verbs von Bedeutung ist.
abbauen 29.3./8, 13.3./7 (2mal)
abdecken (Kosten) 28.3./32
abhalten (Lehrveranstaltung) 16.3./8 abhängen 23.3./8
abhelfen 14.3./35 abklären 14.3./35
ablehnen 17./18.3/7, 24./25.3./9, 29.3./8 ablenken 12.3./23
abnehmen 1.3./10
abputzen 24./25.3./9 (2mal) absagen 16.3./8
abschaffen 14.3./35
abschließen 12.3./23, 29.3./8
abschneiden (bei Prüfungen) 28.3./8 abschwächen 29.3./8
absegnen 14.3./9
abwandern 14.3./35 abweichen 13.3./7
abzeichnen (sich) 17./18.3./40
anbieten 6.3./35, 7.3./8, 14.3./9, 29.3./8 anfangen 13.3./7
angehen (Problem) 14.3./35 anhalten (=auffordern) 13.3./7 anheben (Höchstgrenze) 28.3./8 ankommen 23.3./8
ankündigen 1.3./10, 6.3./6 , 13.3./7, 14.3./35, 21.3./34 anlaufen 6.3./35
anmelden 13.3./7
annehmen (Herausforderungen) 29.3./8 anpeilen 12.3./23
anprangern 12.3./23 anregen 14.3./35
anrichten (Schaden) 14.3./35 anschlagen (Töne) 6.3./6 anschließen 13.3./7 ansprechen 23.3./8
anstehen (=ausständig sein) 17./18.3./40
anstellen 7.3./8 (2mal) 14.3./9, 17./18.3./40, 19.3./6, 24./25.3./9 , 28.3./32, 29.3./8 antasten 28.3./32
antreffen 17./18.3./7 anvisieren 14.3./35
anwenden 12.3./23, 21.3./34 anzweifeln 13.3./7
aufbauen 28.3./32 auffangen 29.3./8 auffassen 21.3./34 auffordern 29.3./8
aufheben aufzuheben 12.3./23 aufhorchen 1.3./10
aufhören aufhört 12.3./24 auflösen 12.3./23
aufschieben 1.3./10, 24./25.3./9
aufschließen (=anschließen, aufholen) 12.3./23 aufteilen 13.3./7
auftreiben 12.3./23 aufwenden 13.3./7
aufzählen 13.3./7, 14.3./9
ausbilden 12.3./23, 23.3./10
ausgeben 6.3./35, 12.3./8, 13.3./7 ausgehen 6.3./35
auslaufen (=enden) 27.3./13
auslegen (=interpretieren) 24./25.3./9 auslösen 6.3./6, 29.3./8
ausreichen 6.3./35, 28.3./8
ausschauen es schaut aus 23.3./8 ausscheiden 14.3./35
ausschließen 12.3./23, 17./18.3./40 ausschreiben (Stellen) 1.3./10 aussehen 12.3./23
aussetzen 1.3./10, 16.3./8 (2mal)
aussprechen 2.3./7, 13.3./7 , 29.3./8 ausstehen (=fehlen) 6.3./35, 14.3./9 austragen (Konflikt)17./18.3./7 auswählen 12.3./24
ausweiten 8.3./8
beantragen 6.3./6, 13.3./7 bedürfen 12.3./23 (2mal)
befristen 1.3./10, 2.3./7, 7.3./8, 13.3./7, 14.3./9, 17./18.3./7, 23.3./10, 27.3./13 (3mal), 28.3./32, 29.3./8 (3mal)
befürchten 29.3./8 (3mal) befürworten 13.3./7
beginnen 12.3./24, 28.3./32 begleiten 28.3./8 (2mal) begründen 13.3./7 begrüßen 13.3./7 behalten 28.3./32 behandeln 12.3./8 behaupten 21.3./34 beheben 21.3./34
beiziehen 29.3./8
bejammern 24./25.3./9 bekämpfen 12.3./24 beklagen 24./25.3/9
bekommen 13.3./7, 28.3./32
belohnen 12.3./24, 13.3./7 (3x) , 23.3./8
benötigen 14.3./35, 29.3./8 berechtigen 29.3./8
berichten 3./4.3./10 berufen 21.3./34
beruhigen beruhigte 23.3./8
beschäftigen ist beschäftigt 24./25.3./9
beschleunigen beschleunigt 14.3./35
beschließen 2.3./7 (2mal), 16.3./8, 28.3./8 beschränken 1.3./10, 7.3./8
beschwichtigen 29.3./8 besetzen 28.3./32 besprechen 13.3./7
bestätigen 6.3./35, 28.3./8
bestehen 7.3./8, 12.3./23 (3mal), 14.3./35, 17./18.3/7 beteiligen 14.3./9
betonen 1.3./10, 17./18.3/7, 21.3./34 betrachten betrachtete 13.3./7
betragen 12.3./23 (2mal), 13.3./7, 14.3./9, 29.3./8 betreffen 2.3./7, 13.3./7
betreiben 6.3./35
beteuern 2.3. /7 beurteilen 29.3./8
bevorzugen 17/18.3./40 beweisen 6.3./6
bewerben (sich) 19.3./6, 21.3./34, 24./25.3./9, 27.3./13, 28.3./32, 29.3./8 bezahlen 23.3./8 (2mal)
bezeichnen 29.3./8
darlegen 24./25.3./9 darstellen 6.3./6
durchgehen (=angenommen werden) 29.3./8
einfallen 6.3./35
einfinden (sich) 29.3./8
einfrieren 28.3./32 , 28.3./8 einführen 6.3./35
einholen 14.3./9
einleiten 8.3./8, 16.3./8 einlenken 17./18.3./7
einräumen (=zugeben, einlenken) 13.3./7 (2mal) einrichten 6.3./35, 7.3./8
einschätzen 6.3./35
einschießen (=sich vorbereiten)13.3./7 einschlagen (Weg) 14.3./35
einschränken 13.3./7
einsetzen 6.3./6
einsparen 27.3./13
einstellen1 (=beenden) 27.3./13 einstellen2 (=anstellen) 6.3./35
eintreten (für etwas)7.3./8 (2mal), 14.3./35, 24./25.3./9 einwenden 27.3./13
einwerben 14.3./35
entfallen 17./18.3./7 adj. entlassen 12.3./23, 28.3./8
entscheiden 6.3./35, 7.3./8, 14.3./35, 17./18.3/7, 23.3./8, 28.3./32
entschuldigen 24./25.3./9 entsprechen 12.3./23 entstehen 28.3./32 entwickeln 12.3./24
erachten 7.3./8
erarbeiten 13.3./7
erbringen 7.3./8, 24./25.3./9 erfolgen 14.3./35 (2mal) ergattern 24./25.3./9 ergeben 21.3./34 ergreifen 13.3./7
erhalten 6.3./35, 12.3./24 (2mal), 13.3./7 (2mal), 21.3./34 erhöhen 6.3./35, 13.3./7 (2x)
erklären 6.3./6
erkundigen 13.3./7 erlangen 6.3./35 erlauben 12.3./23 ermöglichen 23.3./8 ernennen 14.3./35
eröffnen 21.3./34, 27.3./13 erregen 29.3./8
erreichen 12.3./23 (2mal) erscheinen 12.3./23 (2mal) erschöpfen 6.3./6
ersetzen 12.3./23
erwarten 14.3./35 (2mal), 27.3./13, 28.3./8 (2mal), 28.3./32 erweitern 8.3./8
erwerben 12.3./23, 29.3./8 erzählen 13.3./7
erziehen 29.3./8
gebrauchen 12.3./23 gelingen 29.3./8 genießen
geschehen 12.3./23
(hinaus)befördern 7.3./8
mitbestimmen 23.3./8 mitnehmen 6.3./35
nachäffen 6.3./35
nachdenken 12.3./24, 23.3./8 nachhinken 6.3./35
nachholen 16.3./8, 17./18.3./7 (2mal) nachkaufen 28.3./32
nachweisen 19.3./6
überfahren 17./18.3./40 übergeben 29.3./8 überhöhen 12.3./23 überleben 12.3./23
überlegen 13.3./7, 14.3/35 übernehmen 7.3./8 (2mal) überschneiden 17./18.3/7 übersehen 14.3./35 überzeugen 29.3./8
umfassen 12.3./8 umschauen 29.3./8 umschreiben 12.3./8
umstritten 13.3./7, 14.3./9, 23.3./10, 24./25.3./9, 28.3./8
unterstützen 8.3./8, 23.3./8, 29.3./8
unterziehen 28.3./32
verändern 12.3./23 veranlassen 12.3./23
verbessern 23.3./8 (2mal), 24./25.3./9 verbinden 12.3./23
verdienen 12.3./24, 13.3./7 vereinbaren 29.3./8
verfließen 14.3./35 vergeben 1.3./10
vergehen 6.3./35, 12.3./23, 29.3./8 vergessen 23.3./8
vergewissern 17./18.3/7 vergleichen 13.3./7
verhandeln 2.3./7, 23.3./10, 24./25.3./9, 29.3./8 verheißen verheißt 12.3./23
verlagern 3./4.3./10
verlangen 6.3./6, 8.3./8, 12.3./8, 17./18.3./7, 29.3./8 verlassen 7.3./8
verleiten 6.3./35
verlieren 17./18.3./40, 24./25.3./9, 29.3./8 vermehren 6.3./35
vermissen 7.3./8
veröffentlichen 13.3./7, 29.3./8 verraten 12.3./23
verrotten 12.3./23
verschließen 17./18.3./7 verschulden 6.3./6 versperren 13.3./7
versprechen 7.3./8, 12.3./23, 14.3./9, 27.3./13 verstärken 14.3./35 (2mal)
verstehen 6.3./6, 13.3./7, 14.3./35, 17./18.3./7, 19.3./6, 23.3./8, 29.3./8 (2mal) verstimmen (=verärgern) 14.3./35
versuchen 13.3./7, 14.3./35, 23.3./8 verteilen 23.3./8
vertreten 14.3./35 , 28.3./8 verwaisen 17./18.3./7 verweisen 13.3./7 verwechseln 12.3./23 verzerren 12.3./23
vorbereiten 3./4.3./10, 14.3./35, 19.3./6 vorfinden 27.3./13
vorgeben 23.3./8, 28.3./8 vorgehen 12.3./23
vorherrschen 6.3./35
vorlegen 12.3./23, 14.3./9, 28.3./8, 29.3./8
vorschlagen 1.3./10, 21.3./34, 23.3./8 (2mal), 27.3./13, 28.3./8, 28.3./32 vorschweben 12.3./23
vorsehen (=planen) 2.3./7, 13.3./7, 14.3./35, 17./18.3/7, 27.3./13, 28.3./8 vorstellen1 8.3./8, 29.3./8
vorstellen2 refl. 28.3./8
vorwerfen 6.3./35, 24./25.3./9, 27.3./13 vorziehen (=präferieren) 12.3./23
widersprechen 14.3./35
zerschlagen 14.3./35
zugeben 14.3./35 zuhören 29.3./8
zupragmatisieren 29.3./8 zustehen 6.3./6
zustimmen 23.3./8 zuwenden 27.3./13
[...]
1 s. Barbara Stiebels (1996): Lexikalische Argumente und Adjunkte. Berlin.S.39
2 s. Wolfgang Fleischer und Irmhild Barz (19952 ): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer
3 s. Johannes Erben (1993): Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. Berlin: Schmidt
4 s. Susan Olsen (1998): Semantische und konzeptuelle Aspekte der Partikelverbbildung mit ein -. Tübingen
5 s. Wolfgang Fleischer (1983): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer
6 s. Duden (19955 ):Die Grammatik 19955
7 s. Bruno Batinic: Präfigierte Verben in den Salzburger Nachrichtren zum Thema Balkankrise (=Seminararbeit zu Wortbildung inösterreichischen Tageszeitungen)
8 s. Wolfgang Fleischer (1983) Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.S.343
9 Burghart Voigt (1992) postuliert als dritte Funktion eine stilistisch-pragmatische Modifikation,
welche besonders bei den er -Verben zum Tragen kommt.Vgl. retten vs. erretten u.a. Vgl.Burghart Voigt (1992): Präfigierung und Abwandlung: Modifikation. DaF 29. S.100-104)
10 s. Barbara Stiebels (1996): Lexikalische Argumente und Adjunkte. Berlin
11 s. Jochen Schröder (1991): Wieder einmal: BE-Verben. DaF 28 S. 27-30
12 s. Hartmut Günther (1974): Das System der Verben mit BE- in der deutschen Sprache der Gegenwart (=LA 23) Tübingen: Niemeyer
13 s.o. Kap.3.2.2.
14 Es wurde hier die Paraphrase etwas mit Geleit versehen angenommen.
15 s. Burghart Voigt (1992): Präfigierung und Abwandlung (Modifikation).DaF 29.S.100-104 2 ) 3 ) Präfixe bringen deutlichere semantische Merkmale in die verbale Wortbilödung ein. Verbale Wortbildung aus komplexen Basen ist nur mittels Präfixkonversion möglich.
16 s.o. Kap. 3.2.1.
17 Ich habe nur solche präfigierten Verben als denominal klassifiziert, zu denen kein Simplexverb existiert. So wurde z.B. abschwächen als deverbale Wortbildung eingestuft, weil es ein Verb schwächen gibt, obwohl dieses natürlich deadjektivisch ist.
18 s.Susan Olsen (1990): Konversion als ein kombinatorischer Wortbildungsprozeß. In: Linguistische Berichte 127. S.185-216
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über präfigierte Verben?
Diese Arbeit untersucht präfigierte Verben in einer österreichischen Tageszeitung, dem Standard. Ziel ist es, den prozentualen Anteil der einzelnen Präfixe zu ermitteln, diese mit vorhandenen Daten zu vergleichen und die Verben hinsichtlich ihrer Semantik zu klassifizieren. Die Arbeit versucht ein Klassifikationssystem zu konstruieren, das alle Verbpräfixe inklusive Partikel erfasst.
Welchen Zeitraum und welche Themen umfasste das Korpus?
Das Korpus umfasst Artikel der Tageszeitung Standard aus dem Zeitraum 1. bis 31. März 2001 zum Thema Dienstrechtsreform an den Universitäten. Es wurden Berichte und Kommentare berücksichtigt, jedoch keine Leserbriefe.
Was versteht man unter präfigierten Verben in dieser Arbeit?
Unter präfigierten Verben werden verbale Wortbildungen mit Präfixen verstanden, einschließlich echter Präfixverben (untrennbar) und Partikelverben (trennbar). Doppelförmige Präfixe (durch-,über-, um-, unter- und wieder-) werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Kriterien mussten Wortbildungsmorpheme erfüllen, um in den Korpus aufgenommen zu werden?
Die Wortbildungsmorpheme mussten folgende Bedingungen erfüllen: Reihenbildend sein (mit vielen Basen verbunden werden können), im Satz keine selbstständige Funktion erfüllen (keine Satzgliedfunktion) und eine Funktion in der Wortbildung haben (Träger einer Wortbildungsbedeutung sein).
Wie wurden Types und Tokens gemessen?
Types beziehen sich auf die Anzahl verschiedener präfigierter Verben, während Tokens die Häufigkeit des Vorkommens jedes einzelnen Verbs im Korpus angeben. Die Types-Frequenz der einzelnen Verben lieferte die Ergebnisse der Studie.
Welche Ergebnisse gab es bezüglich der Häufigkeit trennbarer und untrennbarer Präfixe?
Das Verhältnis zwischen trennbaren und untrennbaren Verbpräfixen ist relativ ausgewogen (140:124). In Zeitungen findet eine Verschiebung der Häufigkeitsverteilung zugunsten der Präfixe be- und er- statt, während ver- und ent- relativ weniger verwendet werden.
Welche theoretischen Grundlagen wurden für die semantische Klassifikation verwendet?
Die semantische Modifikation durch Verbpräfixe wurde in verschiedene Kategorien unterteilt, darunter aktionale Abstufung (ingressiv, egressiv, resultativ, punktuell, Partialmarkierung), räumliche Einordnung (dimensional, relational, dynamisch), temporale Einordnung, modale Funktionen (reversativ, Negation, "falsch", "anders"), Intensivierung, ornative Funktion und Objektbezogenheit.
Welche Schwierigkeiten gab es bei der semantischen Klassifikation?
Die Einordnung nach semantischen Merkmalen ist immer subjektiv. Metaphorische und abstrakte Verwendungen mussten berücksichtigt werden. Bei manchen Verben gestaltete sich die Einordnung äußerst schwierig und erforderte lange Überlegung. Einige Verben blieben nicht klassifizierbar aufgrund starker Idiomatisierung.
Welche Bedeutung hat das Präfix "be-" in den untersuchten Verben?
Das Präfix be- ist das häufigste im Korpus. Seine semantische Klassifikation ist schwieriger. Es wird die Funktion "ornativ" und "Objektbezogenheit" unterschieden, wobei Objektbezogenheit sich auf die Einwirkung auf etwas bezieht. Viele be-Verben sind aber nicht klassifizierbar, was darauf hindeutet, dass syntaktische Modifikation und denominale Wortbildung wichtigere Funktionen darstellen.
Was ist die Zusammenfassung der Ergebnisse?
Trennbare Präfixe haben vorwiegend lokale Bedeutungskomponenten, während untrennbare Präfixe zu einem großen Prozentsatz demotiviert sind. Verbpräfigierung ist eine der produktivsten Formen der deutschen Wortbildung und erfüllt sowohl die Anforderungen der Ausdifferenzierung semantischer Inhalte als auch der Ökonomie des Ausdrucks.
- Quote paper
- Christine Lindengrün (Author), 2001, Zur Wortbildung in österreichischen Tageszeitungen: präfigierte Verben, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105618