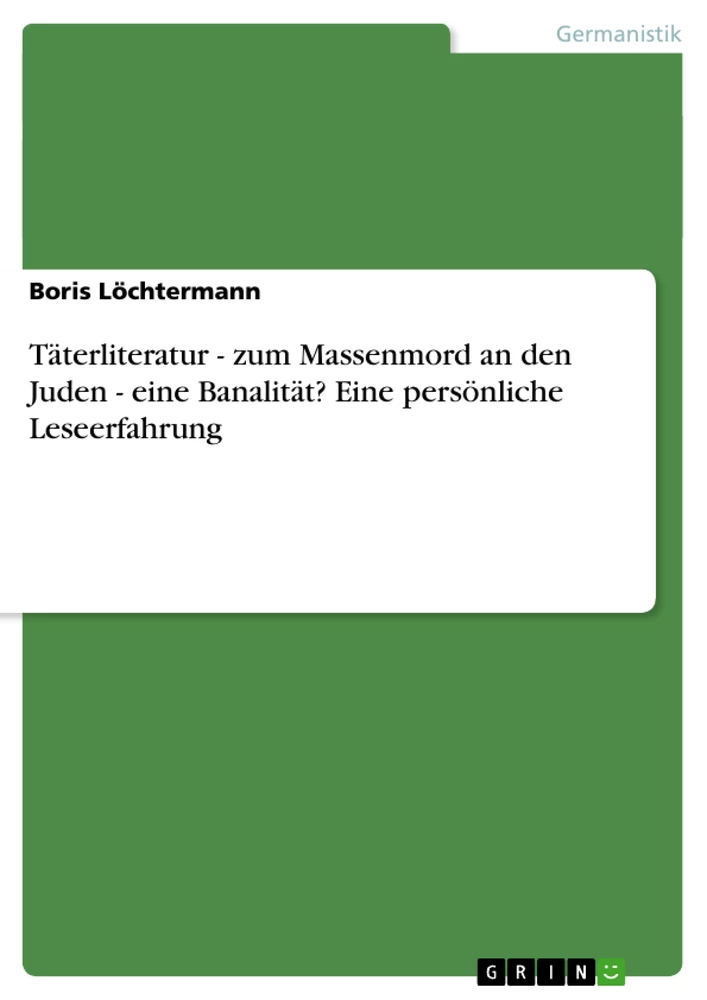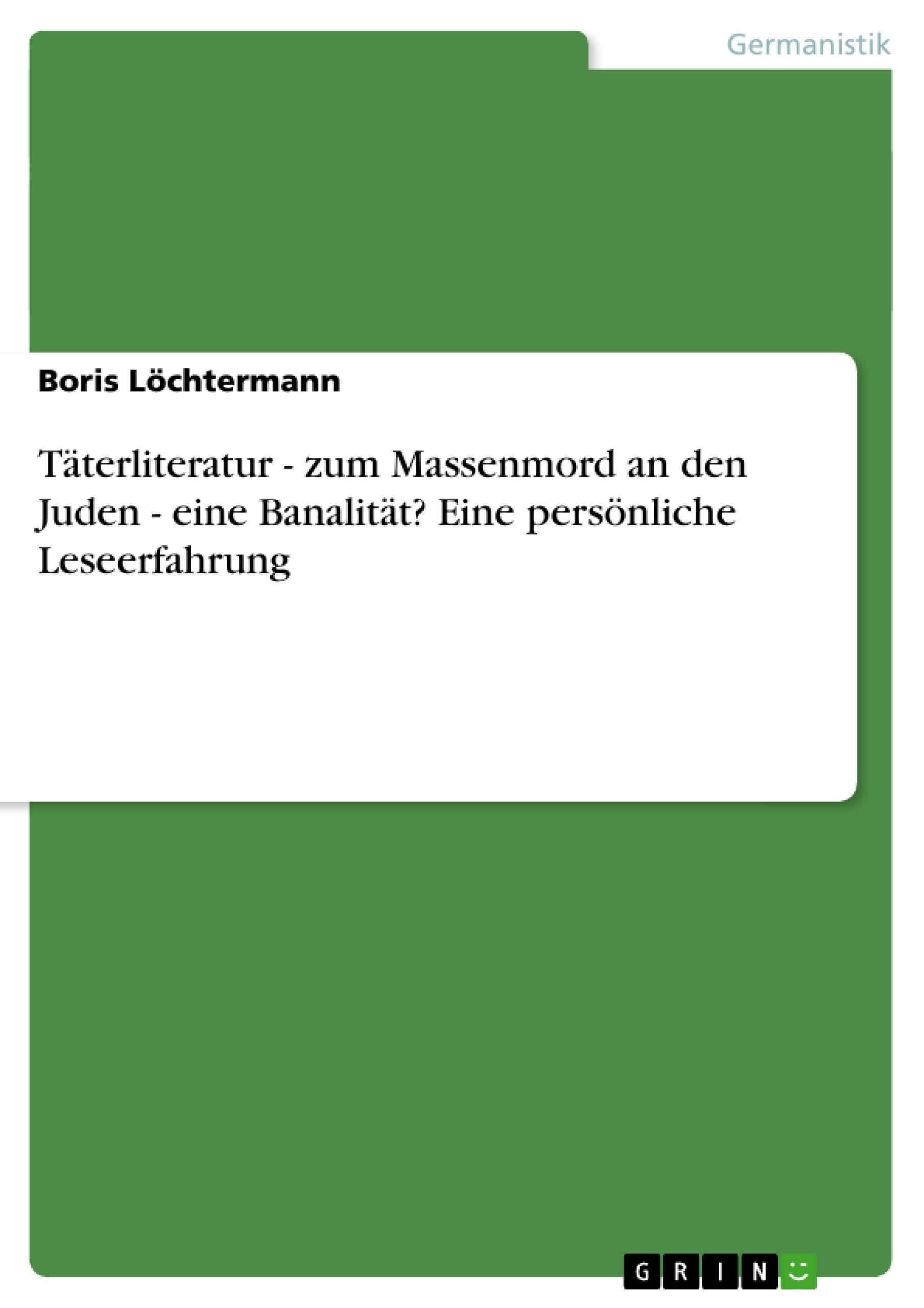Täterliteratur - zum Massenmord an den Juden - eine Banalität ? Eine persönliche Leseerfahrung.
I. Es existiert eine offener Widerspruch, auch heute noch, zwischen dem Wissen um die „Banalität des Bösen“ und der Verdrängung dieser Tatsache
II. Es existiert eine pietätische Legitimation für die Frage, ob man den Tätern „von damals“ heute noch einmal das Wort erteilen darf. Und wenn ja, in welcher Form?
III. Sind Tätertexte nicht lediglich äußerst vorsichtig zu handhabende, historische Quellen? Quellen, die zugenüge von „Experten“ ausgewer- tet wurden und deren Quintessenz der „Laie“ besser in Geschichtsbü- chern nachlesen kann? Oder können wir (auch heute) noch mehr von diesen „Tätertexten“ erwarten?
Wer sich mit der sogenannten Täterliteratur zum Massenmord an den Juden beschäftigt, diese kommentiert, ediert oder zensiert, sieht sich einer Tradition ausgesetzt; der Tradi- tion, sich dafür zu rechtfertigen. Ob dies ein „muss“ ist, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht so sehr hinterfragen, vielmehr möchte ich es als eine tief in uns internalisierte Merkwürdigkeit begreifen, dass wir uns, als „Beschäftiger mit der Täterliteratur“, von diesen Tätern und ihren Verbrechen, soweit es nur irgendmöglich ist, abzugrenzen. Auch wenn wir über jeden Zweifel erhaben sind, lauert in uns die Angst vor einem ungeheuren Missverständnis. Vielleicht war es die jüdische Philosophin Hannah A- rendt, deren Beispiel uns das Fürchten lehrte. Hannah Arendt war über jeden Zweifel erhaben, mit dem deutschen Nationalsozialismus zu sympathisieren. Als sie jedoch Anfang der 60er Jahre, im Zuge des israelischen Eichmannprozesses, im „New Yorker“ begann, das Klischee vom Monster, von der Bestie des Nazi-Täters zu zerstören, indem sie schrieb, sie könne Eichmann „ beim besten Willen nichts dämonisches abgewinnen “ und „ auch ideologischer Fanatismus gehe ihm ab “ ; sie weiterhin schrieb, er sei „ er- schreckend normal “ , „ beflissen “ , „ phantasielos “ , „ ehrgeizig “ , bloß „ ein Bürokrat “, erntete sie insbesondere von israelischer und deutscher Seite über viele Jahre hinaus Empörung, auch als Eichmann (1962) schon längst hingerichtet worden war. Sie hatte oder habe sich des Versuchs schuldig gemacht, Eichmann zu verharmlosen. Hannah Arendt aber hielt unbeirrt an ihrem Eindruck fest. Über die Lektüre der Vernehmungs- protokolle sagte sie: „ Ich sage Ihnen, ich habe dies Polizeiverhör, dreitausendsechs- hundert Seiten, gelesen, und sehr genau gelesen, und ich weißnicht wie oft ich gelacht habe - aber laut! “ Eichmann entpuppte sich für sie als ein „ Hans Wurst “. „ Das Bö- se “, schrieb sie damals, „ ist banal! “.
Diese bekannt gewordene „ Banalität des Bösen “ gerät immer wieder in Vergessen- heit, ja fast möchte ich behaupten, sie wird bewusst als etwas, was nicht sein darf, verdrängt. Natürlich war und ist der deutsche Nationalsozialismus mit seinen Folgen, insbesondere mit seinem Massenmord an den Juden und an allen nicht ins Regimebild passenden Personen nicht banal. Banal heißt übrigens „ in enttäuschender Weise nichts Besonderes darstellend oder bietend “(Duden). Daher, so scheint sich bewusst oder unbewusst, in mir (als einem Menschen des Jahrgangs 1974) der Gedanke verankert zu haben, daher können auch die Menschen jener Zeit nicht banal gewesen sein. Und doch, wenn man Rudolf Höß´ autobiographischen Aufzeichnungen liest (Höß war Kommandant in Auschwitz) oder wenn man das Interviewgestammele Oswald Ka- duks versucht zu verstehen (Kaduk galt als einer der grausamsten, brutalsten und ordinärsten SS-Aufseher in Auschwitz), dann bleibt auch für mich ein Hauch enttäu- schender Banalität zurück. Das waren die unmenschlichen Monster?
Ich bin versucht mir meine Großväter in dieser Rolle vorzustellen. Klängen sie an- ders? Hätten sie unter dem immer wieder beschriebenen Druck anders reagiert? Und weil meine Großväter keine schlechten Menschen sind, zumindest nicht schlechter als andere Menschen auch, halt so ein bisschen banal, versuche ich doch gleich auch mich in diese Rolle des KZ-Aufsehers hineinzudenken. Wie hätte ich mich verhalten? Hätte ich ein aktiver Täter sein können? Hätte ich mich dem Mittun entziehen kön- nen? Oder wäre ich bloß ein stummer Mitwisser, Mitläufer gewesen? Oder gar ein aktiver Regimegegner? In etwa dürften dies die immer wiederkehrenden Fragen in den Köpfen jener Menschen sein, die sich mit dem Nationalsozialismus auseinander- setzen, die jedoch durch die Gnade ihrer späten Geburt, den Nationalsozialismus als nichts Reales fassen können.
So will auch ich mich in die Tradition des sich-Erklärens einreihen: Mit der vagen Vermutung, dass auch in mir ein Täterpotential steckt, dessen Bereitschaft nur ent- sprechend geweckt und gefördert zu werden bräuchte; mit der Befürchtung, dass ich meine Wünsche, Hoffnungen und Idyllen in banaler und zugleich erschreckender Form in den Naziverbrecherhirnen wiederfinde, mit der Intention es zuzulassen, dass ich einer von Ihnen hätte sein können, habe ich die Täterliteratur gelesen und stehe nun vor Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, ob sich diese Befürchtung bestätigt hat, ob die- ses Experiment funktioniert hat.
Wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, dann habe auch ich Angst, dass Sie mich missver- stehen, ich würde mit den Tätern dieser unvorstellbaren Greultaten sympathisieren können. Ich kann Ihnen versichern, dem ist nicht so. Liest man jedoch in meiner In- tention diese Texte, so bedeutet dies, sich erst einmal auf diese Menschen einzulassen, nicht nach Differenzen, nach Abgrenzungsmöglichkeiten zu suchen, sondern nach Gemeinsamkeiten oder doch zumindest Ähnlichkeiten Ausschau zu halten.
Bevor ich weitere Lese-Eindrücke oder -Urteile kundgebe, möchte ich zum besseren Verständnis kurz zumindest zwei Bücher, zwei Varianten von Täterliteratur vorstellen, die sich in einigen, bemerkenswerten Punkten gravierend unterscheiden, inhaltlich wie formal, in anderen Punkten jedoch erstaunliche und altbekannte Parallelen aufweisen.
In chronologischer Reihenfolge:
„Kommandant in Auschwitz“
Dabei handelt es sich um die autobiographischen Aufzeichnungen Rudolf Höß´. Höß, Jahrgang 1900, war von 1934 bis 1938 Block- und Rapportführer im Konzentrationsla- ger Dachau, von 1939-1940 Adjutant und Schutzhaftlagerführer im Konzentrationsla- ger Sachsenhausen und von 1940-1943 Kommandant vom Konzentrationslager Ausch- witz, welches er quasi von den Anfängen an aufbaute. Von 1943 bis 1945 war er schließlich Amtschef bei der Inspektion der Konzentrationslager, wo er sich einen Ge- samtüberblick zur Konzentrationslagersituation verschaffen konnte. Am 11. März 1946 wurde Höß von der britischen Militärpolizei in der Nähe von Flensburg aufgestöbert und verhaftet. Er wurde von der britischen Field Security Section verhört, nach Nürn- berg ans International Military Tribunal überstellt, wo er als Zeuge in mehreren Prozes- sen aussagte (Kaltenbrunner, „Pohlprozess“, „I.G.-Farben-Prozess“). Am 25. Mai 1946 wurde Höß an Polen ausgeliefert. Bis zum Prozess in Warschau, wo Höß vor dem O- bersten Volksgerichtshof wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde, vergingen zehn Monate. Am 2. April 1947 wurde Höß zum Tode verurteilt. Die Zeit zwischen der Aus- lieferung an Polen und seiner Verurteilung brachte Höß größtenteils im Untersuchungs- gefängnis in Krakau zu, wo vom September 1946 bis Januar 1947 eine eingehende Voruntersuchung gegen ihn stattfand, inklusive psychiatrischer Gutachten. Ich zitiere aus der Bucheinleitung „ Der Auschwitzer Kommandant erwies sich [...] als ein höchst mitteilsamer Untersuchungsgefangener, der in unerwarteter Gewissenhaftigkeit und unterstützt durch ein gutes Gedächtnis, die an ihn gestellten Fragen meist sehr genau und zutreffend beantwortete. H öß entwickelte [...] eine Art nachträgliches Sachinteresse an dem Verhandlungsgegenstand und war durch spontane Mitteilungen, Berichtigungen von Irrtümern, die ihm eingefallen waren, bemüht, den Vernehmenden in fast befremd- licher Weise behilflich zu sein. “ Natürlich hatte Höß nach der polnischen Prozessord- nung die Möglichkeit jede Kooperation und Aussage zu verweigern. Davon machte er jedoch nie Gebrauch. Im Gegenteil: Gewissenhaft bereitete er seine Vernehmungen nicht nur vor, sondern auch nach. In diesem Zuge entstanden die hier zur Debatte ste- henden Aufzeichnungen. Sie wurden erstmals 1958 von Professor Dr. Martin Broszat, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, nach den ihm wichtig erscheinen- den Gesichtspunkten ediert.
Das zweite von mir angesprochene Buch wurde 1979 von Ebbo Demant herausgegeben. Es trägt den Titel „ Auschwitz - << Direkt von der Rampe weg...>> Kaduk, Erber, Klehr: Drei Täter geben zu Protokoll. “ Demant ist Fernsehjournalist, Jahrgang 1943 und überwiegend für den Südwestfunk tätig. Während der von ihm produzierten Film- dokumentation „Lagerstraße Auschwitz“ interviewte er 1978 drei Aufseher des Kon- zentrationslagers Auschwitz, vierzehn Jahre nachdem sie in dem Frankfurter Ausch- witz-Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt wurden und diese in der Justizvollzugs- anstalt Schwalmstadt in Hessen verbüßten. Es handelte sich um Oswald Kaduk, sei- nerzeit SS-Unterscharführer, um Josef Erber, der SS-Oberscharführer war und um Josef Klehr der einen Sanitätsdienstgrad innehatte. In seiner Vorbemerkung be- schreibt Demant, dass er sich unsicher war, wie er diesen Männern begegnen sollte oder konnte, letztendlich beschränkte er sich jedoch auf eine Taktik: „ Die Gespräche sind bewusst nicht kontrovers geführt worden, denn nur so glaubte ich, eine unver- fälschte Selbstdarstellung der Täter zu erhalten. “
Betrachten wir nun diese zwei Varianten der Täterliteratur eingehender ist folgendes festzuhalten: Höß war Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Er hatte Leitungsfunktion und einen mehr oder weniger umfassenden Überblick zur Rolle der Konzentrationslager im soziopolitischen Gesamtkontext des Dritten Reichs. Er hatte im hohen Maße Verantwortung zu tragen. Die Aufseher Kaduk und Erber waren im Verhältnis dazu kleine Fische. Auch Klehr fällt eher in ihre Kategorie, als in die Höß´. Sie waren ausführende SS-Handlanger, die ihre Hände - ob sie es wollten oder nicht - in Blut badeten. Höß hingegen, hat in seiner Karriere zwar alle Stufen durchlaufen, fungierte jedoch in den letzten und, wie wir wissen, schrecklichsten Jahren des natio- nalsozialistischen Massenmordes an den Juden als Schreibtischtäter. Diese gehobene Position Höß´ wird (unwillentlich, die Bücher haben ja nichts miteinander zu tun) in dramatischer Weise dadurch verstärkt, dass von Höß autobiographische Aufzeichnun- gen vorliegen, also wohlausgefeilte Schriftsprache, während hingegen die Handlanger in gesprochener Sprache, mit all ihren Fehlern, Wiederholungen, Abbrüchen, Dialek- ten und Undeutlichkeiten festgehalten wurden. Sie erscheinen allein schon durch ihre Sprache primitiver, naiver und brutaler, obwohl sie inhaltlich und argumentativ in Bezug auf die Greultaten, die in den Konzentrationslagern durch ihre Hand und durch ihr Auge mitangesehen stattfanden, kaum abweichen.
Höß arbeitete mit großem Engagement und mit absoluter Freiwilligkeit an seinen Aufzeichnungen. Sie waren das Resultat zweier innerer Bedürfnisse. Höß brauchte im hohen Maße Struktur. Arbeit war ihm eine Möglichkeit geworden (Höß hatte auch schon vor 1933 im Zuchthaus gesessen) den stupiden Gefängnisalltag auszufüllen. In der Fertigstellung dieser Aufzeichnungen fand er eine sinnvolle Aufgabe, die ihm Halt gab. Höß bemerkte wiederholt: „ Gerade in der jetzigen Haft vermisse ich so sehr die Arbeit. Dankbar bin ich für die aufgegebenen Schreibarbeiten, die mich voll und ganz ausfüllen. - Ich habe mit vielen Mitgefangenen im Zuchthaus und ich habe dann im KL mit vielen Häftlingen besonders in Dachauüber die Arbeit gesprochen. Alle waren davonüberzeugt, dass das Leben hinter Gittern, hinterm Draht, auf die Dauer ohne Arbeit unerträglich, ja die schlimmste Bestrafung sei. “ Quasi als kleine, un- glaubliche Zugabe bleibt mir nur anzumerken, dass es Höß war, der, in den uns allen vor Augen schwebenden eisernen Lettern, die Worte „ Arbeit macht frei “ am Tor zum Stammlager Auschwitz anbringen ließ. Worte, die als Zeugnis fataler Ironie, als Do- kument des Zynismus der Betreiber von Auschwitz gehandelt werden. Höß hingegen ist zu unterstellen, dass er sich in seiner Wahrnehmung oder in seiner Erinnerung derart beschränkte, dass ihm das Organ für das Zynische dieses „ Sinnspruches “ abging. Diese beschränkte Wahrnehmung (wir sprachen im Laufe unserer Veranstaltung auch wiederholt von einem gespaltenen Bewusstsein) lässt Höß sich selbst neben den von ihm bewusst ausgeführten Grausamkeiten auch als einen rechtschaffenden, ehrlichen und guten Menschen erscheinen. So sieht Höß sich als Opfer einer unangenehmen aber nötigen, extremen Ausnahmesituation. Er muss ein Teil seines Lebens in einer von ihm verabscheuten Art im Dienste der SS verleben, während sein wahres Ich einer ganz anderen Bestimmung, einer idyllischen, folgen möchte. Es ist Höß´ zweites Bedürfnis in diesem Zwiespalt, für den er viele Leidensbeispiele anführt, verstanden zu werden. „ Mag die Ö ffentlichkeit ruhig weiter in mir die blutdürstige Bestie, den grausamen Sadisten, den Millionenmörder sehen - denn anders kann sich die breite Masse den Kommandanten von Auschwitz gar nicht vorstellen. Sie würde doch nie verstehen, dass der auch ein Herz hatte, dass er nicht schlecht war. “
Warum Kaduk, Erber und Klehr sich zu dem Interview bereiterklärt haben, bleibt offen. Vielleicht wollten auch sie nur ihren grauen Haftalltag mit etwas Neuem beleben. Da- von, dass sie sich eine Last von der Seele redeten, ist nichts zu spüren. Vielmehr äußern sie ihre Verärgerung darüber, dass einige von denen, die ihnen damals die Verantwor- tung für die Taten abzunehmen gedachten, mit geringeren Strafen belegt worden waren. Sie fühlen sich von der Justiz verschaukelt (Schreibtischtäter). Übereinstimmend mit Höß, aber niemals mit seiner bewussten Intention und Konsequenz, sind auch sie be- müht ein menschlicheres, liebenswürdigeres Bild von sich zu zeichnen, als die Öffentlichkeit vermeintlich von ihnen hat. Werden die ehemaligen SS-Schergen von Demant zu unangenehmen Details befragt, so beispielsweise zur Selektion and der Rampe, zu den tödlichen Phenolinjektionen direkt in den Herzmuskel oder zum Vorgang der Tötung der Juden durchs Gas Zyklon B, verstehen sie die Fragen nicht, weichen aus oder fassen sich kurz. Konfrontiert Demant sie dann weiterhin mit diesem Detail, empfinden sie sich durch die Fragen furchtbar gequält.
Beide Herausgeber, Demant wie Broszat, haben auf die kleinen und großen Unaufrich- tigkeiten, Verschönerungen, Erinnerungslücken oder auf die zum Teil „nur“ verschobe- nen Ansichten unterschiedlich reagiert. Broszat hat Höß´ Aufzeichnungen unter wissen- schaftlichen Bedingungen kommentiert. Jede Aussage wird be- oder widerlegt, jeder genannte Name erläutert. Das führt stellenweise zu einem Fußnotenwust, der dem Leser ein gewisses Maß an Konzentration abfordert. Diese Kommentierung ist aber meines Erachtens unumgänglich, um Höß´ komplexen Aussagen, auch als Nicht-Experte, ver- stehen und vor allen Dingen in ihrem Gehalt bewerten zu können. Demant hat einen anderen Weg gewählt. Er lässt die Interviewten frei reden - nur gelegentlich hakt er mit Fragen kritisch nach. Ansonsten hat er es dabei belassen, Textbausteine an markanten Stellen des Interviews einzuschieben. Diese Textbausteine stellen „ Quasi- Augenzeugenberichte “ dar, vermutlich von überlebenden Opfern. An einigen Stellen widerlegen diese Textbausteine die soeben gemachte Aussage des ehemaligen SS- Schergen. An anderer Stelle erinnern sie lediglich in ihrer schmerzlichen Art daran, dass hier ein Mann spricht, der sehr sehr grausame Dinge getan hat, und man bei sei- nen Aussagen auf der Hut sein sollte.
An dieser Stelle möchte ich einen Schnitt machen und zurückkehren zu den ersten Sätzen dieses Referates. Was hat die Herausgeber bewogen, diesen Tätern des Natio- nalsozialismus noch einmal das Wort zu erteilen? Wie rechtfertigen sie sich? Beide, wie hätte es anders sein können?, möchten informieren. Ihre schockierende Veröffent- lichung soll (um in den Worten Broszats zu sprechen) „ indem sie mit der abgründigs- ten Unmenschlichkeit konfrontiert, zu jener Katharsis beitragen, welche nach der Epoche des Dritten Reiches ein Gebot nationaler Selbstachtung ist. “ Mit anderen Worten: Nie wieder darf Auschwitz sein! Nie darf Auschwitz vergessen werden! Nie darf Auschwitz geleugnet werden! Sie bemerken, dass ich Auschwitz als Platzhalter verwandt habe. Und doch genau das Leugnen von Auschwitz war das Faktum, das Demant bewogen hat seine Täterinterviews zu veröffentlichen. In den siebziger Jahren sah er sich mit einer Bewegung Auschwitzlüge konfrontiert. Demant hoffte, mit einer erneuten Veröffentlichung von Tätergeständnissen könnte er dieser Bewegung das Wasser abgraben. Er bemerkt hierzu: „ Zwei arme Teufel sprechen, die einst mörderi- sche Teufel waren. Das macht sie zu glaubhaften Zeugen. Ungern füge ich hinzu: Es macht sie glaubhafter alsüberlebende Opfer, hinter deren Aussagen die ahnungslose Nachwelt allzu rasch Rachebedürfnis vermutet. Den Zeugen Kaduk und Klehr muss die Nachwelt glauben. “ Ich sitze hier in einem Seminar mit Menschen, die sicherlich auch den überlebenden Opfern glauben schenken, zumal ja auch deren Aussagen überprüft werden. Demants Adressaten waren jedoch andere. Zu diesem Zweck, so mein Leseeindruck, führt Demant die Zeugen, Klehr, Erber und Kaduk regelrecht vor. Der Informationsgehalt ihrer Aussagen ist dürftig, selbst für jemanden wie mich, der vermutlich nur die groben Vorgänge in einem Konzentrationslager kannte und kennt. In Bezug auf die Tötungen aber, sei es durch die Phenolinjektionen oder durch das Gas Zyklon B, bleibt Demant unerbittlich und verlangt Details. Ich weiß nicht, ob diese Aussagen die Chance darstellen, die im Geiste Ewig-Gestrigen zu überzeugen.
Broszats Aufklärungsintention ist weitreichender. 1958, dreizehn Jahre nach der Be- freiung, war Auschwitz, war der Massenmord an den Juden lange Zeit kein Thema der Öffentlichkeit gewesen. Deutschland hatte anderes im Kopf. Wider-das-Vergessen anzuarbeiten bleibt jedoch auch bei Broszat „nur“ ein gleichberechtigtes Projekt, neben dem Versuch durch Höß aufzuzeigen, „ welche Art von Menschen es waren, die die Maschinerie des Todes bedienten, aus welcher Seelen- und Geistesverfassung heraus sie dazu in der Lage waren, welche Antriebe, Gefühls- und Denkkategorien hierbei zur Geltung kamen. [...] Am Falle H öß“ , schreibt Broszat , „ wird in aller Ein- dringlichkeit klar, dass Massenmord nicht mit persönlicher Grausamkeit, mit teufli- schem Sadismus, brutaler Rohheit und sogenannter >>Vertiertheit<< gepaart zu sein braucht... “ Unbestreitbar seien die Konzentrationslager mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auch ein Sammelpunkt „ verkommener, verrohter und gefühlsloser Figuren “ gewesen; das Ideal jedoch, so Broszat, „ war der Lagerkommandant vom Schlag eines H öß , der sich rücksichtslos durchsetzte, vor keinem Befehl zurückschreckte, aber dabei >>persönlich<< anständig blieb. [...] H öß ist, mit einem aber dabei >>persönlich<< anständig blieb. [...] H öß ist, mit einem Wort, das exem- plarische Beispiel dafür, dass private >>Gemüts-<< Qualitäten nicht vor Inhumanität bewahren, sondern pervertiert in den Dienst des politischen Verbrechens gestellt wer- den können. “ Letztlich hofft Broszat, dass Höß` Aufzeichnungen betroffen machen, gerade weil sie „ die eines durchaus kleinbürgerlich-normalen Menschen sind “. Ihnen zufolge, argumentiert Broszat, sei es nicht länger mehr erlaubt „ eine kategorische Un- terscheidung zu treffen zwischen denen, die nur aus Idealismus und Pflichtgefühl bei der Sache waren, und denen, die - vermeintlich - von Natur aus grausam, das gute Wollen der anderen durch ihr teuflisches Handwerk verdarben. “
1958, als Broszat dies schrieb, mag dies eine neue Einsicht gewesen sein. Denken wir an Hannah Arendt. Doch heute, ohne überheblich sein zu wollen, sind wir uns dieses Umstandes doch längst bewusst. Was also bietet die Täterliteratur uns heute an neuen Informationen? Sicherlich jedem andere. Und weil ich hier vorne stehe und rede und das Referat ja auch eine persönliche Leseerfahrung nenne- muss ich besser fragen, was war für mich neu? Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt so persönlich vorgehe, doch diene ich Ihnen jetzt als Beispiel. Neu waren für mich vor allen Dingen die bloßen, die nüch- ternen aber darin erschreckenden, logistischen Zahlen: Dass sechshundert Menschen in eine Baracke gepfercht wurden, die nicht gerade luxuriös für zweihundert, maximal dreihundert Menschen konzipiert war. Dass zeitweise über tausend Menschen mit ei- nem Schlag in ein Vernichtungsgebäude getrieben wurden, so dass sie dicht an dicht standen, nicht einmal umfallen konnten. Dass zeitweise das Konzentrationslager Birke- nau hundertfünfzigtausend Menschen gleichzeitig - mir fehlen die Worte - gefangen hielt. Darüber hinaus habe ich die Aufgabe, den Aufbau und das Kompetenzgerangel der SS im Dritten Reich etwas besser verstehen können und wahrscheinlich hatte ich vergessen wie früh schon die ersten Konzentrationslager, bzw. hießen sie zuerst Ar- beitslager, errichtet wurden. Die meisten dieser Informationen habe ich den Einleitun- gen entnommen, erstaunlicherweise insbesondere der von Demant. Neu für mich war auch der Umstand, dass die SS-Führung einem zwar einleuchtenden, von mir aber nicht bewusst wahrgenommenen Problem gegenüberstand: Die Blutsarbeit zermürbte viele SS-Leute psychisch derart, dass sie darüber verrückt wurden. Gerade im Osten hatten die Konzentrationslager große Probleme, weibliche Wärterinnen zu rekrutieren. Perfi- der und perverser Weise machte Himmler gerade daran den Elitestatus der SS fest, um seine Getreuen weiterhin zu motivieren - mit dem Status des Besonderen, des Außer- gewöhnlichen. So erklärte er 1943 vor dem obersten Führerkorps der SS im Hinblick auf die Judenvernichtung: „ Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn 1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei - abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwä- chen - anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Die ist ein niemals ge- schriebenes und zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. “ Aber auch diese Information habe ich aus der Einleitung und den wissenschaftlichen Zusätzen Broszats.
Das, was ich als alte Information bezeichnen will, ist sicherlich auch hier jedem be- kannt. Es ist der Alkoholkonsum, die Rechtfertigung: „Ich habe nur auf Befehl gehan- delt.“, die Frage, „Was hätte ich den machen sollen? Ich hatte doch auch Angst um mein Leben.“, die Erklärung „Um die Lagerdisziplin aufrechtzuerhalten, musste manchmal hart durchgegriffen werden - Sympathie konnte ich mir nicht erlauben, Gefangene und Kollegen hätten mich im Streitfall verpetzen können.“ Dazu mischen sich die kleinen, grausamen Details, die Quälereien, die Krankheiten und die eindring- lichen Geschichten von den Morgenappellen, den Selektionen, den Exekutionen, ect.. Von diesen Geschichten haben wir alle sicherlich die eine oder andere schon einmal gehört. In diesen Texten erscheinen sie zuhauf. Sie werden austauschbar.
Zwangsläufig stellt sich mir die Frage, werden hier nicht Informationen verbreitet, die zu vermitteln auch jeder gute Geschichtsunterricht in der Schule fähig wäre? Könnte mich ein objektiveres und neutraleres Geschichtsbuch nicht besser informieren? Von mir aus könnte es ja Zitate verwenden, um besondere psychologische Begebenheiten zu unterstreichen. Muss aber bei dieser Informationsflaute den Tätern erneut die Mög- lichkeit gegeben werden, das Wort zu ergreifen? Müssen, dürfen wir ihre Rechtferti- gungen, Beschönigungen, ihre grausamen Details noch einmal hören?
Am Anfang meines Referates habe ich erklärt, dass ich versucht habe die Täterlitera- tur mit der Intention zu lesen, nicht bloß die Täter und ihre Taten zu verstehen, son- dern auch in mir einen potentiellen Täter zu finden. Bei aller Mühe, und ich habe mir Mühe gegeben, kommt man bei der Lektüre irgendwann an einen Punkt, und ich glaube so geht es den meisten der hier Anwesenden, - da kann man nicht mehr ver- stehen. Da sträubt sich in einem alles, und man denkt NEIN, das hätte ich nicht getan. So normal Höß und seine Getreuen auch gewesen sein mögen - ich bin anders. Ich bin mit meinem Experiment gescheitert. Broszat und Demant mit ihrer Intention auch?
Als ich begann die Täterliteratur zu lesen, legte ich mir bestimmte Verhaltensregeln auf. Ich lese sie nicht während des Essens. Ich lese sie nicht in der Bahn. Ich lese sie nicht im Bett. Ich lese sie nicht auf der Toilette. Ich lese sie nur, wenn ich mehr als eine halbe Stunde dafür zur Verfügung habe etc Sie bemerken, ich wollte mit einer gewissen Würde und Ehrfurcht diesen Texten und ihrem Inhalt begegnen, sie nicht einfach konsumieren. Mit mindestens drei dieser Verhaltensregeln habe ich gebro- chen, weil diese Texte eine unglaubliche Anziehungskraft besitzen. Habe ich mit Anderen über diese Texte oder über mein Referat gesprochen - ohne dass sie mein Referat an sich kannten - so nannten sie die Thematik: spannend. Bei dem Wort „spannend“ durchzuckte es mich jedes Mal. Es schien mir nicht der richtige, der Situ- ation angemessene Terminus zu sein. Und tatsächlich lässt sich über die Definition dieses Terminus streiten, viele Wörterbücher definieren den Begriff relativ neutral, im großen Duden jedoch findet man: „ spannend (Adj.) [ wohl ausgehend vom Bild einer gespannten Stahlfeder od. der gespannten Muskeln; schon mhd. spannen = freudig erregt sein; voller Verlangen sein]: Spannung (1a) erregend; fesselnd: ein -er Roman, Kriminalfilm; eine -e Wahlnacht, Gerichtsverhandlung, Diskussion;... “ . Während ich bei Roman, Kriminalfilm, Diskussion und Wahlnacht gut und gerne von spannend spreche, meinetwegen auch noch bei einer Gerichtsverhandlung, kann ich eine freudige Erregung mit Auschwitz nicht in Verbindung bringen. Und letztendlich ist es mir auch egal, ob wir es nun spannend, faszinierend oder sonst wie nennen... gerade in Höß´ Text liegt etwas von einer ungeheuren Abstoßungs- und Anziehungskraft, dass ich diese nur noch schwer hinter einem rein wissenschaftlichen oder informativen Interesse ver- stecken kann, - denn in wissenswerter Hinsicht bietet der Text nicht genug Neuigkeiten. Und verzweifelt frage ich mich: wurde ich zum voyeuristischen Gaffer?
Ich bin am Ende meines Referats angekommen. Welche Berechtigung oder Erklärung es für Täterliteratur auch geben mag, ich weiß nicht, ob sie uns dem Verstehen etwas näher bringt. Begreifen oder gar mitleiden kann meine Generation diese Zeit und ihre Geschehnisse und ihre Untaten wohl nicht. Die Texte behalten dennoch ihre Berechti- gung. Alleine aus dem Umstand schon , dass man niemanden auf Dauer das Wort ver- bieten darf. Es gibt einen berühmtes Buch namens „Der gelbe Stern“, eine Sammlung von Bilddokumenten aus den Jahren 1933 bis 1945. Unter anderem findet man darin ein Bild aus Berlin vom 10. Mai 1933. Es ist die bekanntgewordene Bücherverbrennung. Die Herausgeber kommentieren das Bild mit einem Vers Heinrich Heines: „ Das war ein Vorspiel nur, / dort, wo man Bücher / verbrennt, verbrennt man / am Ende Men- schen. “
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Täterliteratur - zum Massenmord an den Juden - eine Banalität ? Eine persönliche Leseerfahrung." und worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine persönliche Auseinandersetzung mit der sogenannten "Täterliteratur" zum Massenmord an den Juden. Er untersucht die Frage, ob die Täter banal waren, wie Hannah Arendt argumentierte, und ob es heute noch legitim ist, Tätern eine Stimme zu geben. Der Autor hinterfragt auch, ob Tätertexte lediglich historische Quellen sind oder ob sie uns noch neue Erkenntnisse liefern können.
Wer war Rudolf Höß und was sind seine autobiographischen Aufzeichnungen?
Rudolf Höß war Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Seine autobiographischen Aufzeichnungen, betitelt "Kommandant in Auschwitz", entstanden während seiner Untersuchungshaft in Krakau. Sie wurden später von Professor Dr. Martin Broszat ediert und veröffentlicht. Der Text erwähnt Höß' Bedürfnis nach Struktur und die Arbeit als Möglichkeit, den Gefängnisalltag auszufüllen, sowie sein Wunsch, verstanden zu werden.
Wer waren Kaduk, Erber und Klehr und was ist das Buch "Auschwitz - << Direkt von der Rampe weg...>> Kaduk, Erber, Klehr: Drei Täter geben zu Protokoll."?
Kaduk, Erber und Klehr waren Aufseher im Konzentrationslager Auschwitz. Das Buch "Auschwitz - << Direkt von der Rampe weg...>> Kaduk, Erber, Klehr: Drei Täter geben zu Protokoll." enthält Interviews mit diesen drei Aufsehern, die der Fernsehjournalist Ebbo Demant 1978 führte. Die Interviews zielten darauf ab, eine unverfälschte Selbstdarstellung der Täter zu erhalten.
Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den Texten von Höß und den Interviews mit Kaduk, Erber und Klehr?
Höß hatte eine höhere Position und einen umfassenderen Überblick über die Rolle der Konzentrationslager. Seine Aufzeichnungen sind in einer ausgefeilten Schriftsprache verfasst, während die Interviews mit den Aufsehern in gesprochener Sprache mit all ihren Fehlern und Undeutlichkeiten festgehalten wurden. Trotzdem gibt es in Bezug auf die Greueltaten, die in den Konzentrationslagern stattfanden, kaum inhaltliche oder argumentative Abweichungen.
Warum haben sich Höß und die Aufseher bereit erklärt, ihre Aussagen zu machen?
Höß brauchte Struktur und empfand die Aufzeichnungen als sinnvolle Aufgabe. Er wollte auch verstanden werden. Die Gründe für die Bereitschaft von Kaduk, Erber und Klehr zu den Interviews bleiben offen. Möglicherweise wollten sie ihren Haftalltag beleben oder ihren Ärger darüber äußern, dass andere mit geringeren Strafen davongekommen waren.
Wie haben Broszat und Demant auf die Unaufrichtigkeiten und Verschönerungen in den Aussagen der Täter reagiert?
Broszat kommentierte Höß´ Aufzeichnungen wissenschaftlich und überprüfte jede Aussage. Demant ließ die Interviewten frei reden und schob an markanten Stellen des Interviews "Quasi-Augenzeugenberichte" ein, vermutlich von überlebenden Opfern, die die Aussagen der ehemaligen SS-Schergen widerlegen oder relativieren.
Was waren die Beweggründe der Herausgeber, Broszat und Demant, diese Tätertexte zu veröffentlichen?
Beide wollten informieren und zur Katharsis beitragen, um ein Wiederauftreten solcher Ereignisse zu verhindern. Demant reagierte speziell auf die Bewegung der "Auschwitzlüge" in den 1970er Jahren und hoffte, mit der erneuten Veröffentlichung von Tätergeständnissen dieser Bewegung entgegenzuwirken. Broszat wollte zeigen, welche Art von Menschen die Maschinerie des Todes bedienten und dass Massenmord nicht unbedingt mit persönlicher Grausamkeit einhergehen muss.
Was waren die neuen Informationen und Erkenntnisse für den Autor des Textes?
Neu waren vor allen Dingen die nüchternen, logistischen Zahlen, die Enge in den Baracken, die Anzahl der Menschen in Birkenau und das Kompetenzgerangel der SS. Er konnte besser verstehen, dass die Blutsarbeit viele SS-Leute psychisch zermürbte und dass die SS-Führung gerade darin den Elitestatus der SS festmachte.
Was sind die alten Informationen, die auch jeder gute Geschichtsunterricht vermitteln könnte?
Alkoholkonum, die Rechtfertigung "Ich habe nur auf Befehl gehandelt", die Frage "Was hätte ich den machen sollen? Ich hatte doch auch Angst um mein Leben", und die Erklärung "Um die Lagerdisziplin aufrechtzuerhalten, musste manchmal hart durchgegriffen werden." Dazu mischen sich die kleinen, grausamen Details, die Quälereien, die Krankheiten und die eindringlichen Geschichten von den Morgenappellen, den Selektionen, den Exekutionen, etc.
Was ist das Fazit des Autors bezüglich der Täterliteratur?
Der Autor stellt die Frage, ob die Täterliteratur uns dem Verstehen der Ereignisse näherbringt. Er zweifelt daran, ob seine Generation diese Zeit und ihre Geschehnisse und ihre Untaten begreifen oder gar mitleiden kann. Er kommt zum Schluss, dass die Texte dennoch ihre Berechtigung behalten, allein schon aus dem Umstand, dass man niemanden auf Dauer das Wort verbieten darf.
Was bedeutet der Begriff "spannend" im Zusammenhang mit der Täterliteratur?
Der Autor hinterfragt die Verwendung des Begriffs "spannend" im Zusammenhang mit der Lektüre der Täterliteratur, da er eine freudige Erregung mit Auschwitz nicht in Verbindung bringen kann. Er fragt sich verzweifelt, ob er zum voyeuristischen Gaffer wurde.
- Quote paper
- Boris Löchtermann (Author), 2001, Täterliteratur - zum Massenmord an den Juden - eine Banalität? Eine persönliche Leseerfahrung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105459