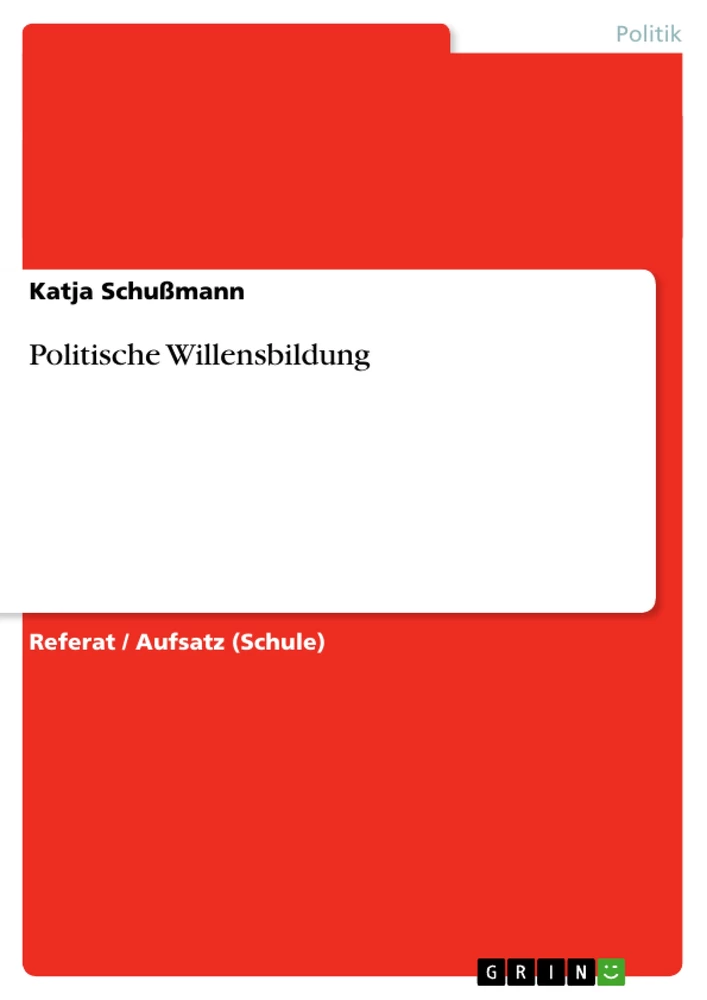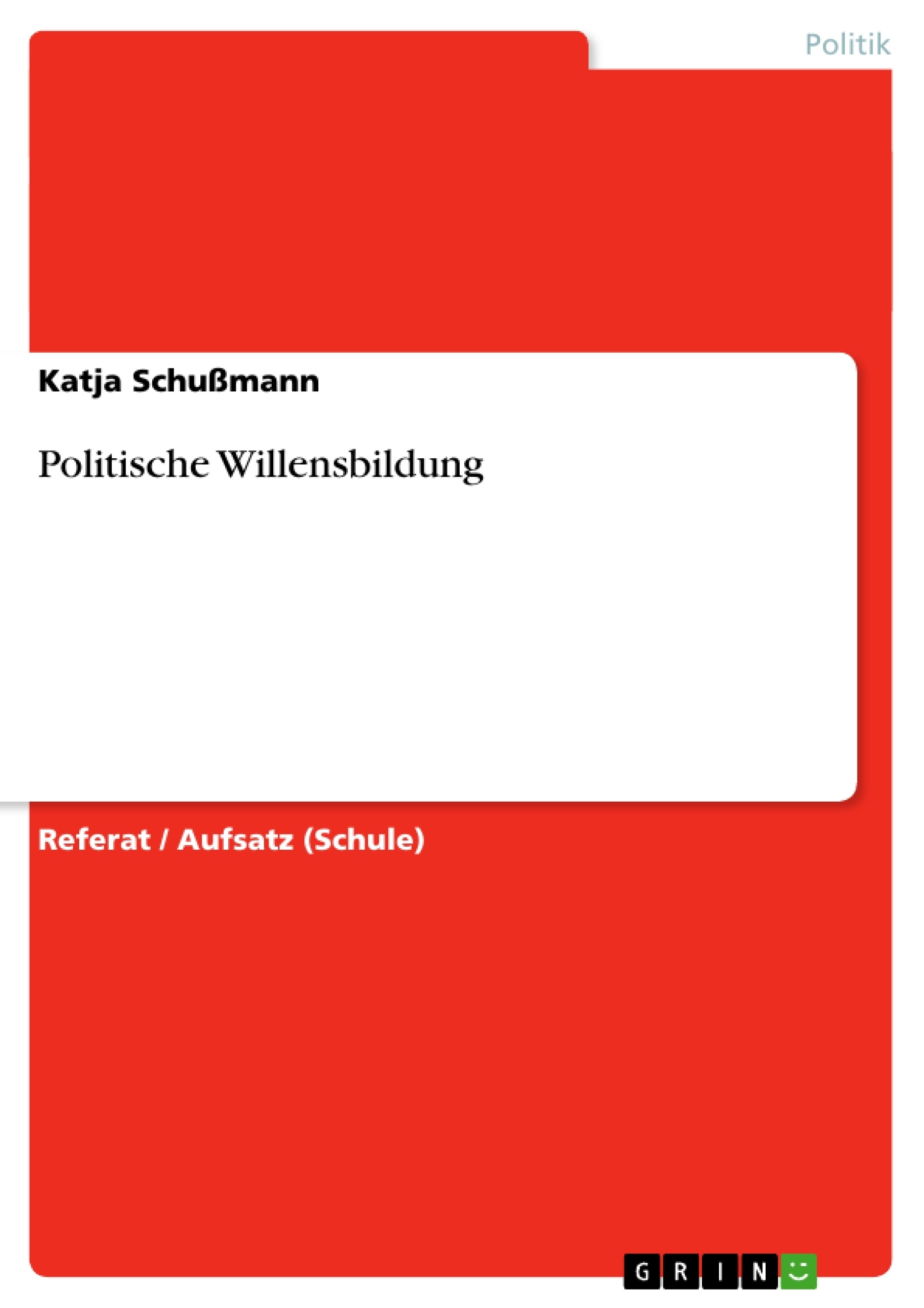Was bedeutet Demokratie wirklich, wenn politische Teilhabe auf persönlichem Opportunismus trifft? Diese tiefgründige Analyse der politischen Willensbildung in der BRD seziert die Möglichkeiten zur Mitbestimmung, die dem einzelnen Bürger offenstehen, und beleuchtet gleichzeitig eine wachsende „Ohne-mich-Bewegung“, besonders unter Jugendlichen. Von Parteien und Interessenverbänden bis hin zu Bürgerinitiativen – das Buch enthüllt das komplexe Zusammenspiel der Kräfte, die unsere Gesellschaft prägen. Es untersucht, wie Interessen gebündelt und selektiert werden, und wirft ein kritisches Licht auf den Einfluss von Lobbygruppen und die Notwendigkeit von Transparenz. Dabei wird die Rolle der Parteien, ihre innere Organisation und ihre Bedeutung für die Aufstellung von Kandidaten beleuchtet. Doch was geschieht, wenn die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung schwindet und die Demokratie von einer Teilnahmemüdigkeit erfasst wird? Anhand von Beispielen wie den zögerlichen Wahlen zum Studentenrat in Rostock wird die aktuelle Lage schonungslos offengelegt. Der Autor scheut sich nicht, die Frage zu stellen: Wen interessiert heute noch die Demokratie? Ein aufrüttelnder Weckruf an eine Generation, die zwar Rechte einfordert, aber oft die Pflichten vergisst. Ein Plädoyer für Engagement und politische Teilhabe, denn Demokratie lebt vom Mitmachen – eine Erkenntnis, die in Zeiten wachsender Politikverdrossenheit wichtiger denn je ist. Dieses Buch ist nicht nur eine Analyse, sondern auch ein Appell: Engagiert euch, bevor es zu spät ist! Es ist eine notwendige Lektüre für alle, die verstehen wollen, wie Demokratie funktioniert und wie wir sie aktiv mitgestalten können, um unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Die Auseinandersetzung mit der Thematik ist eine Aufforderung zur Reflexion über die eigene Rolle in der Gesellschaft und zur aktiven Gestaltung der politischen Landschaft. Ein tiefgründiger Einblick in die Mechanismen der politischen Willensbildung, der zum Nachdenken und Handeln anregt.
Politische Willensbildung
Aufgabe: „ Stelle zusammenh ä ngend dar, welche Möglichkeiten die Demokratie
der BRD dem einzelnen Bürger zur politischen Mitbestimmung gestattet! Beurteile diese Möglichkeiten aus deiner Sicht! “
Einleitung
Um die gegebene Aufgabe zu lösen, möchte ich mit einer allgemeinen Definition von Politik beginnen, um später auf das eigentliche Thema „Demokratie“ eingehen zu können.
Politik ist menschliche Handeln, das die Allgemeinheit betrifft in dem man sich als Mitglied, beispielsweise einer Partei, für etwas einsetzt. Ziel ist es, ein Problem zu lösen, das mit der Art des Zusammenlebens von Menschen zu tun hat. Zur Politik gehört der Konflikt, der Wettstreit der verschiedenen Meinungen. Wer sich politisch engagiert, vertritt eine Meinung und sagt, wie man sich die Lösung eines gesellschaftlichen Problems vorstellt. Wer Interessen durchsetzten will, muß auch überlegen, mit welchen Mitteln das geschehen soll und wie man Gleichgesinnte finden kann, um die eigenen Forderungen möglichst wirkungsvoll vertreten zu können. Parteien, Verbände und Interessengruppen spielen daher eine große Rolle in der Politik.
Nahe zu alle Staaten berufen sich auf das Demokratieprinzip. “Demokratie“ setzt sich aus den griechischen Wörtern demos (Volk) und kratein (herrschen) zusammen und bedeutet wörtlich „Volksherrschaft“. Es ist die Bezeichnung für eine Vielzahl von politischen Ordnungen, in denen sich die Herrschaft auf den Willen des Volkes beruft und dem Volk rechenschaftspflichtig ist, d.h. die Offenheit des politischen Prozesses muss gewährleistet sein.
Nach heutigem Verständnis sind folgende Grundprinzipien notwendige Bedingungen für eine Demokratie: Das Prinzip der Gleichheit und damit verbunden die Beteiligung des gesamten Volkes, bzw. seines erwachsenen, wahlberechtigten Teil, das als Träger der Volkssouveränität Inhaber der Staatsgewalt ist, ist von zentraler Bedeutung. Volkssouveränität ist der den demokratischen Verfassungsstaat kennzeichnende Grundsatz, das alle Staatsgewalt vom Volke aus geht. In der repräsentativen parlamentarischen Demokratie überträgt das Volk die mit seiner Souveränität verbundene Entscheidungsmacht auf Zeit an in geordneten Verfahren zu wählende Vertreter. Dementsprechend heißt es in Art. 20, Abs. 2 des Grundgesetzes für die BRD: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ Ähnliche Formulierungen finden sich in jeder demokratischen Verfassung. Weiterhin wird in einer Demokratie die Regierung in freier, geheimer und allgemeiner Volkswahl gewählt und kann vom Volk bzw. seinen Repräsentanten auch abgewählt werden. Außerdem wird sie vom Volk bzw. seiner Repräsentanten kontrolliert.
Ein weiteres zentrales Merkmal der Demokratie ist ein hohes Maß an Meinungsfreiheit und -vielfalt, sowie das Vorhandensein einer Opposition, als auch die Versammlungsfreiheit. Schließlich zählen auch Gewaltenteilung, das Vorhandensein von Institutionen des Verfassungsstaates und die Unabhängigkeit der Gerichte zu unabdringlichen Bestandteil einer Demokratie. Weiterhin lassen sich präsidiale und parlamentarische Demokratie unterscheiden. In der parlamentarischen Demokratie liegt die große Macht beim Parlament, d.h., dass ohne eine Mehrheit im Parlament keine weitreichende Entscheidung getroffen werden können. Die Regierung ist von Vertrauen des Parlaments abhängig.
In der präsidialen Demokratie verfügt der Regierungschef, der meist zugleich auch Staatspräsident ist und in der Regel von Volk gewählt wird, über zum Teil sehr weitreichende Machtbefugnisse. In bestimmten Kernbereichen ist aber auch der Regierungschef in einer Präsidialdemokratie, die im Übrigen durch eine scharfe Trennung von Exekutive und Legislative gekennzeichnet ist, auf die Unterstützung des Parlaments angewiesen, bzw. muss sich dessen Entscheidungen beugen.
Das Grundgesetz hat des repräsentative Prinzip besonders ausgeprägt gestaltet. Parteien und Interessenverbände organisieren den Willen der Bevölkerung und formen ihn mit. In einem jahrhundertelangen Prozeß haben sich bestimmte Wahlrechtsgrundsätze durchgesetzt. Gemäß Art. 38 Abs. 1 GG werden die Abgeordneten in allgemeiner, unmittelbaren, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Im Frühjahr 1999 wurde vom Landtag beschlossen, dass alle ab dem 16. Lebensjahr bei Kommunalwahlen wählen dürfen. Die Bevölkerung kann aber nicht nur bei Wahlen an der politischen Willensbildung mitwirken. Den Bürgern stehen viele Möglichkeiten der politischen Betätigung offen: Sie können sich beispielsweise über die Parteien Geltung verschaffen, auf die öffentliche Meinung einwirken, als Mitglied eines Interessenverbandes aktiv werden, in Bürgerinitiativen die Entscheidungsprozesse von Parlament und Verwaltung beeinflussen.
Interessenverbände
Die Gesellschaft der BRD zeichnet sich durch Mit-, Neben- und Gegeneinander einer Vielzahl von Interessenverbänden aus. Gegensätze, Spannungen und Konflikte prägen die pluralistische Gesellschaft, da es „die wahren Interessen“ nicht gibt. Die Bürger benötigen möglichst schlagfertige Verbände, die ihre Belange wahrnehmen. Verbände repräsentieren und artikulieren nicht nur die unterschiedlichen, jedoch gleichermaßen legitimen Interessen, sie bündeln und selektieren sie auch. Obwohl Verbände in Deutschland einer gleichsam ehrwürdige Traditionen haben, ist lange ein gewisses Unbehagen ihnen gegenüber vorhanden gewesen. Moralisierende Ressentiments über die „Pressure Groups“ finden heute nicht mehr so starken Anklang. Allerdings machen sich selbst andere Interessengruppen die teilweise noch bestehende Interessenprüderie zu nutze, indem sie ihre Ziele überhöhen und mit dem Gemeinwohl schlecht hin identifizieren. Interessen anderer Gruppen werden gern als „gruppen-egoistisch“ abgewertet. Das GG erwähnt Interessenverbände nicht direkt,. Sie lassen sich mittelbar von Art. 9 GG her legitimieren, der die Vereinigungsfreiheit garantiert. Mehrere 1000 Verbände versuchen in der BRD die vielgestaltigen Interessen der Bürger wahrzunehmen. Von ihnen üben allerdings zahlreiche keinen unmittelbaren Einfluß auf die politische Willensbildung aus. Verbände unterscheiden sich von den Parteien u.a. dadurch, dass sie keine gesamtpolitische Verantwortung übernehmen. Obwohl sie auf alle einflußreichen Parteien einzuwirken versuchen, stehen sie vielfach einer bestimmten politischen Partei nahe. Von einer Interessenidentität ist allerdings nicht zu sprechen. Die Entwicklung in der BRD zeigt im Gegenteil eine Lockerung der parteipolitischen Affinität vieler Verbände. Zum einen müssen sie ihre Glaubwürdigkeit wahren, zum anderen können sie nicht mehr den nötigen Druck auf die politische Entscheidungsfrage ausüben, wenn sie allzu einseitig parteipolitisch fixiert sind. Interessenverbände konzentrieren ihre Aktivitäten vor allem darauf, die Willensbildung der Regierung, der Ministerialverwaltung, der Parteien und der öffentlichen Meinung zu beeinflussen. So regelt etwa § 23 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien die Mitwirkung der Spitzenverbände bei der Vorbereitung von Gesetzesentwürfen. Einerseits trägt diese Vorschrift dem Sachverstand der Interessengruppe Rechnung, andererseits besteht dabei Gefahr, das bestimmte Interessen überproportional stark Eingang in die Gesetzgebung finden. Um den Verbandseinfluß auf den Bundestag transparenter zu gestalten und einer Interessenverfilzung vorzubeugen, hat der Bundestag 1972 allen Verbänden, die Interessen gegenüber den Bundestag oder der Bundesregierung anmelden, zur Auflage gemacht, sich in eine beim Bundestagspräsidenten geführte Liste einzutragen, die alljährlich veröffentlicht wird („Lobby-Liste“). Zu den wichtigsten Interessenverbände in der BRD zählen die Organisationen der Arbeitgeber und die der Arbeitnehmer.
Parteien
Wenn man von Demokratie spricht, spricht man meist auch von Parteien. Parteien sind politische Interessenorganisationen von Bürgern. Da sie im Art. 21, GG der BRD erwähnt werden, sagt man auch, sie haben Verfassungsrang. Dort heißt es. „Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“ Damit genießen sie besondere Rechte. So können Parteien frei gegründet werden, sich frei betätigen und sich an Wahlen beteiligen. Einige Parteien können auch nicht vom Innenminister des Bundes oder eines Landes verboten werden. Nur das Verfassungsgericht kann solche Verbote aussprechen.
Sie sollen auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluß nehmen, die aktive Teilnahme der Bürger am öffentlichen Leben fördern und sie zur Übernahme von politischen Ämtern heranbilden.
Um als Partei anerkannt zu werden müssen bestimmte Auflagen erfüllt werden: Sie muss eine feste Organisation aufweisen, in der Öffentlichkeit hervortreten und muss sich mindestens einmal in sechs Jahren an den Bundestags- und Landtagswahlen beteiligen.
Im GG werden aber auch Regeln für den inneren Aufbau und die Arbeit von Parteien festgelegt. So muss jede Partei demokratisch organisiert sein, sie muss offenlegen, woher sie das Geld für ihre Arbeit bekommt. Auch darf keine Partei die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpfen oder den Bestand der BRD gefährden.
Die wichtigste Aufgabe der Parteien ist es, Kandidaten für Wahlen aufzustellen. Für Bundestagswahlen müssen Wahlkreiskandidaten und die Landesliste gewählt werden. Um einen Wahlkreiskandidaten aufzustellen, schicken die einzelnen Partei-Ortsverbände eines Wahlkreises einige Monate vor den Wahlen Vertreter zu einer Delegiertenkonferenz. Die Ortsverbände können die entsandten Vertreter anweisen für einen bestimmten Kandidaten zu stimmen. Wer die Mehrheit der Stimmen auf der Delegiertenkonferenz erhält, kandidiert für seine Partei im Wahlkreis. Auf die Aufstellung die Wahlkreiskandidaten hat die Parteizentrale also relativ wenig Einfluß.
Es müssen aber auch Kandidaten für die Landesliste aufgestellt werden, die mit der Zweitstimme gewählt werden. Diese Rangfolge auf der Liste wird von der Spitze der Landespartei und Bezirksvorständen ausgehandelt. Dabei muss darauf geachtet werden, dass ein Ausgleich zwischen den verschiedenen Gruppierungen in der Partei (Frauen, Jugend, Arbeitnehmer usw.) geschaffen wird. Sie alle wollen auf der Landesliste berücksichtigt sein. Ist die Liste erst einmal ausgehandelt, wird sie in der Regel von den Delegierten auch so angenommen.
Parteien lassen sich nach mehreren Merkmalen unterscheiden. Ein Merkmal ist die politische Zielsetzung einer Partei. Man kann Parteien aber auch danach unterscheiden, an welche Zielgruppen sie sich wenden.
In modernen Demokratien kann eine Partei aber keine Mehrheit gewinnen, wenn sie sich nur an bestimmte Gruppen oder Gruppierungen wendet. Deshalb versuchen die großen Parteien sich für alle Schichten und Gruppierungen der Bevölkerung zu öffnen. Man bezeichnet solche Parteien dann als Volkspartei.
Bürgerinitiativen
Freiwillige Zusammenschlüsse von Bürgern, die sich gegen bestimmte Missstände oder Fehlentwicklung wenden, nennt man Bürgerinitiativen. Bürgerinitiativen sind eine relative neue Erscheinung in der BRD. Bis zum Ende der sechziger Jahre waren sie fast völlig unbekannt. Und auch 1975 vertrat ein Bonner Ministerialbeamter noch die Ansicht, in zwei Jahren werde niemand mehr von Bürgerinitiativen sprechen. Aber genau das Gegenteil trat ein. Bürgerinitiativen spielen heute eine wichtige Rolle in der Politik, besonders auf der Gemeindeebene.
Im Gegensatz zu Parteien, die sich um viele verschiedene Themen kümmern, verfolgen sie meist ein ganz konkretes Ziel aus dem unmittelbaren Lebens- und Wohnbereich. Wenn dieses Ziel erreicht ist, lösen sie sich oft wieder auf. Es lassen sich zwei Formen unterscheiden: aktive und reaktive. Die aktiven Bürgerinitiativen wollen etwas erreichen, die reaktiven wollen etwas verhindern. Um die Politik eines Gemeinderates, einer Landes- oder der Bundesregierung zu beeinflussen, versuchen Bürgerinitiativen auf sich aufmerksam zu machen. Sie neigen deshalb dazu, erkannte Probleme zu „dramatisieren“. So gewinnen sie die Aufmerksamkeit der Medien und üben Druck auf die Politiker aus.
Eigene Meinung (besonderer Bezug auf die Jugend)
Ich denke, dass eine Art „Ohne-mich-Bewegung“ und keine Bereitschaft zur Übernahme von Pflichten, besonders für die Allgemeinheit, herrscht. Stattdessen flieht man in seine „unpolitische“ Privatsphäre, um sich von der problemhaften Welt abzuschotten. Ich glaube, dass viele Jugendliche "politikverdrossen" sind und ihre Haltung zum Staat und Gesellschaft von persönlichem Opportunismus geprägt ist. Es werden ausschließlich Leistungen vom Staat gefordert. Viele bejahen den demokratischen Rechtsstaat, sind aber nicht bereit, sich dafür zu engagieren. Für diese heißt Demokratie die ungehinderte Verwirklichung aller subjektiven Vorstellungen und Wünsche. Einschränkungen jeder Art werden dabei jedoch prinzipiell abgelehnt. Der Staat dient in vielerlei Hinsicht als Sündenbock für alle nicht erreichten Leistungen und finanziellen Einschränkungen. Nach wie vor steht an oberster Stelle das Erreichen von Zielen in der persönlichen Lebensplanung. Das Basiswissen über den Staat, Gesellschaft und politische Entscheidungsabläufe ist bei vielen Jugendlichen gering.
Kann man sich dann nicht schon die Frage stellen „Wen interessiert denn heute noch die Demokratie?“
Im Herbst 1989 brachen die Bürger der DDR nicht nur auf, um die Ladentheken des Kapitalismus zu erobern, sondern auch , um ein mehr an Demokratie zu erkämpfen.
Wo diese demokratischen Ansätze und guten Vorsätze jedoch geblieben sind, kann man sich in letzter Zeit immer wieder fragen.
Schüler und Schülerinnen nehmen ihre zustehenden Rechte an den Schulen nicht wahr und in Betrieben werden keine Betriebsräte mehr gebildet. Ein aktuelles Beispiel- die allgemeine Demokratiemüdigkeit hat auch die Universität Rostock erreicht. Anfang Februar standen die Wahlen zum neuen Studentenrat an. Nach einer kurz vor den Wahlen einberufenen Sondersitzung der gesamten Studentenschaft, schafften es nur 8 von 15 Fakultäten eine ausreichende Anzahl von Kandidaten bzw. Kandidatinnen für die Wahl zu finden. Und dieses „Trauerspiel“ sieht bei dem weiblichen Teil der Studenteninnenschaft noch trauriger aus, denn nur 41% der Kandidaten und Kandidatinnen waren weiblich.
Sein wir doch mal ehrlich. Man erzählt, dass man sich engagiert in einem Jugendverband oder in sonstigen Einrichtungen, in denen man als junger Mensch mitbestimmen kann. Dann bekommt man nicht zur Antwort: “Schön, dass du dich auch für meine Belange einsetzt!“ Nein. Die Antwort stellt meistens die frage dar: „Bekommst du dafür Geld?“ Und nach der Beantwortung dieser grotesken Frage mit dem Wort „nein“, wird dem dann noch meistens ein: „Du bist ja schön blöd! Kümmere dich doch erst mal um dich selbst!“ nach geschoben.
Wir haben im Grunde viele Möglichkeiten uns ein der Politik einzubringen (siehe oben aufgezählt), die viele nicht nutzten. Das Problem ist jedoch, das wir uns nur beschweren können, anstatt selber aktiv zu werden, um etwas gegen ein aufgetretenes Problem zu unternehmen.
Ich, zum Beispiel, bin Mitglied des Kinder- & Jugendparlaments Neubrandenburg im Fachkreis „Solidaris“ und „Fun- & Freizeit“. Somit habe ich die Möglichkeit meine Vorschläge einzubringen. Ich alleine kann vielleicht nicht viel erreichen, alle zusammen jedoch, haben eine, in meinen Augen, reelle Chance um einen Schritt voran zu kommen.
Aber so ist das nun mal derzeit. Man darf eines nicht vergessen: Demokratie lebt ausschließlich vom Mitmachen! Das jedoch, scheint noch nicht jedem bewusst zu sein.
Darum möchte ich mit einem „Aufruf“ an die Jugend meinen Hausaufsatz beenden:
„Engagiert euch! Ansonsten ist es vielleicht irgendwann mal wieder zu spät!“
Quellen:
Eckhard Jesse „Die Demokratie der BRD“ Unterrichtsmaterial
„ZOOM“ /Zeitschrift
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes "Politische Willensbildung"?
Der Text ist eine umfassende Darstellung der politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland aus der Sicht eines Bürgers. Er behandelt Definitionen von Politik und Demokratie, die Rolle von Parteien und Interessensverbänden, Bürgerinitiativen und eine persönliche Einschätzung der politischen Teilhabe, insbesondere der Jugend.
Welche Definition von Politik wird im Text gegeben?
Politik wird als menschliches Handeln definiert, das die Allgemeinheit betrifft und sich als Mitglied, beispielsweise einer Partei, für etwas einsetzt. Ziel ist es, ein Problem zu lösen, das mit der Art des Zusammenlebens von Menschen zu tun hat.
Was sind die Grundprinzipien einer Demokratie laut dem Text?
Die Grundprinzipien sind das Prinzip der Gleichheit, Volkssouveränität, freie und geheime Wahlen, Meinungsfreiheit, das Vorhandensein einer Opposition, Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Gerichte.
Welche Rolle spielen Parteien in der Demokratie der BRD?
Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, indem sie Kandidaten für Wahlen aufstellen, die öffentliche Meinung gestalten und Bürger zur Übernahme politischer Ämter heranbilden. Sie genießen Verfassungsrang und besondere Rechte.
Was sind Interessenverbände und welche Rolle spielen sie?
Interessenverbände sind Organisationen, die die Interessen verschiedener Bürgergruppen vertreten. Sie bündeln und selektieren Interessen und versuchen, die Willensbildung der Regierung, der Ministerialverwaltung, der Parteien und der öffentlichen Meinung zu beeinflussen.
Was sind Bürgerinitiativen?
Bürgerinitiativen sind freiwillige Zusammenschlüsse von Bürgern, die sich gegen bestimmte Missstände oder Fehlentwicklungen wenden. Sie verfolgen meist ein konkretes Ziel und versuchen, die Politik auf Gemeinde-, Landes- oder Bundesebene zu beeinflussen.
Wie beurteilt der Autor die politische Teilhabe der Jugend?
Der Autor kritisiert eine verbreitete "Ohne-mich-Bewegung" und mangelnde Bereitschaft zur Übernahme von Pflichten für die Allgemeinheit. Er bemängelt eine "Politikverdrossenheit" und eine Haltung, die von persönlichem Opportunismus geprägt ist.
Welche Möglichkeiten zur politischen Betätigung werden im Text genannt?
Bürger können sich über Parteien Geltung verschaffen, auf die öffentliche Meinung einwirken, als Mitglied eines Interessenverbandes aktiv werden und in Bürgerinitiativen die Entscheidungsprozesse von Parlament und Verwaltung beeinflussen.
Was wird im Text zur Wahl von Abgeordneten gesagt?
Gemäß Artikel 38 Absatz 1 des Grundgesetzes werden die Abgeordneten in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.
Welche Quellen werden im Text genannt?
Die genannten Quellen sind Eckhard Jesse "Die Demokratie der BRD" Unterrichtsmaterial und die Zeitschrift "ZOOM".
- Quote paper
- Katja Schußmann (Author), 2000, Politische Willensbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105395