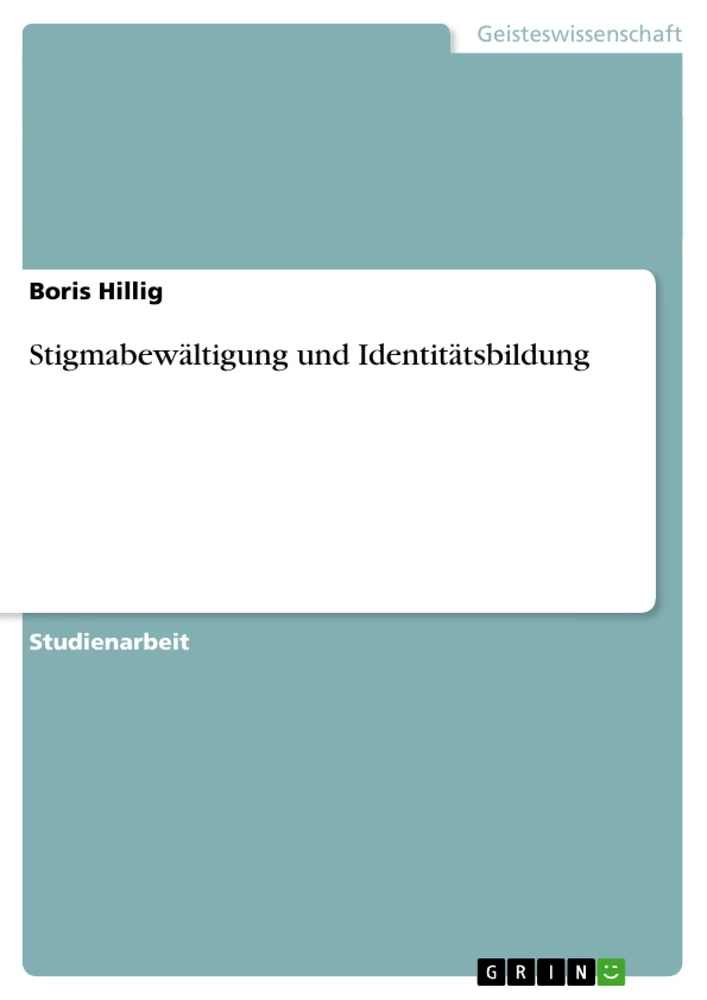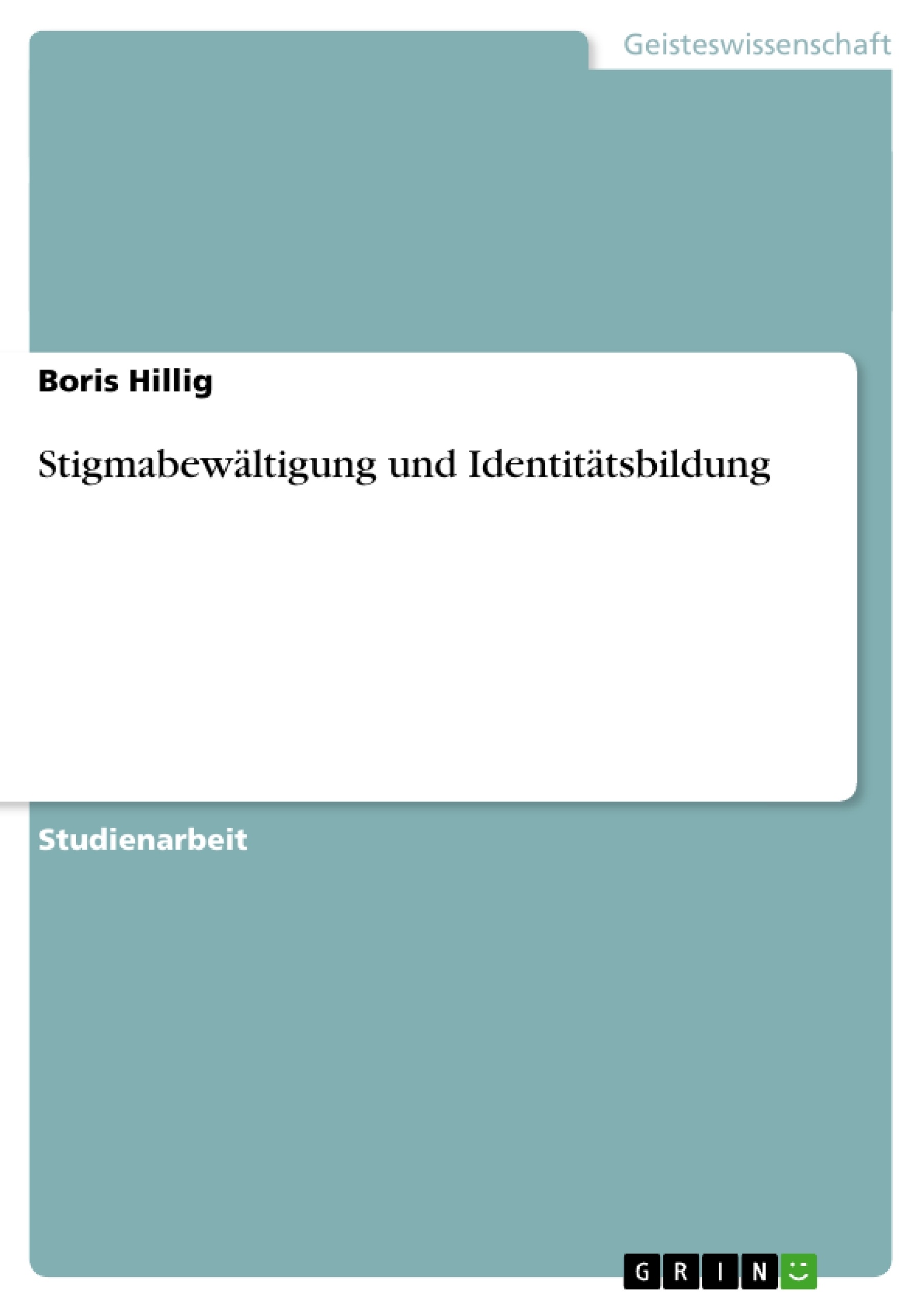Was bedeutet es wirklich, anders zu sein? In einer Welt, die von Normen und Erwartungen geprägt ist, taucht dieses Buch tief in die komplexen Erfahrungen von Menschen ein, die mit einem Stigma leben. Erving Goffmans bahnbrechende Analyse, die hier zugänglich aufbereitet wird, enthüllt die subtilen Mechanismen, durch die Gesellschaften Individuen kategorisieren und ausgrenzen. Von körperlichen Unterschieden über vermeintliche Charakterfehler bis hin zu ererbten Merkmalen – die Formen des Stigmas sind vielfältig und tiefgreifend. Doch wie meistern stigmatisierte Menschen ihren Alltag? Welche Strategien entwickeln sie, um mit Vorurteilen umzugehen, ihre Identität zu bewahren und ein erfülltes Leben zu führen? Das Buch beleuchtet die verschiedenen Phasen der Stigmabewältigung, von der anfänglichen Bewusstwerdung bis hin zur Akzeptanz und Selbstbehauptung. Es untersucht die Bedeutung von Artgenossen und "Weisen", die Unterstützung und Verständnis bieten, sowie die Herausforderungen des "Täuschens" und der "Abschwächung" des Stigmas. Leserinnen und Leser erhalten einen tiefen Einblick in die Identitätsambivalenz, die mit dem Stigma einhergehen kann, und lernen die "Kodizies" kennen, die stigmatisierte Menschen entwickeln, um sich in einer oft feindseligen Welt zurechtzufinden. Diese Arbeit ist eine Einladung, über soziale Normen und Ausgrenzung nachzudenken und ein tieferes Verständnis für die Lebensrealitäten von Menschen mit Stigma zu entwickeln. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Soziologie, Psychologie, Diversität und Inklusion interessieren und einen Beitrag zu einer gerechteren und verständnisvolleren Gesellschaft leisten möchten. Entdecken Sie die verborgenen Strategien der Stigmabewältigung, die weit über oberflächliche Betrachtungen hinausgehen, und erfahren Sie, wie Menschen ihre Identität inmitten gesellschaftlicher Ausgrenzung bewahren. Tauchen Sie ein in die Welt der Stigmatisierung, Identität und sozialer Interaktion.
Gliederung
1. Einleitung
2. Zum Begriff des Stigma
2.1. Formen von Stigmatas
2.2. Temporärer Erwerb und Bewußtwerdung von Stigmatas
3. Artgenossen und Weise
3.1. Artgenossen und Professionelle
3.2. Die Weisen
4. Stigma-Management und Identität
4.1. Identitätstypen
4.2. Identifizierung
4.3. Das soziale Umfeld stigmatisierter Individuen
4.4. Der Prozeß des Täuschens
4.5. Abschwächung eines Stigmatas
4.6. Schlußphase der Identitätsbildung
4.7. Sonstige Methoden des Stigma-Managements
5. Identitätsambivalenz und Kodizies
6. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Ziel dieser Hausarbeit soll sein, die einzelnen Phasen und Schritte von stigmatisierten Personen aufzuzeigen und die damit einhergehenden Probleme und die verschiedenen Möglichkeiten der Bewältigung dieser zu verdeutlichen. Dies geschieht anhand der Theorie Goffmans zum Thema Stigma ( Goffman, Erving: Stigma - Über die Techniken der Bewälti- gung beschädigter Identität, Viertes und fünftes Tausend 1970, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1967 ).
Unter Vernachlässigung der psychologischen Seite, spielen demnach auch nur solche Situationen eine Rolle, in denen stigmatisierte Personen mit sogenannten „Normalen“, also Menschen ohne Stigma, auf irgendeine Art und Weise in Kontakt miteinander treten.
Die Stigmabewältigung beginnt mit dem Moment , in dem ein Individuum sich bewußt wird, daß sie im Besitz eines Stigmas ist, und führt mit den verschiedenen Formen des Umgangs damit fort. Dieser Prozeß ist verantwortlich für die eigene Identität und beeinflußt sie nachhaltlich. Somit ist die Stigmabewältigung auch nicht von der Identitätsbildung loszulösen; beide sind eng miteinander verbunden.
2. Zum Begriff des Stigma
Der Begriff Stigma stammt ursprünglich aus dem Griechischen und soll einen Verweis auf körperliche Zeichen machen, die etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den moralischen Zustand des Zeichenträgers offenbaren (vgl. ebd., S. 9 ).
Ein Stigma ist somit ein Zeichen, ein Merkmal, ein Handikap oder schlicht und einfach ein „Fehler“, aufgrund dessen die normalen Individuen das stigmatisierte Individuum nicht mehr als normal charakterisieren, es als schlecht und nicht ebenwürdig empfinden, es als inferior bezeichnen, und ihm somit die vollständige soziale Akzeptanz verweigern. In der heutigen Zeit wird der Begriff des Stigmas jedoch weniger im Hinblick auf körperliche Defekte, als vielmehr auf die Unehre eines Menschen an sich angewandt.
Eigenschaften, die als Stigma bezeichnet werden hängen von der Gesellschaft, dem sozialen Umfeld oder auch der Gruppe ab, in dem sich Individuen bewegen. Was in der einen Gesell- schaft als abartig, unnatürlich oder falsch betrachtet wird, den Normen also nicht entspricht, kann in einer anderen Gesellschaft als vollkommen normal betrachtet werden. Ob eine Person also Träger eines Stigmas ist oder nicht, hängt von ihrem sozialen Umfeld ab und nicht von einer bestimmten Eigenschaft.
2.1. Formen von Stigmatas
Im Wesentlichen können drei verschiedene Formen von Stigmatas unterschieden werden.
Zum Einen sind esphysische Deformationen, wie z.B. das Fehlen eines Armes oder Beines. Das schicksalhaftige von körperlichen Handikaps für stigmatisierte Personen ist, daß sie ihr Gegenüber davon nicht „verschonen“ können. Die Andersartigkeit drängt sich dem Normalen geradezu auf und hat damit zur Folge, daß die stigmatisierte Person eben erst zu dieser wird, da sie in unerwünschter Weise von den Normen abweicht. Für die betreffende Person eines körperlichen Handikaps besteht allerdings manchmal auch die Möglichkeit, etwa durch Kleidungsstücke, sein Gegenüber darüber hinwegzutäuschen; darauf gehe ich noch an anderer Stelle ein.
Die zweite Form eines Stigmatas ist die einesindividuellen Charakterfehlers, wie Goffman dies nennt. Hierzu gehören im wesentlichen Eigenschaften wie z.B. Alkoholismus, Homo- sexualität, Arbeitslosigkeit, Geisteskrankheiten, suizide Handlungen usw.
Die dritte und letzte Form ist die einesphylogenetischen Stigmatas.Es sind dies meist Eigenschaften, die vererbar sind. Dazu gehören Rasse, Nation wie auch Religion.
Aufgrund dieser verschiedenen Arten von Stigmatas werden die Stigmatisierten von den Normalen, also von jenen, die von in Frage stehenden Erwartungen nicht negativ abweichen ( vgl. ebd., S. 13 ), als nicht normal assoziiert. Daher werden sie oftmals diskriminiert, und nur selten werden ihnen die gleichen Chancen wie den Normalen zugestanden.
2.2. Temporärer Erwerb und Bewußtwerdung von Stigmatas
Diskreditierbare Individuen, also solche,die stigmatisierbar sind, aber noch nicht von ihrem Umfeld stigmatisiert worden sind, und in diesem speziellen Falle, die sich auch noch gar nicht über ihre potentielle Möglichkeit eines Ausschlusses aus der Gesellschaft bewußt geworden sind, lernen zunächst einmal den Standpunkt der Gesellschaft bzw. der Normalen kennen und übernehmen deren Identitätsglauben. Das Individuum lernt somit auch wie es wäre eine stigmatisierte Person zu sein. Für diskreditierbare Personen stellen sich nun vier Möglichkeiten des zeitlichen Erwerbs und der Bewußtwerdung von Stigmatas und beeinflussen somit ihre Identität.
Zunächst einmal besteht die Möglichkeit, daß ein Individuum von Geburt an stigmatisiert ist, indem es z.B. mit einer physischen Deformation geboren wird oder etwa vaterlos aufwächst.
Die betreffende Person wird gerade dann in ihre unvorteilhafte Situation sozialisiert, wenn sie die Standards, die sie nicht erreicht, kennenlernt. Zum Beispiel lernt ein Waisenknabe, daß Kinder normalerweise Eltern haben, genau dann, wenn er erfährt, was es bedeutet keine zu haben ( vgl. ebd., S. 46 ).
Die zweite Möglichkeit besteht darin, daß Individuen zwar von Geburt an stigmatisiert sind, aber die ersten Jahre ihres Lebens quasi isoliert und geschützt vor der Gesellschaft durch ihre Eltern und einen kleinen Bekannten- und Freundeskreis werden. Diese Kinder entwickeln somit ein vollkommen normales Identitätsbewußtsein, da keine diskreditierenden Äußerungen von außen an sie herankommen. Irgendwann kann der häusliche schützende Mantel aber nicht mehr länger aufrechterhalten werden, etwa mit dem Eintritt in den Kindergarten oder die Schule, und das bisher sich als vollkommen normal fühlende Kind muß oft auf grausame Weise die Erfahrung machen ( etwa durch Hänseleien ), daß es alles andere als normal ist. Diese Erfahrung, die Goffman „moralische Erfahrung“ oder den „moralischen Werdegang“ nennt, verändert nachhaltlich das weitere Leben des Individuums und seine Identität.
Die dritte Möglichkeit des Sozialisationsprozesses besteht darin, daß ein Individuum erst sehr spät im Leben in den „Besitz“ eines Stigmatas kommt, oder was für die betreffende Person meist noch schlimmer ist, das sie erfährt, daß sie schon immer diskreditierbar gewesen ist. Wird jemand erst spät im Leben stigmatisiert, so hat der Betreffende bereits die unterschied- lichen Behandlungen zwischen Normalen und zwischen Normalen und Stigmatisierten kennengelernt. Das jetzt stigmatisierte Individuum zählte sich früher immer zu den Normalen, also zur Mehrheit, und muß nun die andere Seite, die der Minderheit, für sich akzeptieren. Es wird automatisch eine neue bzw. andere Identität von sich entwickeln, indem es sich aller Wahrscheinlichkeit nach erst einmal als inferior betrachten wird. Erfährt das Individuum dagegen erst spät im Leben, das es schon immer diskreditierbar gewesen ist, so wird seine neue soziale Situation wahrscheinlich noch weit aus schwieriger werden, da es eine Reorganisation seiner Sicht, seiner Vergangenheit vornehmen muß. Seine Neuidentifizierung wird zum Problem, da es in seinem bisherigen Leben genug über die Sichtweise der Normalen über die Stigmaitsierten gelernt hat ( vgl. ebd., S. 47-48 ).
Der letzte Fall besteht darin, das ein Individuum von Anfang an in einer ihm eigentlich fremden Gesellschaft sozialisiert worden ist, und nun eine neue Seinsweise erlernen muß, die von seiner Umgebung als die real gültige empfunden wird (vgl. ebd., S. 49 ).
In allen vier Fällen wird der Augenblick oder besser die Phase, in der das Individuum lernen muß, das es ein Stigmata besitzt, die für seine Identität entscheidene sein, da es eine neue soziale Beziehung zu anderen Stigmatisierten und zu Normalen eingehen wird und bereits be- stehende Beziehungen sich verändern werden.
3. Artgenossen und Weise
Es existieren zwei Kategorien von Menschen, die dem stigmatisierten Individuum das Gefühl geben, menschlich gesehen normal zu sein. Zum Einen sind es selbstverständlich diejenigen, die das Stigma teilen, die Artgenossen, und zum anderen jene Normalen, die aus irgendeinem Grund mit dem Stigmatisierten mitfühlen können, die sogenannten Weisen, wie Goffman sie nennt.
3.1. Artgenossen und Professionelle
Artgenossen können aufgrund ihrer besonderen Beziehung zu einer stigmatisierten Person diesen ihre Lebenserfahrung und die verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs mit dem Stigma näher bringen. So können sie ihr Wissen teilen und gegenseitige Tips geben, wie sie den Normalen entgegenkommen können, um ihnen den Umgang mit den Stigmatisierten zu erleichtern. In einem folgenden Kapitel werde ich darauf noch näher eingehen.
Die Artgenossen stellen aber auch einfach nur eine Hilfe dar, indem man mit ihnen ungeniert über die Probleme reden kann, die ein Stigma im täglichen Leben mit sich bringt. Das Stigma bildet hier also die Basis der Lebensorganisation. Nur aufgrund des „Fehlers“, bildet sich eine Gemeinschaft, die ansonsten nie in der Form entstehen würde (vgl. ebd.,S.32).
In eben genannten Fall, bei der das Stigma quasi eine positive Basis darstellt, kann es aber genausogut von einigen Individuen immer noch als die allumfassendste und einzigst große Strafe an sich angesehen werden, da das Stigma immer wieder der Punkt im Leben der Gesellschaft ist, um den sich alles dreht.
Stigmatisierte Individuen schließen sich oftmals zu Gruppen oder Vereinen zusammen, sie bilden eine Kategorie einer bestimmten Eigenschaft, z.B. die, anonymer Alkoholiker. In der Regel haben solche Gemeinschaften ausgewählte Vertreter oder Wortführer, die die Gruppe repräsentieren und nach außen hin vertreten.
Nun bestehen prinzipiell zwei Möglichkeiten nach denen diese Vertreter ausgesucht oder gewählt werden: Es können Artgenossen sein, oder aber Außenstehende, also Normale, die das entsprechende Stigma nicht besitzen. Unabhängig davon, welcher „Seite“ sie angehören, haben beide dieselbe Aufgabe, nämlich „die Öffentlichkeit dahin zu beeinflussen, eine mildere soziale Bezeichnung für die in Frage kommende Kategorie zu gebrauchen“ ( ebd., S.36 ). Goffman führt hier das Beispiel an, wie es der New Yorker Liga für Schwerhörige ge- lang, das Wort „taub“ nach und nach aus dem öffentlichen Sprachgebrauch zu verbannen und statt dessen Begriffe wie Schwerhörigkeit, Hörschäden oder Hörverlust zu manifestieren.
Bilden Artgenossen die Gruppenführer, die die Gemeinschaft auch öffentlich nach außen hin vertreten, so kann es leicht passieren, daß sie darin ihre ganze Lebensaufgabe sehen. Da sie dasselbe Stigma besitzen, das sie auch vertreten, sie es also nach getaner Arbeit nicht ablegen können, wird ihre anfängliche Aufgabe zum Full-Time-Job, da sie ja selbst im alltäglichen Leben ihre Probleme mit dieser unerwünschten Eigenschaft managen müssen. Der ursächliche Grund, das Stigma, der unerwünschte „Fehler“, weswegen sie dieser Gruppe beigetreten sind, wird zum identifikatorischen Hauptaspekt schlechthin. Als Nicht-Normale leisten sie große Arbeit und werden somit von der normalen Gesellschaft mit Bewunderung und Aner-kennung bedacht, da sie ein nicht normales Individuum sind, das bemerkenswerte überdurchschnittliche Leistung vollbringt.
Dies ist eine von mehreren Möglichkeiten der Stigmabewältigung. Die stigmatisierte Person, die anfänglich große Probleme mit ihrer beschädigten Identität und wegen ihrer Andersartigkeit hat, lernt zu ihrer Unzulänglichkeit zu stehen, und macht sie sogar zu ihrem Beruf, zu ihrem Lebensinhalt. Goffman nennt solche Stigmatisierten die Professionellen.
3.2. Die Weisen
Die zweite anteilnehmende Gruppe neben den Artgenossen ist die der Weisen, die sich wiederum in zwei Untergruppen unterteilen läßt.
Auf der einen Seite sind es die Weisen, die durch ihren Beruf bzw. ihre Arbeit mehr mit be- stimmten Kategorien Stigmatisierter zu tun haben als andere Normale und dadurch ihre Weisheit erlangen. Zum Anderen sind es Personen, die aufgrund ihrer Sozialstruktur eng mit stig- matisierten Personen verbunden sind. Als Beispiel hierfür seinen Ehepartner oder Kinder ge- nannt, die einen gewissen Teil des diskreditierten Status ihrer stigmatisierten Bezugsperson teilen müssen oder auch wollen.
4. Stigma-Management und Identität
Den Weg, für den ein stigmatisiertes Individuum sich entscheiden muß, wenn es begreift, das es ein solches besitzt, hängt in erster Linie davon ab, wie sichtbar oder evident sein Stigma für andere ist. Je nachdem wie wahrnehmbar sein Stigma ist, bieten sich dem Individuum mehrere Möglichkeiten des Stigma-Managements ( s. Gliederung „Der Prozeß des Täuschens“ ), da Stigmasymbole Zeichen sind, die der Vermittlung von sozialer Information gegenüber anderen dienen, und Stigmatisierte der Versuchung unterliegen, diese Information zu ihrem sozialen Vorteil zu manipulieren, um damit die Chance zu erhöhen, von Normalen wie Normale behandelt zu werden.
4.1. Identitätstypen
Nach Goffman können für das stigmatisierte Individuum drei relevante Identitätstypen unterschieden werden. Es sind dies die persönliche, die soziale und die Ich-Identität.
Der Begriff der persönlichen Identität meint, daß ein Individuum aufgrund „positiver Kenn- zeichen“, z.B. die eines Photos, der Handschrift, der Geburtsurkunde usw., und aufgrund einer „einzigartigen Kombination von Daten seiner Lebensgeschichte“ ( ebd., S.74 ), von allen übrigen Personen der Welt unterschieden werden kann ( vgl. ebd., S.74 ).
Ein Beispiel persönlicher Fehldarstellung ist z.B. die Verwendung eines falschen Namens.
Die soziale Identität ist genauso wie die persönliche Identität zunächst einmal Teil des Inter- esses anderer Personen hinsichtlich eines speziellen Individuums. Bei der sozialen Identität geht es jedoch darum, sich seiner Kategorie, seines Standes, seiner sozialen Stellung ent- sprechend zu verhalten. Ein Beispiel sozialer Fehldarstellung wäre z.B. das Tragen von nicht standesgemäßer Kleidung. Im Gegensatz zur persönlichen Identität wird die soziale Identität praktisch sofort mit der Wahrnehmung eines Individuums offenbart, das heißt es gibt quasi keine vollständig anonyme soziale Identität. Ohne den Begriff der sozialen Identität wäre keine Stigmabetrachtung möglich.
Die Ich-Identität beschreibt das subjektive Empfinden seiner eigenen Situation als Ergebnis verschiedener sozialer Erfahrungen, die das Individuum im Laufe der Zeit macht. Die Ich- Identität gibt somit Auskunft darüber, was ein Individuum über sich und sein Stigma denkt, und wie es versucht damit umzugehen.
4.2. Identifizierung
Das Identitätsmanagement von stigmatisierten Personen hängt davon ab, was und wieviel an-dere Personen über es wissen oder glauben zu wissen. Je nachdem, was der/die Stigmatisierte glaubt, was andere über ihn/sie zu wissen glauben, wird er/sie einen bestimmten Weg einschlagen.
„Das Individuum, über das andere Bescheid wissen, kann wissen oder nicht wissen, daß sie über es Bescheid wissen; sie können umgekehrt wissen oder nicht wissen, daß es von ihrem Bescheidwissen weiß oder nicht weiß. Außerdem kann es, falls es glaubt, daß sie nicht über es Bescheid wissen, nichtsdestoweniger niemals sicher sein“ ( ebd., S.86 ).
Dieses Zitat macht die ganze Bandbreite von Schwierigkeiten und Proble men des stigmatisierten Individuums hinsichtlich seiner Stigmabewältigung und Identitätsbildung offensichtlich.
So führt Goffman das Beispiel an, wie ehemalige Geisteskranke, die eine gewisse Zeit in einer Anstalt für Geisteskranke verbracht haben, sich im öffentlichen Leben plötzlich Be- kannten aus dieser Zeit gegenübersehen, ihre persönliche Identität also erkannt wird, und sie sich zu einem Gruß oder einem Zunicken verpflichtet sehen. Die ehemals kranke Person kann nun in die unglückliche Lage kommen, einer ihr dritten bekannten Person, die nichts von ihrer Vergangenheit, ihrem „Fehler“, wußte und Zeuge dieses Geschehen war, erklären zu müssen, woher sie die Person kennt.
Ebensogut müssen sich ehemals stigmatisierte Individuum darüber im klaren sein, daß sie von Personen erkannt werden können, die sie selbst nicht (mehr) kennen, oder sich einfach nicht (mehr) an sie erinnern können. Ein Individuum kann sich somit seiner Anonymität nie ganz sicher sein, was seine Identitätsbildung erschwert.
Demgegenüber können Individuen des öffentlichen Rampenlichts, Filmstars zum Beispiel, entweder ihre Popularität genießen, oder aber versuchen, ihrer allgemein bekannten persönlichen Identität zu entkommen, d.h. sie suchen eine Gemeinschaft, die sie nur hinsichtlich ihrer sozialen Identität wahrnimmt, nicht aber ihre Persönlichen. Goffman bezeichnet solch eine Gemeinschaft, als eine Gemeinschaft, die keine Biographie über die entsprechende Person besitzt, also keinerlei Information über sie hat ( vgl. ebd., S. 89 ).
4.3. Das soziale Umfeld stigmatisierter Individuen
Je nachdem, ob ein stigmatisiertes Individuum mit fremden oder ihm bekannten Normalen in Kontakt tritt, wird es schwierig oder einfach für es sein, mit ihnen umzugehen. Dies hängt allerdings nicht nur von der normalen Person ab, sondern auch von der Art des Stigmatas.
Während es einer Person mit einer „Gesichtsverunstaltung“ wohl leichter fallen wird mit ihm bekannten Personen in Kontakt zu sein, und diesen jenes auffällige Makel wohl nicht weiter stören wird, da sie es von dem Stigmatisierten gewöhnt sind, wird ein Fremder wohl eher davor zurückschrecken ( vgl. ebd., S. 68 ).
Allerdings wird die stigmatisierte Person bei ausreichender Zeit wohl auch in der Lage sein, sich seinem fremden Gegenüber auf persönlicher Ebene zu nähern, die anfängliche stereotyp- bedingte Distanz abzubauen, und dem Normalen somit seine persönlichen Qualitäten näher zu bringen und damit die Bedeutung des Stigmas abzuschwächen.
Genausogut werden Normale, die in Nähe zu öffentlichen Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser oder auch Blindenschulen wohnen, lernen, mit diesen sozialen Randgruppen besser umzugehen. Dies muß gleichzeitig nicht bedeuten, das ihre Verachtung diesen Stigmatisierten gegenüber auch abnehmen muß.
Andere Arten von Stigmatas, jene, die sich leicht vor Fremden oder auch Bekannten ver- stecken lassen, also z.B. solche wie Impotenz oder Homosexualität, spielen bei diesem Personenkreis wohl keine oder nur eine unwesentlich kleine Rolle. Hier sieht sich das stigmatisierte Individuum vor allem vor einem Problem hinsichtlich vertrauter, ihm sehr nahestehender Personen, solange es sein Stigma als beschämend betrachtet, oder weiß, daß sein vertrautes Umfeld darauf sehr verlegen und unglücklich reagieren würde.
4.4. Der Prozeß des Täuschens
Es ist wahr, daß stigmatisierte Individuen sich selbst oftmals als vollkommen normales und menschliches Wesen empfinden, geschützt und gestärkt durch ihren eigenen Identitätsglauben. Es sind dies Personen, die zwar eine Stigma besitzen, sich aber dadurch absolut unbeein- druckt fühlen, und zwar aus jenem Grund, da sie noch nicht realisiert haben, das sie ein solches besitzen, bzw. ihnen nicht klar ist, was es für sie sozial bedeutet.
Begreift das stigmatisierte Individuum, daß es ein solc hes ist, so äußert sich dies meist in Scham, und es kommt zu der Überzeugung, daß es etwas besitzt, was es lieber nicht besitzen würde, und das es von der Mehrheit unterscheidet.
Ist das Stigmata nun von solcher Art, das es evident und offensichtlich für alle anderen ist, so muß der/die Stigmatisierte versuchen sich damit abzufinden, so banal das auch klingen mag. Die stigmatisierte Person besitzt lediglich noch die Möglichkeit des Kuvrierens (s. Gliederung „Abschwächung eines Stigmatas“ ).
Handelt es sich aber um ein Stigmata, von dem angenommen werden kann, das es nicht offensichtlich und daher jedermann bekannt ist, es sich also um eine diskreditierbare, nicht aber um eine diskreditierte Person handelt, so besteht die Möglichkeit des Täuschens.
Ziele und Zwecke des Täuschens sind jene, sich in eine Gemeinschaft zu sozialisieren bzw.
nicht desozialisiert zu werden. Der Prozeß des Täuschens ist somit Teil der Identitätsbildung, da noch über die wahre Identität hinweggetäuscht wird, das stigmatisierte Individuum hat es noch nicht geschafft, offen zu seinem Stigma zu stehen.
Der Begriff des Täuschens bezieht sich somit auf eine bewußt geplante und ausgeführte Handlung, deren Möglichkeit sich das stigmatisierte Individuum zunächst einmal immer bedienen wird, falls die Möglichkeit dazu besteht. Der Grund, warum es dies tun wird, ist der, daß es von der Gesellschaft wie ein normales Individuum behandelt wird, und es daran Gefallen finden wird, zur großen Gemeinschaft dazuzugehören. Die täuschende Person führt somit ein Doppelleben, das eines Stigmatisierten und das eines Normalen, was in Identitätsschwankungen resultieren kann und gegebenenfalls sogar in Erpressungen seitens Dritter, die mit der Preisgabe seiner wahren Identität drohen können. Der oder die Stigmatisierte, der/die sein/ihr Umfeld täuscht, lebt somit ein Leben in Angst und unter dem Erfolgsdruck des Täuschens bei der Interaktion mit Normalen nicht zu versagen.
Das Heimtückische am Täuschen ist, das die Täuschenden von Artgenossen oder Weisen beim Täuschen ertappt werden können, da ihnen die Techniken des Täuschens vertraut sind, bzw. sie sie selbst anwenden. Genausogut kann das Individuum, das falsche Tatsachen vor-spielt, also täuscht, erfahren, was andere Personen über Personen seiner Art wirklich denken. Der Akt des Täuschens kann auch leicht in einer Aneinanderreihung von Lügen enden, um die Enthüllung des defekten Attributes weiter zu verheimlichen. Dies wiederrum kann zu Mißverständnissen und Gefühlsverletzungen seitens der Normalen führen. Genausogut können die Normalen andere als die eigentliche Unfähigkeit wahrnehmen, wie wenn z.B. ein Blinder sich so verhält, als ob er sehen könnte, sich was zu Trinken einschenkt und dabei alles verschüttet ( vgl. ebd., S. 107 ).
Ebenso besteht die Möglic hkeit, daß das stigmatisierte Individuum versucht, engen sozialen Bindungen, etwa Partnerschaftsbindungen, aus dem Weg zu gehen, da sie viel Zeit und eine Menge intimer Fakten benötigen, die die Gefahr bergen, daß der Normale an die diskreditier-bare Information herankommt. Eine Abkapselung und gesellschaftliche Vereinsamung des stigmatisierten Individuums wären die Folge.
Als extremes Beispiel kann die Mißbildung eines Geschlechtsorganes genannt werden, das in der Regel nur sehr vertrauten Personen bzw. Lebenspartnern offenbart wird.Genausogut gibt es Stigmatas, die sich an Körperstellen befinden, die aufgrund gesellschaftlicher Normen selbst makellose Personen, also sog. Normalen, nicht in der Öffentlichkeit offenbaren dürfen. Dies kann somit nicht als ein Prozeß des Täuschens betrachtet werden, jedoch kann die Ein- ladung eines Normalen in die Sauna etwa, dem stigmatisierten Individuum seine stigmatisierte Situation wieder vor Augen führen.
Das Verdecken von Zeichen, die zu Stigma-Symbolen geworden sind, gehört ebenfalls zum Akt des Täuschens. So kann ein Blinder etwa bewußt seinen Blindenstock vor den Augen der Normalen verstecken, wenn er z.B. sitzt oder aus irgendeinem Grunde nicht auf ihn ange- wiesen ist.
Genausogut kann ein Stigmatisierter das Zeichen seines stigmatisierten Fehlers als Zeichen eines anderen Attributes darstellen, eines, das weniger deutlich ein Stigma ist (vgl. ebd.,S. 120 ). Goffman führt hierfür das Beispiel an, wie eine schwerhörige Person Geistesabwesen- heit und tagträumer-isches Verhalten vortäuschen kann, nur um nicht als schwerhörig identifiziert zu werden.
Zum Schluß sei noch angemerkt, daß es Stigmasymbole solcher Art gibt, die das stigma- tisierte Individuum praktisch zwingen, sie der einen Personengruppe zu offenbaren, während sie sie der anderen Personengruppe verheimlichen müssen. Goffman führt hier unter anderem das Beispiel eines Drogenabhängigen in Bezug auf seine Dealer bzw. die Polizei an.
4.5. Abschwächung eines Stigmatas
Wählen Individuen nicht die Möglichkeit des Täuschens, so versuchen sie meist immer ihren Defekt abzuschwächen, zu reduzieren oder zu kuvrieren, wie Goffman dies nennt.
Hierbei geht es nicht darum, den Normalen eine ebenbürdige normale Person vorzuspielen, im Gegenteil, der oder die Stigmatisierte stehen zu ihrem Makel. Der Grund, warum sie ihr Stigma abschwächen wollen, liegt einzig und allein darin, das sie den Normalen den Umgang mit ihnen erleichtern wollen. Sie wollen das offensichtliche Stigma nur kuvrieren, damit es sich den Normalen nic ht zu sehr „aufdrängt“ ,und sie die Spannung, die zwischen dem Normalen und dem Stigmatisierten herrscht, verringern können ( vgl. ebd., S.129 ). Damit fördern sie die Interaktion und vermindern gleichzeitig die vorgetäuschte Nichtbeachtung des Stigma- tas seitens des Normalen. Das Vermeiden bestimmter Verhaltensweisen, die ein Stigma noch hervorheben würden, gehört genauso zum Akt der Reduzierung wie z.B. das versteckte Tragen eines Hörgerätes.
4.6. Schlußphase der Stigmabewältigung
Nachem eine Person eine ganze Zeit lang die Technik des Täuschens angewand hat, um über ihren Makel hinwegzutäuschen, kann sie nun zu einer neuen Einstellung gelangen.
Sie wird sich die Frage stellen, warum sie denn unbedingt aller Welt eine Normalität vor- gaukeln will, die sie nicht besitzt, und welches viel Anstrengung und Mühe kostet, um sich nicht zu verraten. Das stigmatisierte Individuum kommt so zu dem Schluß, das sie nicht länger das Leben leben will, das dem ihren gar nicht entspricht. Sie hat nun gelernt zu ihrem Stigma zu stehen und will es auch offen zeigen. Der oder die Stigmatisierte akzeptiert seine/ ihre persönliche und soziale Identität ohne Wenn und Aber.
Der Weg des freiwilligen Enthüllens des Stigmatas kann entweder durch die offene und nicht verheimlic hte Zurschaustellung geschehen, oder aber durch bewußt gemachte Bemerkungen, die den Fehler als eine Selbstverständlichkeit offenbaren. Goffman nennt hier das Beispiel einer Jüdin, die ihren Davidstern offen und für jeden sichtbar am Halsband trägt.
Genausogut können offensichtlich Stigmatisierte, die die ständige und immer wieder kehende Fragerei nach dem Erwerb ihres Stigmatas erdulden müssen, wodurch sich fremde Normale ungeniert einen Zugang zur Privatheit Stigmatisierter ermöglichen können, abweisende Antworten geben, um in Ruhe gelassen zu werden. „Die Fragen darüber, wie ich mein Bein verlor, ärgerten mich immer, so entwickelte ich eine stehende Antwort, die diese Leute davon abhielt, noch weiter zu fragen: „Ich habe mein Bein im Pfandhaus versetzen müssen, als ich knapp bei Kasse war“ “( ebd., S. 168 ).
4.7. Sonstige Methoden des Stigma-Managements
Neben den bereits erwähnten Möglichkeiten der Stigmabewältigung, wie die des Täuschens, des Abschwächens oder der Akzeptanz als Schlußphase, gibt es noch andere, die ich hier nur kurz nennen möchte.
Zum Einen besteht für ein stigmatisiertes Individuum die Möglichkeit, den Fehler zu korri- gieren. Dies ist vor allem durch Schönheitsoperationen für körperliche Normabweichungen und durch Psychotherapie für seelische „Fehler“ möglich. Hierbei wird sich das „korrigierte“ Individuum jedoch nie als perfekt normales Individuum bezeichnen, sondern eher als einen Normalen, der einen Fehler korrigiert hat.
Zum Zweiten kann eine Person mit einem Stigma zu solc her Art Lebenseinstellung kommen, daß sie das Stigma als Entschuldigung vor sich selbst und vor anderen für Mißerfolge, die es erleidet, verantwortlich macht. Hierbei wird das Stigma als notwendiges Übel für das Leben des Stigmatisierten, da er alles auf sein Stigma abschieben kann und somit keine soziale Ver- antwortung übernehmen muß und sich von jeglichem Wettbewerb ausschließen kann.
Zum Dritten besteht die Möglichkeit, daß ein Individuum ein Leben lang gemischt soziale Situationen, also Gegebenheiten, in denen auch Normale, bzw. fremde Normale, anwesend sind, meidet. Es sind dies meist diskreditierte Personen, die ein leicht oder immer sichtbares „Makel“ haben, das sie persönlich für äußerst schlimm erachten.
Neben den bereits erwähnten Möglichkeiten und der unter Gliederungspunkt 3 ( „Artgenossen und Weise“), erwähnten Professionalisierung innerhalb des Stigmas, gibt es noch eine Letzte, nämlich die, in der das Individuum zu der Überzeugung kommt, das Stigma als Glück im Unglück zu betrachten. Dies kann dann der Fall sein, wenn das Individuum meint, es hätte durch seinen Fehler weit mehr über sich selbst und andere und über den Umgang mit anderen gelernt, als wenn sie das Stigma nie gehabt hätte.
Es existiert somit eine Vielzahl vieler verschiedener Möglichkeiten für stigmatisierte Individuen über den Umgang mit ihren Unzulänglichkeiten, des Stigma-Managements und damit auch ihrer Identitätsbildung, wobei die volle Akzeptanz ihrer persönlichen und sozialen Identität vor sich selbst und anderen wohl als die Wünschenswerteste betrachtet werden kann.
5. Identitätsambivalenz und Kodizies
Der oder die Sigmatisierte teilt seine/ihre Mit-Stigmatisierten, je nach Evidenz des Stigmas, in Schichten ein. So kann eine stigmatisierte Person einem Mit-Stigmatisierten gegenüber, dessen Stigma offensichtlicher als ihr eigenes ist, jene Verhaltensweisen an den Tag legen, die sonst die Normalen gegenüber den Stigmatisierten einnehmen. So betrachten sich Schwerhörige z.B. für alles andere als für taub ( vgl. ebd., S. 134 ).
In diesem Zusammenhang kann auch eine sogenannte Identitätsambivalenz beobachtet werden. Das stigmatisierte Individuum, welches ein stärker stigmatisiertes Individuum beobachtet, wie es seine stigmatisierenden Attribute unfreiwillig offenbart, kann sich einer- seits davon abgestoßen fühlen, da es sich selbst einer niedrigeren stigmatisierten Schicht zuschreibt, andererseits wird es sich aufgrund seiner psychologischen und sozialen Lage mit ihm verbunden fühlen. Das Resultat daraus sind Identifikationsschwankungen, da sich das Individuum nie ganz für eine Gruppe entscheiden kann. Es fühlt sich zu beiden hingezogen, ohne sich dabei mit einer richtig identifizieren zu können.
Ein anderer Faktor für Identitätsambivalenz ist dieser, daß sich das stigmatisierte Individuum nicht großartig anders definiert als die Normalen, es gleichzeitig aber von den Normalen als anders betrachtet wird. Diese Tatsache läßt den/die Stigmatisierte/n nach einem Ausweg suchen. So übernimmt er/sie Richtlinien, sogenannte Kodizies, von Mit-Stigmatisierten, die eine Unmenge von Verhaltensempfehlungen gegenüber den Normalen beinhalten.
Diese Ratschläge und Verhaltensempfehlungen, die nicht seine/ihre eigenen sind, bilden quasi seine/ihre Grundlage menschlichens Seins. Inhalte dieser Kodizies sind meist von solcher Art, daß sie den Normalen als ein nicht besser wissendes menschliches Wesen darstellen, das es nicht gelernt hat mit Stigmatisierten umzugehen ( vgl. ebd., S. 145 ). Somit soll die ohnehin schon „bestrafte“ stigmatisierte Person genug Mitgefühl und Einfühlungsvermögen besitzen, um den Normalen den Umgang mit den Nicht-Normalen so einfach wie nur möglich zu gestalten.
Andere wesentliche Inhalte der Kodizies sind die der Warnung vor vollständiger Täuschung, der Minstrelisation und der Normifizierung. Minstrelisation soll bedeuten, daß der Stigmatisierte bewußt die Rolle des Stigmatisierten spielt, die von den Normalen erwartet wird, und genau davor wird gewarnt. Im Gegenteil dazu wird die stigmatisierte Person auch davor gewarnt, sich vollständig zu kuvrieren, bzw. Widerwillen gegenüber Seinesgleichen zu zeigen, die sich fast nahezu vollständig kuvrieren.
6. Zusammenfassung
Zusammenfassend kann man also sagen, daß es ausreichende Gemeinsamkeiten stigmatisierter Individuen hinsichtlich ihrer sozialen und privaten Situation gibt, um eine gemein- same Klassifizierung ihrer vorzunehmen.
Zum Abschluß dieser Hausarbeit möchte ich noch kurz bemerken, das jeder Normale irgend- einen kleinen „Fehler“ besitzt, der in bestimmten sozialen Situationen offenbart werden kann und somit seine soziale Identität in Frage stellen wird. Daher trägt jeder Mensch die Rolle des Normalen und die des Stigmatisierten in sich. Der Normale und der Stigmatisierte sind also nicht Personen an sich, sondern vielmehr Perspektiven, sie sind außerdem Teile voneinander. Wenn eine Person diskreditiert werden kann, dann muß es mindestens einen Zweiten geben, der die Rolle des Diskreditierens übernimmt.
Stigma-Management ist somit ein normaler und überall vorfindbarer Prozeß in der Gesellschaft, da es immer und überall Identitätsnormen gibt.
Abschließend möchte ich noch einmal Goffman zitieren:
„Als Konklusion kann ich wiederholen, daß ein Stigma nicht so sehr eine Reihe konkreter Individuen umfaßt, die in zwei Haufen, die Stigmatisierten und die Normalen, aufgeteilt werden können, als vielmehr einen durchgehenden sozialen Zwei-Rollen-Prozeß, in dem jedes Individuum an beiden Rollen partizipiert, zumindest in einigen Zusammenhängen und in einigen Lebensphasen“ ( ebd., S.169-170 ).
Literaturliste:
Goffman, Erving:
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich mit den Phasen und Schritten, die stigmatisierte Personen durchlaufen, sowie mit den damit verbundenen Problemen und Bewältigungsstrategien. Sie basiert auf der Stigma-Theorie von Erving Goffman.
Was versteht Goffman unter dem Begriff "Stigma"?
Ursprünglich bezeichnete "Stigma" körperliche Zeichen, die auf einen moralischen Makel des Trägers hinweisen. Heute wird der Begriff breiter verwendet, um Eigenschaften oder Merkmale zu bezeichnen, die dazu führen, dass eine Person von der Gesellschaft als "nicht normal" betrachtet und diskriminiert wird.
Welche Formen von Stigmatas werden unterschieden?
Goffman unterscheidet im Wesentlichen drei Formen von Stigmatas: physische Deformationen, individuelle Charakterfehler und phylogenetische Stigmatas (vererbbare Eigenschaften wie Rasse, Nation, Religion).
Was sind "Artgenossen" und "Weise" im Kontext der Stigma-Theorie?
"Artgenossen" sind Personen, die das gleiche Stigma teilen und somit eine besondere Beziehung zum stigmatisierten Individuum haben. "Weise" sind "Normale", die aus irgendeinem Grund Mitgefühl für den Stigmatisierten empfinden. Sie können beruflich bedingt oder durch enge persönliche Beziehungen (z.B. Ehepartner, Kinder) mit Stigmatisierten verbunden sein.
Welche Identitätstypen unterscheidet Goffman?
Goffman unterscheidet drei relevante Identitätstypen für das stigmatisierte Individuum: persönliche Identität (basierend auf eindeutigen Merkmalen wie Foto, Unterschrift), soziale Identität (Verhalten entsprechend der sozialen Kategorie) und Ich-Identität (subjektives Empfinden der eigenen Situation).
Was bedeutet "Täuschen" im Kontext des Stigma-Managements?
"Täuschen" bezieht sich auf den Versuch stigmatisierter Personen, ihr Stigma zu verbergen und sich als "normal" darzustellen, um soziale Akzeptanz zu finden. Dies kann jedoch zu einem Doppelleben, Angst und Identitätsschwankungen führen.
Was ist "Abschwächung eines Stigmatas" (Kuvrierung)?
"Abschwächung" oder "Kuvrierung" bedeutet, das Stigma so zu reduzieren oder zu modifizieren, dass es den Umgang mit dem Stigmatisierten erleichtert, ohne es zu verstecken. Es geht darum, die Spannung zwischen "Normalen" und "Nicht-Normalen" zu verringern.
Was ist die "Schlussphase der Stigmabewältigung"?
In dieser Phase akzeptiert das Individuum sein Stigma und zeigt es offen, ohne es zu verheimlichen. Es akzeptiert seine persönliche und soziale Identität ohne Vorbehalte.
Welche weiteren Methoden des Stigma-Managements gibt es?
Weitere Methoden sind die Korrektur des Fehlers (z.B. durch Schönheitsoperationen oder Therapie), die Nutzung des Stigmas als Entschuldigung für Misserfolge, die Vermeidung gemischt-sozialer Situationen, die Professionalisierung innerhalb des Stigmas und die Akzeptanz des Stigmas als eine positive Lernerfahrung.
Was sind "Identitätsambivalenz" und "Kodizies"?
"Identitätsambivalenz" beschreibt die Schwierigkeit stigmatisierter Personen, sich eindeutig einer Gruppe (Stigmatisierte oder Normale) zuzuordnen. "Kodizies" sind Richtlinien und Verhaltensempfehlungen, die von Mit-Stigmatisierten übernommen werden, um den Umgang mit "Normalen" zu erleichtern.
Was ist die Kernaussage der Hausarbeit zum Thema Stigma?
Die Hausarbeit kommt zu dem Schluss, dass jeder Mensch sowohl die Rolle des "Normalen" als auch die des "Stigmatisierten" in sich trägt. Stigma-Management ist ein normaler und allgegenwärtiger Prozess in der Gesellschaft, da es immer Identitätsnormen gibt. Goffman betont, dass Stigma nicht so sehr eine Aufteilung in zwei Haufen (Stigmatisierte und Normale) ist, sondern ein kontinuierlicher sozialer Prozess, an dem jedes Individuum teilnimmt.
- Quote paper
- Boris Hillig (Author), 2001, Stigmabewältigung und Identitätsbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105235