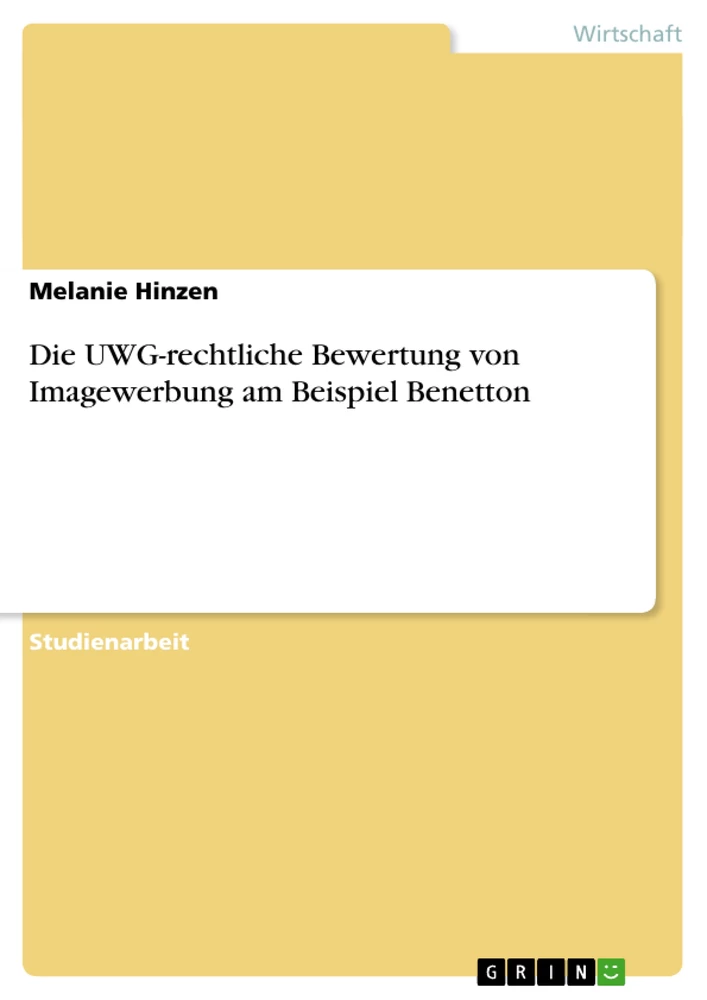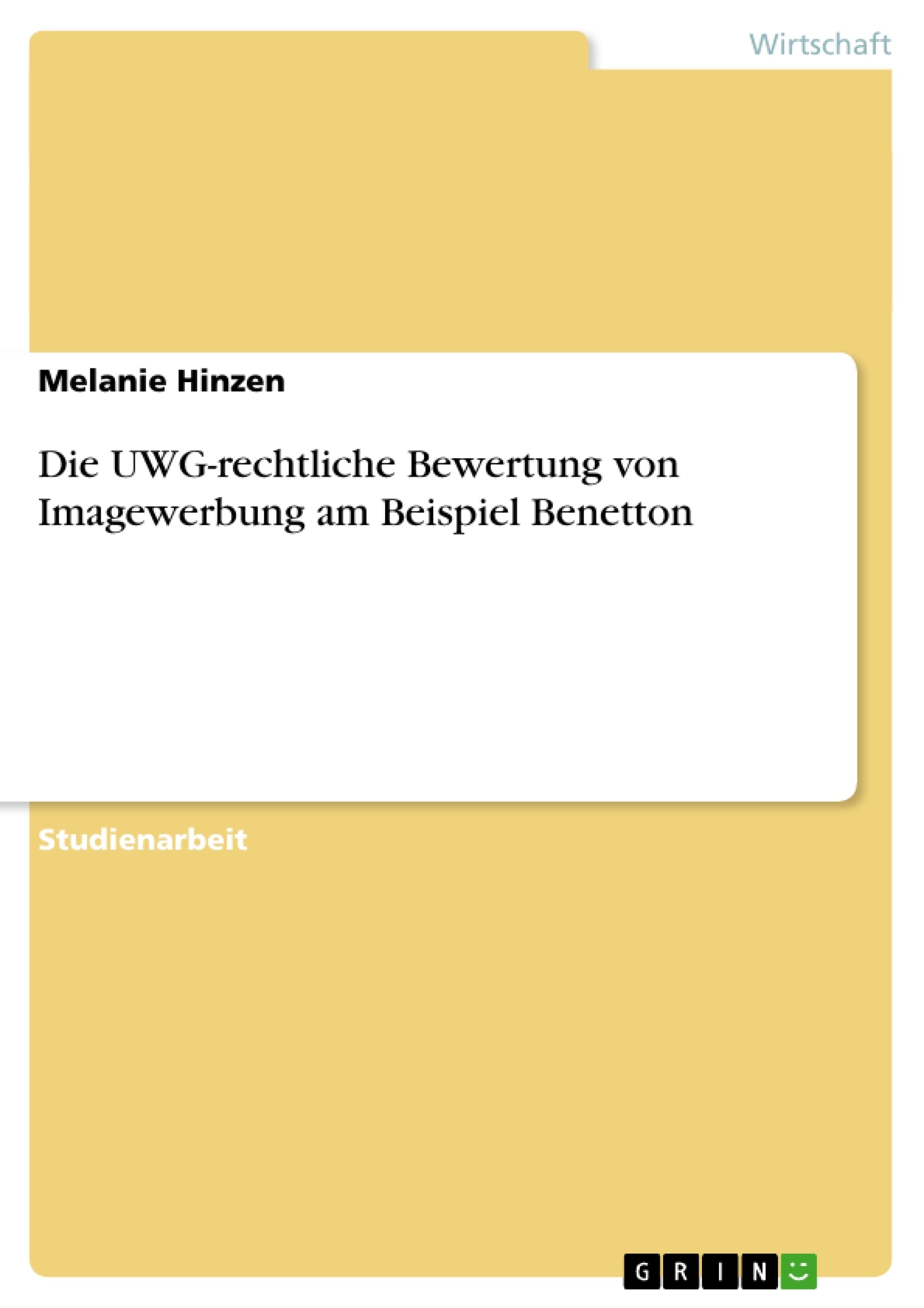Was darf Werbung? Diese Frage brennt angesichts der immer schrilleren und provokanteren Kampagnen, mit denen Unternehmen um die Aufmerksamkeit der Konsumenten buhlen. Im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht ein Name, der wie kein anderer für Kontroversen steht: Benetton. Die vorliegende Analyse beleuchtet die juristischen und ethischen Aspekte der berühmt-berüchtigten "Schockwerbung" des Modekonzerns, die in den 1990er Jahren mit Bildern von Aidskranken, Kriegsopfern und Umweltkatastrophen die Gemüter erhitzte. Dabei wird der Frage nachgegangen, inwieweit Unternehmen das Recht haben, mit Tabubrüchen und der Zurschaustellung von Leid ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Die Untersuchung präsentiert eine umfassende Aufarbeitung der Rechtsstreitigkeiten, die bis vor das Bundesverfassungsgericht geführt wurden, und analysiert die Argumentationslinien von Befürwortern und Kritikern der "Schockwerbung". Im Fokus stehen die Grenzen der Meinungsfreiheit im Spannungsfeld mit dem Wettbewerbsrecht und den "guten Sitten". Es wird erörtert, ob und wann eine solche Werbestrategie als sittenwidrig und damit unzulässig einzustufen ist. Neben der juristischen Bewertung werden auch die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen der Benetton-Kampagne beleuchtet und die Frage aufgeworfen, ob sich "Schockwerbung" langfristig als Marketinginstrument eignet oder eher kontraproduktive Auswirkungen hat. Abschließend wird ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Werbelandschaft gegeben und die Bedeutung ethischer Grundsätze für eine verantwortungsvolle Unternehmenskommunikation hervorgehoben. Diese tiefgreifende Analyse bietet somit nicht nur einen Einblick in die spektakuläre Geschichte der Benetton-Werbung, sondern wirft auch grundlegende Fragen nach der Rolle und Verantwortung von Unternehmen in einer globalisierten Welt auf. Tauchen Sie ein in die Welt der provokativen Werbung, lernen Sie die Hintergründe der rechtlichen Auseinandersetzungen kennen und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung über die Grenzen des guten Geschmacks und die ethische Verantwortung in der Werbung. Eine spannende Lektüre für alle, die sich für Marketing, Recht, Ethik und die gesellschaftliche Wirkung von Werbung interessieren. Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen von Schockwerbung auf die Markenbildung und die öffentliche Wahrnehmung. Sie untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für provokative Werbung und die Rolle des Deutschen Werberats. Weiterhin werden die Konzepte UWG, Meinungsfreiheit, Ethik und Marketingstrategien untersucht.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Abstract
2 Grundlagen
2.1 Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
2.1.1 Charakter des UWG
2.1.2 Inanspruchnahme
2.2 Der Begriff der Imagewerbung
2.3 Das UnternehmenBenetton
3 Gefühlsbetonung in der Werbung
3.1 Rechtliche Aspekte des Werbekonzepts Gefühlsbetonung
3.2 "Schockwerbung"
3.2.1 Geschichte des "Schocks"
3.2.2 Moderne "Schockwerbung"
4 Benettonund seine "Schockwerbung"
4.1 Gerichtsurteile und Argumentationslinien
4.1.1 Urteil des BGH vom 6. Juli
4.1.2 Urteil des BVerfG vom 12. Dezember
4.2 Betriebswirtschaftliche und rechtliche Folgen
5 Kommentar
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Abstract
Der ModekonzernBenettonmachte vor einigen Jahren durch eine besonders provokante Werbekampagne auf sich aufmerksam. Strittig waren mehrere Bilder, die Situationen besonderen Elends und Leids zeigten: blutverschmierte Kleidungsstücke eines getöteten Soldaten, einen Aidstoten im Kreise seiner Familie, eine auf einem Ölteppich schwimmende Ente oder ein mit einem "H.I.V. Positive"Stempel versehenes menschliches Gesäß.
Diese Photos erregten großes Aufsehen und führten zu Beschwerden beim Deutschen Werberat. Jahrelange Prozesse führten letztlich im Dezember 2000 dazu, daß das Bundesverfassungsgericht das einige Jahre zuvor ergangene Verbot des Bundesgerichtshofes wieder aufhob.
Warum waren sich die Gerichte in der Bewertung dieser Werbekampagne so uneinig? Warum hatBenettondiese Form der Aufmerksamkeitswerbung anderen Werbekonzepten vorgezogen, obwohl offensichtlich gewesen sein muß, daß eine solche "Schockwerbung" eine nicht nur positive Reaktion der Öffentlichkeit provozieren würde? Inwieweit ist eine solche Imagewerbung überhaupt zulässig? Wann ist oder wird sie wettbewerbswidrig? Und nicht zuletzt: Ist das Recht zur freien Meinungsäußerung nicht über jeglichen Zweifel erhaben?
Diesen und vielen weiteren Fragen versucht die vorliegende Arbeit u.a. mit Hilfe eines Einblicks in die Geschichte des "Schocks" sowie mit Hilfe vorliegender Gerichtsurteile gerecht zu werden.
2 Grundlagen
Um Imagewerbung vor dem Hintergrund des UWG transparent machen zu können, soll hier zuvor das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) in seinen Grundzügen dargestellt werden. Ebenso soll eine Definition des Begriffs 'Imagewerbung' zum besseren Verständnis beitragen.
2.1 Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
Um freien Wettbewerb gewährleisten zu können, bedient sich das deutsche Recht neben dem Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen in erster Linie des Rechts gegen unlauteren Wettbewerb. Dieses findet seine Niederschrift in Form des UWG. Nachdem sich das 1896 in Kraft getretene erste Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb als ungeeignet erwiesen hatte, wurde es im Jahre 1909 durch das zweite Gesetz, das auch heute noch die gesetzliche Grundlage bildet, ersetzt. Erstmalig steht an seiner Spitze die berühmte Generalklausel.
"Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes Handlungen, vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden."
2.1.1 Charakter des UWG
Die große Generalklausel stellt die Grundlage des gesamten UWG dar. Was sind nun jedoch die "guten Sitten" im Wettbewerb? Da das "Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden Menschen" jedoch ebenfalls ein kaum konkretisierbarer Maßstab ist, liegt die Interpretation des o.g. § 1 UWG in weiten Teilen in den Händen des Richters. Daher wird in diesem Zusammenhang oftmals auch von einem sog. Richterrechtgesprochen.
Der Wahrheit als wichtigstem Anspruch auch der Werbung ist in § 3 UWG Rechnung getragen. Irreführende Angaben sind unlauter und somit zu unterlassen. Zuwiderhandlung führt zur Unterlassungsklage.
2.1.2 Inanspruchnahme
Das UWG kann nicht von Privatpersonen gerichtlich geltend gemacht werden. Eine Prozeßierung ist nur durch Mitwettbewerber oder aber durch Verbände, wie z.B. durch den Deutschen Werberat im FalleBenettongeschehen, möglich.
2.2 Der Begriff der Imagewerbung
Was zeichnet nun jedoch Imagewerbung im Vergleich zu "klassischen" Werbebotschaften aus? Werbung ist immer eine beabsichtigte Beeinflussung von Einstellungen und Verhaltensweisen potentieller Kunden. Dies geschieht unter Einsatz von Werbemitteln, wie z.B. Prospekte, Plakate oder durch bezahlte Medien (Rundfunk, TV etc.). Als Ziele müssen ökonomische (Umsatz, Gewinn, Marktanteil) und außerökonomische Ziele unterschieden werden. Im Zusammenhang mit Imagewerbung sind insbesondere außerökonomische Ziele relevant. Aufmerksamkeit, Produktwissen, Kaufabsicht und Einstellung sind nur einige davon.
Im Gegensatz zu Produktwerbung, bei der die Eigenschaften des Produktes im Vordergrund stehen, oder zu Preiswerbung besitzt Imagewerbung einen ganz eigenen Charakter: Das beworbene Produkt profitiert vom Zusammenhang, in dem es gezeigt wird. Als Beispiele mögen hier folgende dienen: die Zahnpasta vom Zahnarzt empfohlen, der Müsliriegel angepriesen von einem bekannten Sportler und aus Irland kommende Butter. Es ist erkennbar, daß Imagewerbung sich hauptsächlich emotionaler Reize bedient und eher wenig Informationen über das Produkt gibt. Imagewerbung ist daher immer auch emotionale Werbung.
2.3 Das Unternehmen Benetton
Benettonist ein italienisches Familienunternehmen und zugleich ein Markenname. Der Konzern stellt Strickoberbekleidung für Erwachsene und Kinder her und vertreibt diese weltweit über selbständige Einzelhändler. Die Geschäftsbeziehungen sind denen des Franchising ähnlich; rechtlich betrachtet liegt jedoch kein Franchisevertrag vor.
3 Gefühlsbetonung in der Werbung
Im Zeitalter der Reizüberflutung ist es das oberste Ziel der Werbestrategen, die Aufmerksamkeit des Betrachters zu gewinnen. Emotionale Werbung bietet die ideale Grundlage, um an die Bedürfnisse des potentiellen Kunden zu appellieren. Nicht so sehr die Informationen über das Produkt sind Werbeträger, sondern es wird vielmehr der emotionale Kontext, in dem das Produkt (scheinbar) steht, beworben. Es wird an emotionale Reize wie Freiheit und Abenteuer, Erfolg, Erotik oder Natur und Gesundheit appelliert.
3.1 Rechtliche Aspekte des Werbekonzepts Gefühlsbetonung
Juristisch betrachtet stellt sich das Konzept der Gefühlsbetonung in der Werbung jedoch nicht selten als Stolperstein heraus.
Es gilt festzuhalten, daß Werbung, die an Gefühle wie Mitleid, Hilfsbereitschaft oder Trauer appelliert, immer dann als wettbewerbswidrig anzusehen ist, wenn sie irreführend ist (s. § 3 UWG).
Wie sieht es jedoch aus, wenn die Werbebotschaft grundsätzlich wahr ist? Ist sie auch dann wettbewerbswidrig? Sie ist es dann, wenn sie die Gefühle des Betrachters ausnutzt, um eine Kaufentscheidung unsachlich zu beeinflussen. Hier wiederum stellt sich die Frage, wann denn eine unsachgemäße Beeinflussung überhaupt stattfindet.
Die Praxis unterscheidet zwei unterschiedliche Formen der Beeinflussung. Sie spricht von einer Beeinflussung mit Sachzusammenhang bzw. einer ohne Sachzusammenhang.
- Besteht zwischen dem beworbenen Produkt und der eigentlichen Werbungkein inhaltlicher Zusammenhang, dann wird der potentielle Kunde unsachlich beeinflußt - und die Werbung ist somit wettbewerbswidrig - wenn die Werbung eigennützigundplanmäßigerfolgt.
Als Beispiele mögen hier folgende Situationen dienen: Ein Kaufmann handelt dann wettbewerbswidrig, wenn er zur Steigerung seines Ansehens den Kunden verspricht, alle Einnahmen eines bestimmten Tages an seine Mitarbeiter zu verteilen. Die Widmung von Schokolade für je eine bestimmte Tierart als Mittel zur Absatzsteigerung ist ebenso wettbewerbswidrig. Eine unsachliche Beeinflussung liegt in beiden Fällen vor, da planmäßig auf kommerzielle Interessen gezielt wird.
Anders hingegen verhält es sich, wenn unauffällig in einer Fußnote darauf hingewiesen wird, daß der Kauf eines bestimmten Produkts zur Arbeitsplatzschaffung ("...schafft Arbeitsplätze bei uns.") beiträgt.
- U.U. ist ein vorhandener Sachzusammenhang in der Lage eine gefühlsbetonte Werbung zu rechtfertigen. So ist es bei entsprechenden Postkarten Usus, darauf hinzuweisen, daß sie von körperbehinderten Personen hergestellt bzw. gemalt sind.
Anders verhält sich dies jedoch, wenn Versehrte systematisch in das Absatzsystem eines Verkäufers eingebunden werden, wenn also z.B. sprachbehinderte Menschen sich beim Abschluß eines Zeitschriftenabos an der Haustür lediglich durch eine Schrifttafel o.ä. verständlich machen können. Hier sagt der Gesetzgeber, daß die Blindheit oder Behinderung als Mittel zum Zweck - sprich zur Verkaufssteigerung - benutzt werde; dies ist wettbewerbswidrig.
Die Werbung karitativer und gemeinnütziger Organisationen - im Gegensatz zu eigennützigen, kommerziell orientierten - unterliegt anderen Bewertungskriterien. Irreführende Formen der Werbeaktivitäten sind jedoch auch von §§ 1, 3 UWG betroffen.
3.2 "Schockwerbung"
Bei der "Schockwerbung" handelt es sich um eine besondere Ausprägung der Imagewerbung. Die Werbung ruft beim Betrachter Gefühle wie Ablehnung, Entsetzen oder Mitleid hervor. Ein Gefühl des Sich-Solidarisierens mit dem werbenden Unternehmen ist die Folge. Ziel des Werbers ist ein erhöhter Bekanntheitsgrad und damit letztlich eine Umsatzsteigerung, ohne jedoch tatsächlich Informationen über das beworbene Produkt zu transportieren.
Das juristische Dilemma bei der sog. "Schockwerbung" liegt - wie auch im Falle Benetton- in der Abwägung zwischen zwei unterschiedlichen Aspekten. Einerseits ist die Frage nach den "guten Sitten" im Wettbewerb zu beantworten (§ 1 UWG) , andererseits stellt sich die Frage, ob und inwieweit Art. 5 I GG (Meinungs- und Pressefreiheit) eingeschränkt werden darf. Es gilt, eine Abgrenzung zwischen der Freiheit der Meinungsäußerung und den Grenzen der Wettbewerbsfreiheit zu schaffen. Diese Problemstellung wird in Kapitel 4 am BeispielBenettonverdeutlicht.
3.2.1 Geschichte des "Schocks"
Toscani, der Photograph der umstrittenenBenetton-Kampagne, hatte nicht lediglich die Absicht, die Welt mit ihrem Unheil zu konfrontieren. Vielmehr ging es ihm - einen Impuls der modernen Kunst aufgreifend - darum, das Publikum zu provozieren und es zur Veränderung der "kranken" Welt aufzufordern. Mit seinen Photos will er nicht beschwichtigen, er prangert Mißstände an und drängt den Betrachter zum Engagement für bessere Lebensverhältnisse.
Toscanis damit politische Äußerung ist nicht neu. Den radikalen Bruch mit Bestehendem sah bereits Maximilien Robespierre, ein Schüler Rousseaus, als Mittel zur Veränderung an. Seine Vorstellung, einen idealen Staat schaffen zu können, indem er mündige Bürger dem Kollektivwillen des Staates unterwerfe, setzte er während der Französischen Revolution mit Hilfe der Guillotine um.
Auch Saloth Sar, bekannter unter seinem Kampfnamen Pol Pot, und seine Roten Khmer brachten vor wenigen Jahren vermutlich mehr als zwei Millionen Kambodschaner um. Saloth Sar hatte als Student einer Pariser Universität eine Vorlesung über Volkswirtschaften in Entwicklungsländern gehört. Er teilte die Ansicht des Dozenten, die Kolonialmächte seien nur durch die Zerstörung ihrer eigenen Sozialstrukturen und durch die Liquidierung einheimischer intellektueller Eliten zu vertreiben.
3.2.2 Moderne "Schockwerbung"
Freilich politisch weniger weitreichende Folgen hat die moderne "Schockwerbung". Sicherlich ist der "Schockeffekt" einkalkuliert, ja geradezu beabsichtigt. Doch weniger als politisch-gesellschaftliche Meinungsäußerung stehen kommerzielle Interessen im Vordergrund. Markanteile, Umsatzrenditen und Gewinne sind die Kennzahlen, an denen sich die Werbestrategen messen lassen müssen. Im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft ist dies auch erforderlich, denn letztlich regeln die Gesetze des Marktes die Ökonomie automatisch. Auf einem (idealen) Markt gleichen sich Angebot und Nachfrage selbsttätig aus.
Betrachtet man die Entwicklung der Mediengestaltung und Werbung der vergangenen Jahre, so läßt sich mit Fug und Recht behaupten, daß der Werbemanager sich schon "einiges einfallen lassen muß", um zu provozieren und Aufmerksamkeit zu erregen. Diese Aufmerksamkeit ist es, die ein Unternehmen bekannt macht und sich schließlich in Umsatzzahlen niederschlägt. Dies gilt - wenn auch nicht unbedingt in der gewünschten Form - ebenso für das UnternehmenBenettonund seine umstrittene Werbekampagne.
4 Benettonund seine "Schockwerbung"
Zu Beginn der 1990er Jahre startete der italienische Werbestratege und Photograph Oliviero Toscani eine Werbekampagne fürBenetton. Seine provozierenden Bilder von sterbenden Aidskranken, blutverschmierten Kleidern erschossener Soldaten und anderen aufwühlenden Szenen haben die Öffentlichkeit in vielen Ländern Europas schockiert. Einige Plakate, wie z.B. das eines menschlichen Gesäß, gestempelt mit dem Schriftzug "H.I.V. Positive", führten zu Klagen u.a. des Zentralverbands der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW).
4.1 Gerichtsurteile und Argumentationslinien
Benetton warb Anfang der 90er Jahre mit Photos auf Plakaten und in der IllustriertenStern, die in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregten. Die von der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs beklagten drei Bilder zeigten eine ölverschmutzte Ente, schwerarbeitende Kinder der Dritten Welt beim Hausbau sowie das o.g. Motiv des menschlichen Gesäß mit dem Stempel "H.I.V. Positive". Im Folgenden wird sowohl das Urteil einschließlich Begründung des Bundesgerichtshofs von 1995 und das auf die Verfassungsbeschwerde folgende Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2000 dargestellt.
4.1.1 Urteil des BGH vom 6. Juli 1995
Der BGH ist zu folgendem Urteil gelangt:
Die Werbung eines Unternehmens, welches mit der Darstellung schweren Leids der Kreatur auf sich aufmerksam macht, verstößt gegen die guten Sitten im Wettbewerb, weil sie das Gefühl des Mitleids des Verbrauchers anspricht, das werbende Unternehmen als gleichermaßen betroffen darstellt und damit eine Solidarisierung der Einstellung solchermaßen berührter Verbraucher mit dem Namen und zugleich mit der Geschäftstätigkeit dieses Unternehmens herbeiführt.
Er begründet dies folgendermaßen. Bei der beanstandeten Werbung handele es sich um eine sog. Aufmerksamkeitswerbung, die keine Produkt- oder Leistungsmerkmale darstelle. § 1 UWG bliebe grundsätzlich von einer solchen Werbegestaltung unbetroffen. Der Produktbezug stehe der Sittenwidrigkeit nicht zwingend entgegen. § 1 UWG sei natürlich auch auf Maßnahmen, die den Bekanntheitsgrad eines Unternehmens beträfen, anwendbar. Entgegen der vorherigen Instanz (LG) befand der BGH, daß nicht schon in bloßer Ermangelung eines Zusammenhangs eine Sittenwidrigkeit vorläge. Unabhängig von der Geschmacklosigkeit, die der BGH der Werbung anlastet, die aber keine Rolle spielt, sei die Plakatwerbung dennoch gem. § 1 UWG unzulässig, da sie "mit dem allgemeinen Anstandsgefühl, mit Pietät und Takt" nicht mehr zu vereinbaren sei. Der Betrachter empfinde mit den gezeigten Kreaturen Mitleid und fühle sich in seiner Ohnmacht hilflos. Die Gefühle der Solidarisierung des Betrachters mit dem werbenden Unternehmen nutzeBenettonzugunsten seiner kommerziellen Interessen aus. Wer also Gefühle des Mitleids und der Solidarisierung ohne sachlich begründete Veranlassung nutze, um selbst Profit daraus zu schlagen, handele im Wettbewerb sittenwidrig.
Grundsätzlich sei die Darstellung derartigen Unheils zwar gestattet, als Werkzeug zu Zwecken der Umsatzsteigerung jedoch nicht tolerierbar. Eine solche Art der Werbung entspräche weder dem Sinn und Zweck des Leistungswettbewerbs, noch sei sie mit Art. § 5 I GG zu rechtfertigen.
Entgegen der Ansicht des LG kam der BGH zu der Auffassung, daß Werbung als Meinungsäußerung nicht isoliert von Art. 5 I GG zu betrachten sei. § 1 UWG sei vielmehr im Sinne des Art. 5 I GG auszulegen.
Im FallBenetton soll die Meinungsäußerung jedoch nicht vorrangig zur Auseinandersetzung mit politischen oder gesellschaftlichen Themen beitragen sondern lediglich der Steigerung des Ansehens des Unternehmens dienen.
Die o.g. Argumente gelten laut BGH sowohl für das Plakat "Ölverschmutzte Ente" als auch für das Plakat "Kinderarbeit". Das Urteil bzgl. des dritten strittigen Photos "H.I.V. Positive" weist noch einen weiteren, besonderen Aspekt auf. Neben dem Vorwurf der Sittenwidrigkeit der Imagewerbung, weil Gefühle des Mitleids und des Schreckens zu Zwecken des Kommerz ausgenutzt würden, befindet der BGH, daß Benettonmit dem gestempelten Gesäß zudem die Würde eines H.I.V.-infizierten Menschen mißachte. Die Mißachtung liege darin begründet, daß ein Aidskranker "als "abgestempelt" und somit aus der menschlichen Gesellschaft ausgegrenzt" dargestellt wird. (Anmerkung des Autors: Es ist jedoch zu beachten, daß aidskrank bzw. H.I.V. positiv zu sein nicht dasselbe ist.)
4.1.2 Urteil des BVerfG vom 12. Dezember 2000
Mehr als fünf Jahre nach dem Verbot der Werbekampagne hob das BVerfG nach einer Verfassungsbeschwerde das Urteil des BGH auf. Im Dezember 2000 wurde die Kampagne des ModekonzernsBenetton vom Vorwurf der Sittenwidrigkeit freigesprochen. Die Werbung war somit zulässig.
Kläger in dem Verfahren war der Verlag Gruner + Jahr, Herausgeber der IllustriertenStern. Diese hatte alle drei strittigen Photos abgedruckt. Das BVerfG hatte zu entscheiden, inwieweit die Kampagne nun sittenwidrig und daher nach § 1 UWG unzulässig war und ob sie womöglich durch Art. 5 I GG Meinungs- und Pressefreiheit geschützt war.
Auch im Urteil des BVerfG muß zwischen den zwei Photos "Ölverschmutzter Vogel" und "Kinderarbeit" einerseits und "H.I.V. Positive" unterschieden werden.
Das Gericht argumentiert, ebenso wie in vorangegangenen Entscheidungen, daß auch Werbung dem Schutz der Meinungsfreiheit nach Art. 5 I GG unterstehe, wenn sie wertenden, meinungsbildenden Inhalt hat. Daß diese Meinungsäußerung im Zusammenhang mit einer Werbeaussage stehe, sei kein Widerspruch, denn schließlich ließe die Tatsache, daß es sich um Werbung handele, den Betrachter nicht an der Ernsthaftigkeit der Botschaft zweifeln. Sodann stehen Art. 5 I GG und §
1 UWG gewissermaßen in Wechselwirkung zueinander. Bei der Frage nach den "guten Sitten" im Wettbewerb, sei die Tragweite des Artikel 5 der Verfassung zu beachten.
Grundsätzlich könnten laut BGH Grundrechte wie das der freien Meinungsäußerung nur dann eingeschränkt werden, wenn Gemeinwohlbelange oder das Recht und Interesse schutzwürdiger Dritter betroffen wäre. Dritte jedoch seien hier nicht in ihren Interessen eingeschränkt. Derartige Imagewerbung, weitgehend ohne Produktbezug, sei inzwischen verbreitet und üblich;Benettonsei nicht das erste Unternehmen, das sich dieser Werbegestaltung bedient hätte, wenn auch das erste, das derart provokant und aggressiv geworben hätte.
Daß der Photograph Toscani hier nicht mit angenehmen Bildern und positiven Assoziationen gearbeitet sondern Leid dargestellt hat, stehe der Zulässigkeit keinesfalls im Wege. Der Betrachter habe - zu Ungunsten des Art. 5 I GG - kein Anrecht auf die Darstellung einer perfekten Welt. Das BVerfG formuliert dies so:
"Ein vom Elend der Welt unbeschwertes Gemüt des Bürgers ist kein Belang, zu dessen Schutz der Staat Grundrechtspositionen einschränken darf."
Auch gehe von der Werbung keine Gefahr der zunehmenden Verrohung und Abstumpfung oder Nachahmungsgefahr aus; der Meinungsfreiheit nach Art. 5 I GG sei somit in diesem Falle der Vorrang vor § 1 UWG zu geben.
Ebenso hat das Verfassungsgericht im Falle des "H.I.V. Positive"-Bildes zugunsten des Klägers, des Verlags Gruner + Jahr entschieden. Die zuvor genannten Argumente für die beiden anderen Photos treffen ebenso auf dieses Bild zu. Der BGH hatte jedoch noch bemängelt, daß das Photo die Würde des Menschen verletze. Zu Hilfe war ihm da die Anzeige eines H.I.V.-Infizierten Mannes aus Frankreich gekommen; er hatte sein von der Krankheit gezeichnetes Gesicht abbilden lassen. Darunter standen die Worte "pendant l'agonie, la vente continue" (während des Todeskampfes, der Verkauf geht weiter). Das BVerfG war anderer Ansicht. Es konterte, daß man das Bild durchaus anders verstehen könnte. Dem Bild sei nicht zweifelsfrei zu entnehmen, daß die Deutung des BGH ("abgestempelt", ausgegrenzt) richtig sei. Mindestens ebenso wahrscheinlich, wenn nicht sogar naheliegender, sei die "Deutung, daß auf einen kritikwürdigen Zustand - die Ausgrenzung H.I.V.-Infizierter - in anklagender Tendenz hingewiesen werden solle." Hier läge somit keine Verletzung der Menschenwürde nach Art. 1 I GG vor.
Das BVerfG hat jedoch die Grenzen der "Schockwerbung" markiert. Ekelerregende, furchteinflößende und jugendgefährdende Bilder seien nicht von Art. 5 I GG gedeckt; das Recht auf Meinungsfreiheit wird hier eingeschränkt. Derartige Bilder seien unzulässig.
Auch wenn die Menschenwürde verletzt würde, wenn also Personen oder Minderheiten eindeutig auf die ein oder andere Weise herabgesetzt und diffamiert würden, sei die Werbung unzulässig.
4.2 Betriebswirtschaftliche und rechtliche Folgen
Was bedeutet diese Urteil nun betriebswirtschaftlich fürBenettonund für andere Unternehmen?
Es ist zweifelhaft bis unwahrscheinlich, daß sich die vonBenettonpraktizierte Art der "Schockwerbung" weiter verbreitet. Die Kampagne hatte bereits zu Beginn zu enormen Umsatzeinbußen derBenetton-Händler geführt. Ein Verfahren zwischen Benettonund den Vertriebsmittlern war aufgrunddessen am Landgericht anhängig gewesen. Der KonzernBenetton, der für die Werbekampagne verantwortlich war, konnte jedoch nicht auf Schadensersatz verklagt werden (BGH, Urt. v. 23.7.1997).
Es hat sich gezeigt, daß die Öffentlichkeitswirkung solcher Werbung nur von kurzer Dauer ist bzw. war, auch hat es kaum Nachahmer gegeben, was darauf schließen läßt, daß es sich bei dieser Art der Werbung eher um ein Auslaufmodell handelt.
5 Kommentar
"Die Hälfte unserer Ausgaben für Werbung ist zum Fenster 'rausgeschmissen. Ein Königreich für den, der mir sagt,welcheHälfte!" Vor diesem Ausspruch eines berühmten Werbestrategen war die KampagneBenettonssicher ein Mißerfolg. Werbung will schlußendlich immer zur Umsatzsteigerung beitragen. Erhebliche Umsatzeinbußen waren im FallBenetton jedoch die Folge. Die Gefahr der Nachahmung scheint somit nicht gegeben. AuchBenetton selbst hat seine Werbeauftritte fortan anders gestaltet und bedient sich nunmehr "positiver" Bilder, die Jugendlichkeit, Frische, Dynamik und Freude kommunizieren.
§ 1 UWG charakterisiert wettbewerbliche Handlungen, die gegen "die guten Sitten" verstoßen als wettbewerbswidrig und unzulässig. Was aber sind die "guten Sitten" (im Wettbewerb)? Das Anstandsgefühl "aller billig und gerecht denkenden Menschen"? Wer entscheidet darüber, ob jemand in diese Kategorie Menschen fällt oder nicht? Letztendlich scheint eine Bewertung doch immer eine höchstpersönliche Ansicht zu sein. Nicht ohne Grund ist im Zusammenhang mit dem UWG häufig vom sog. "Richterrecht" die Rede.
Der Vorwurf,Benettonwürde das Leid von Menschen und das anderer Kreaturen für kommerzielle Zwecke nutzen, ist durchaus zutreffend. Die Intention von Werbung ist immer kommerzieller Natur. Wer aber sagt, daß Werbung nur Wunschbilder und keine Bilder des Schreckens präsentieren darf? Niemand hat das Anrecht vom Unheil der Welt verschont zu werden. Krieg, Terror, Krankheit und Tod sind allgegenwärtig und dürfen nicht tabuisiert werden. Der Mensch muß sich mit dem - vielfach durch ihn selbst produzierten - Leid auseinandersetzen.
Bezeichnend ist die Reaktion eines aidskranken Franzosen, der sich durch das Photo "H.I.V. Positive" angegriffen gefühlt hatte. Seine Reaktion in Form einer Anzeige, die sein von der Krankheit gezeichnetes Gesicht mit der Bildunterschrift "während des Todeskampfes, der Verkauf geht weiter" zeigte, ist ein deutliches Warnsignal. Hier fühlt sich ein Mensch, der tatsächlich betroffen ist, seiner Würde beraubt. Mag dies auch ein Einzelfall gewesen sein, so muß hier doch eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Werbeaussage seitens des werbenden Unternehmens stattfinden.
Eine Gesellschaft, die sich für die soziale Marktwirtschaft und den damit verbundenen freien Wettbewerb entschieden hat, ist gezwungen sich zu überlegen, inwiefern sie diese Freiheit einschränken darf, ohne dabei unglaubwürdig zu erscheinen. Die Gesetze des Marktes gelten auch für den Werbemarkt. Hat eine Werbekampagne nicht den gewünschten Erfolg, so wird sie ohnehin bald von der Bildfläche verschwunden sein. Es liegt in der Fülle der Werbebotschaften, denen der Verbraucher ausgesetzt ist, begründet, daß nur die Werbung wahrgenommen wird, die auffällig ist. Auffällig ist etwas dann, wenn esandersist.Anderszu sein hat leider viel zu oft zur Folge auch zugleich als furchterregend und abstoßend wahrgenommen zu werden.
Literaturverzeichnis
Wettbewerbswidrige Unternehmenswerbung der Firma Benetton - Ölverschmutzte Ente; erschienen in: NJW 1995, Heft 38, S. 2488 ff
Förderung sittenwidriger Image-Werbung durch Presseunternehmen - Kinderarbeit; erschienen in NJW 1995, Heft 38, S. 2490 ff
Wettbewerbswidrige Unternehmenswerbung der Firma Benetton - "HIVPositive"; erschienen in: NJW 1995, Heft 38, S. 2492 f
Keine Haftung gegenüber Händlern für Umsatzrückgang wegen schockierender Werbung - Benetton I; erschienen in: NJW 1997, Heft 49, S. 3304-3309
Keine Haftung gegenüber Händlern für Umsatzrückgang wegen schockierender Werbung - Benetton II; erschienen in: NJW 1997, Heft 49, S. 3309-3311
Benetton-Schockwerbung verfassungsrechtlich zulässig; erschienen in: NJW 2001, Heft 8, S. 591-594
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht; 21., neubearbeitete Auflage, Rdnr. 84, 185-188, Verlag C. H. Beck, München
Zulässigkeit und Grenzen der Imagewerbung - das Beispiel "Benetton"
von Dr. Henning Hartwig, RA, München; erschienen in: Betriebs-Berater (BB), 54. Jg., Heft 35, 2.9.1999, S. 1775-1778
Zum Verbot der Schockwerbung - "Benetton": BVerfG mit Anmerkung von Helmuth Schulze-Fielitz; erschienen in: Juristen Zeitung, 56. Jahrgang, Heft 6, 16. März 2001, S. 261-312
Schutz der Meinungsfreiheit auch für Schockwerbung ("Benetton") von Michael Volmer, Notarassesor in Würzburg; erschienen in: ZIP, 22. Jg., Heft 1, 5. Januar 2001, S. 45 f
Das Ende der Schocktherapie - Die Legalisierung der Benetton-Werbung markiert den Niedergang der künstlerischen Provokation, Uwe Wittstock; erschienen in: Die WELT vom 6. Januar 2001
GG - Grundgesetz, Textausgabe mit ausführlichem Sachverzeichnis und einer Einführung von Universitätsprofessor Dr. Günter Düring; 33., neubearbeitete Auflage, Stand: 1. Juni 1996, Beck Texte im dtv, München
WettbR - WettbewerbsR, KartellR/MarkenR, Textausgabe mit ausführlichem Sachverzeichnis und einer Einführung von Prof. Dr. iur. Dr. h. c. Wolfgang Hefermehl; 22., neubearbeitete Auflage, Stand: 15. September 2000, Beck Texte im dtv, München
Verfassungsbeschwerden gegen Verbot der "Schockwerbung" erfolgreich,
Pressestelle des BVerfG, Pressemitteilung Nr. 156/2000 vom 12. Dezember 2000,
URL: http://www.bunderverfassungsgericht.de...en/frames/bvg156-00?Highlight= Benetton, 17. Mai 2001
Kein Schadensersatz für Benetton-Händler wegen "Schockwerbung",
Pressemitteilung des BGH Nr. 54/1997 vom 23. Juli 1997, URL: http://www.jura.uni- sb.de/Entscheidungen/pressem97/BGH/zivil/benetton.html, 17. Mai 2001
Wie viele Schocks verkraftet die Welt? Zur Interpretation der Benetton- Werbung durch das Bundesverfassungsgericht von Goedert Palm, URL: http://www.telepolis.de/deutsch/special/auf/4479/1.html, 16. September 2001
Hintern darf für Strickpullis abgestempelt werden, taz Nr. 6321 vom
13.12.2000, Seite 15, Christian Rath, URL: http://www.taz.de/tpl/2000/12/1113.nf/t extdruck?Tname=a0124&list=TAZ_txt&idx=104, 16. September 2001
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die ein Inhaltsverzeichnis, Ziele, Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt das Thema Imagewerbung im Kontext des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), insbesondere am Beispiel der "Schockwerbung" des Unternehmens Benetton.
Was sind die zentralen Themen des Dokuments?
Die zentralen Themen sind das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), der Begriff der Imagewerbung, die Rolle der Gefühlsbetonung in der Werbung, insbesondere "Schockwerbung", und die Analyse der Benetton-Werbekampagnen im Lichte von Gerichtsurteilen und rechtlichen Folgen. Es wird auch die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Wettbewerbsfreiheit diskutiert.
Welche Gerichtsurteile werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 6. Juli 1995 und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 12. Dezember 2000 im Zusammenhang mit der Benetton-Werbung.
Welche Argumentationslinien der Gerichte werden dargestellt?
Es werden die Argumentationslinien des BGH dargestellt, der die Benetton-Werbung als sittenwidrig einstufte, da sie das Mitleid des Verbrauchers ausnutzte, um kommerzielle Interessen zu verfolgen. Weiterhin werden die Argumente des BVerfG erörtert, das das Urteil des BGH aufhob und die Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 I GG) in den Vordergrund stellte.
Welche betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Folgen werden diskutiert?
Es werden die betriebswirtschaftlichen Folgen der Benetton-Werbekampagne, wie z.B. Umsatzrückgänge, sowie die rechtlichen Folgen, insbesondere das Scheitern von Schadensersatzansprüchen gegen Benetton, diskutiert. Es wird auch die Frage behandelt, ob sich die von Benetton praktizierte Art der "Schockwerbung" weiter verbreitet hat.
Was ist das Fazit des Autors?
Der Autor kommt zu dem Schluss, dass die Benetton-Kampagne trotz des Urteils des BVerfG als Misserfolg zu werten ist, da sie zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt hat. Es wird betont, dass Werbung letztendlich zur Umsatzsteigerung beitragen soll. Die "Schockwerbung" von Benetton hat sich nicht durchgesetzt, und das Unternehmen selbst bedient sich nunmehr anderer, "positiver" Bilder.
Welche Gesetze werden behandelt?
Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG), der die Meinungsfreiheit garantiert, werden behandelt.
Wer ist Oliviero Toscani?
Oliviero Toscani war der Fotograf der umstrittenen Benetton-Werbekampagne.
- Arbeit zitieren
- Melanie Hinzen (Autor:in), 2001, Die UWG-rechtliche Bewertung von Imagewerbung am Beispiel Benetton, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104989