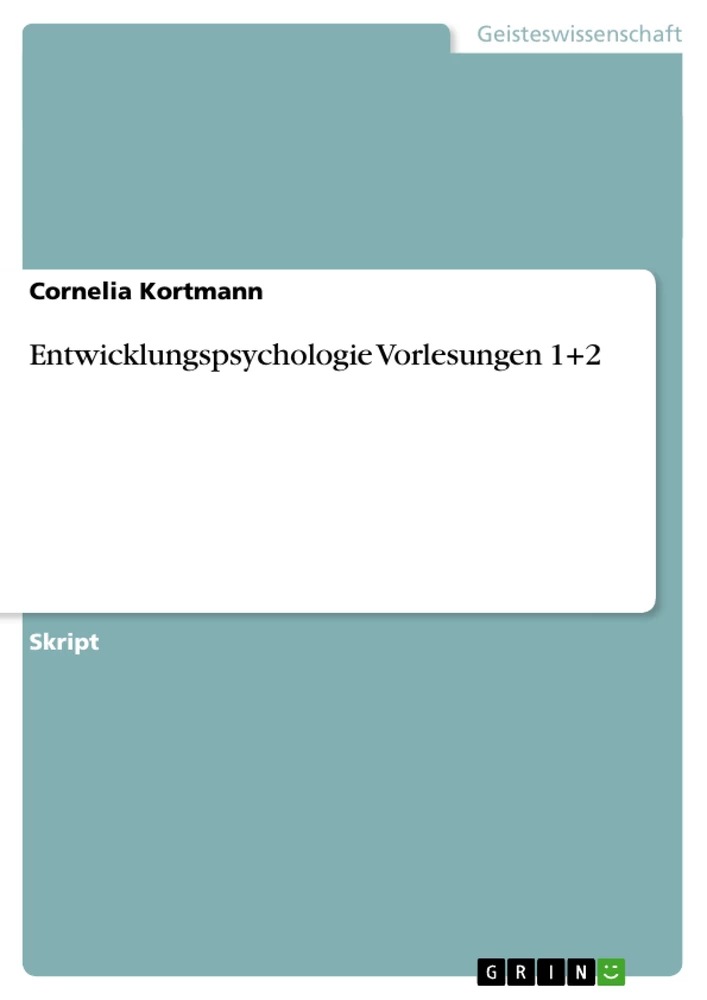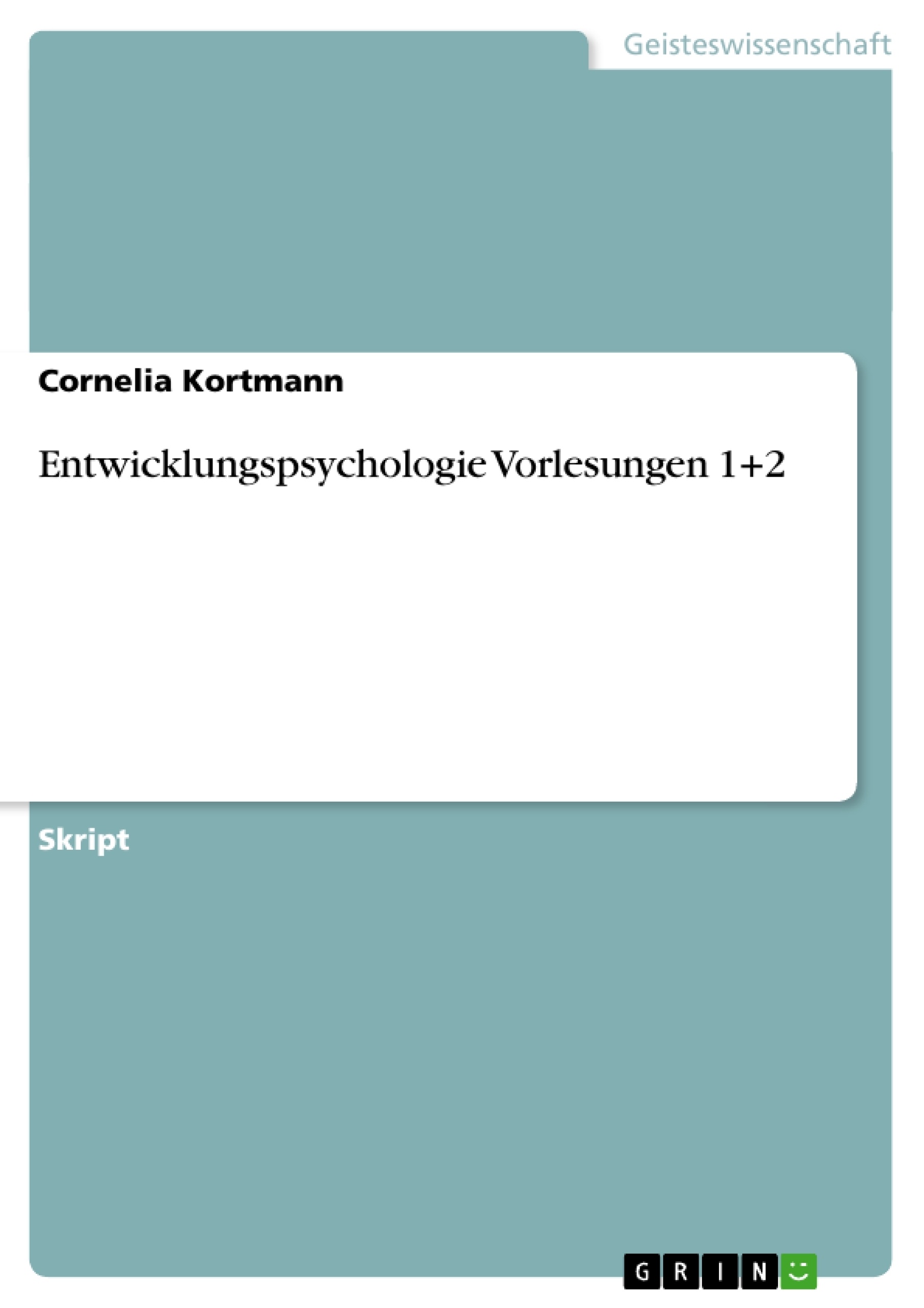Was formt uns? Ist es das Schicksal, die Gene oder doch die Summe unserer Erfahrungen, die uns zu dem Menschen machen, der wir sind? Dieses Buch ist eine fesselnde Reise durch die faszinierende Welt der Entwicklungspsychologie, die versucht, genau diese fundamentalen Fragen zu beantworten. Es beginnt mit einem Blick auf die historische Entwicklung des Fachs, von den philosophischen Wurzeln bei Locke und Rousseau bis zu den modernen Forschungsmethoden. Dabei werden die formalen Merkmale des Entwicklungsbegriffs erläutert und von anderen psychologischen Disziplinen abgegrenzt, immer unter Berücksichtigung des Lebensalters als zentralem Bezugspunkt. Ein besonderer Fokus liegt auf den vielfältigen Entwicklungsmechanismen, von Wachstum und Reifung über Lernen und Prägung bis hin zur Sozialisation. Der Leser erfährt, wie biologische Grundlagen wie Evolution, Genetik und die Entwicklung im Mutterleib unser Verhalten prägen und welche Rolle die Umwelt dabei spielt. Das Buch beleuchtet die Entwicklung einzelner Funktionsbereiche wie Wahrnehmung, Emotionen und Motivation, wobei insbesondere die Bindungstheorie und die Entwicklung von Neugier und Leistungsmotivation ausführlich behandelt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kognitiven Entwicklung nach Piaget sowie der Sprachentwicklung und Gedächtnisbildung. Die soziale Entwicklung wird ebenso detailliert untersucht, von den Beziehungen zu Gleichaltrigen über aggressives Verhalten bis hin zu prosozialem Verhalten und moralischem Urteilen. Abschließend werden ausgewählte Probleme einer Altersstufensystematik diskutiert, insbesondere die Entwicklung im Jugend- und Alter, wobei die gegenwärtigen Trends der Entwicklungspsychologie, wie das große Interesse an der Erklärung der Entwicklung und den Mechanismen und Bedingungen der Entwicklung, die Durchsetzung der Lebensspannenorientierung und die interdisziplinäre Ausrichtung, berücksichtigt werden. Dieses Buch bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Forschung, sondern regt auch zum Nachdenken über die eigene Entwicklung und die komplexen Einflüsse an, die uns zu dem machen, was wir sind. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für Studierende der Psychologie, Pädagogik und verwandter Disziplinen, aber auch für alle, die sich für die Geheimnisse der menschlichen Entwicklung interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt der Entwicklungspsychologie und entdecken Sie die erstaunlichen Kräfte, die unser Leben formen! Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Geschichte und die aktuellen Perspektiven des Fachs, wobei die wissenschaftliche Verwendung des Entwicklungsbegriffs und die Rolle des Lebensalters in der Entwicklungspsychologie ausführlich erläutert werden.
Inhalt
1 Abschnitt: Geschichte, Gegenstand und Perspektiven der Entwicklungspsychologie
1.1 Gegenstandsbestimmung der Entwicklungspsychologie
1.1.1 Formale Merkmale des Entwicklungsbegriffs
1.1.2 Abgrenzung zu anderen Teildisziplinen der Psychologie: Das Lebensalter
1.2 Die wissenschaftliche Verwendung des Entwicklungsbegriffs
1.2.1 Präformistische und epigenetische Entwicklungskonzeptionen
1.3 Geschichte der Entwicklungspsychologie
1.3.1 Vorläufer und Anfänge: Locke; Rousseau; Darwin; Preyer; Kindertagebücher
1.3.2 Entwicklungspsychologie in den USA
1.3.2.1 Child-Guidance-Bewegung
1.3.2.2 Child-Welfare-Bewegung
1.3.2.3 Längsschnittstudien
1.3.2.4 Behaviorismus
1.3.2.5 Arnold Gesell
1.3.2.6 Havighurst
1.3.2.7 Gegenwärtige Trends der Entwicklungspsychologie:
1.4 Die Rolle des Lebensalters in der Entwicklungspsychologie
1.5 Grundfragen der Entwicklungspsychologie
1.5.1 Was verändert sich? (Inhalt)- Entwicklungsvariablen
1.5.2 Wie verändert sich die Entwicklungsvariable? Wie lassen sich die Veränderungen beschreiben? ➝Verlauf
1.5.3 Wodurch kommen Veränderungen zustande? - Steuerung der Entwicklung
1.6 Zusätzliches aus der Prüfungsliteratur
2 Abschnitt: Entwicklungsmechanismen
2.1 Wachsen und Reifen
2.1.1 Phänomene
2.1.1.1 Wachstum
2.1.1.1.1 Begriff
2.1.1.1.2 Längenwachstum als Modell psychischen Wachstums: Probleme der Beschreibung, Darstellung und Erklärung
2.1.1.2 Reifung
2.1.1.2.1 Begriff
2.1.1.2.2 Reifungsvorgänge (Beispiele)
2.1.1.2.2.1 Ossifikation
2.1.1.2.2.2 Muskelbildung und willkürliche Kontraktion
2.1.1.2.2.3 Myelinisierung
2.1.1.2.2.4 Koordination und Integration von Hirnarealen
2.1.1.2.2.5 Dendritensprossung
2.1.1.2.2.6 Synapsenbildung
2.1.1.2.3 Entwicklung der Fortbewegung als Modell psychischer Reifung: Probleme der Beschreibung und die Bedeutung der Übung
2.1.1.3 Weiteres aus der Prüfungsliteratur
2.1.1.3.1 Differenzierung
2.1.1.3.2 Lernen➝siehe dort 2.2
2.1.1.3.3 Prägung
2.1.1.3.4 Sozialisation
2.1.2 Biologische Grundlagen der Entwicklung
2.1.2.1 Evolution und Phylogenese des Menschen
2.1.2.1.1 Mechanismen der Evolution
2.1.2.1.2 Genetik und Vererbung
2.1.2.1.2.1 Struktur der DANN
2.1.2.1.2.2 Proteinsynthese
2.1.2.1.2.3 Chromosomentheorie der Vererbung
2.1.2.1.2.4 Mitose
2.1.2.1.2.5 Meiose
2.1.2.1.2.6 Cross-Over und Rekombination
2.1.2.1.2.7 Die Mendelschen Gesetze
2.1.2.1.3 Erbgut und Umwelt
2.1.2.1.3.1 Schema der genetischen Wirkkette
2.1.2.1.3.2 Das Beispiel der Phenylketonurie
2.1.2.2 Evolution und Ontogenese: Biologische Grundlagen des Erfahrungserwerbs
2.1.2.3 Embryonal- und Fetalentwicklung
2.2 Lernen
2.2.1 Formen des Erfahrungserwerbs
2.2.2 Entwicklungsbedingte Veränderungen in den Mechanismen des Erfahrungserwerbs: Das Beispiel des plötzlichen Krippentodes
3 Abschnitt: Entwicklung einzelner Funktionsbereiche
3.1 Entwicklung der Wahrnehmung
3.1.1 Entwicklung der visuellen Wahrnehmung
3.1.1.1 Methoden zur Untersuchung der Wahrnehmungsentwicklung
3.1.1.1.1 Physiologische Methoden
3.1.1.1.1.1 Das Elektroretinogramm (ERG)
3.1.1.1.1.2 Visuell evozierte Potentiale (VEP)
3.1.1.1.1.3 Elektrookulographie (EOG)
3.1.1.1.2 Behaviorale oder psychologische Untersuchungsverfahren
3.1.1.1.2.1 Registrierung der Fixationsdauer (Cornea-Spiegelung)
3.1.1.1.2.2 Habituations-Dishabituations-Methode
3.1.1.1.2.3 Nachahmung einer ökologisch bedeutsamen Umweltsituation
3.1.1.1.2.4 conjugate reinforcement (high amplitude sucking)
3.1.1.1.2.5 Konditionierung
3.1.1.2 Physiologische Entwicklung des Wahrnehmungssystems
3.1.1.3 Entwicklung ausgewählter Wahrnehmungsleistungen
3.1.1.3.1 Sehschärfe
3.1.1.3.2 Kontrastsensitivität
3.1.1.3.3 Visuelles Verfolgen und Abtasten (visual scanning)
3.1.1.3.4 Farbwahrnehmung
3.1.1.3.4.1 Farbdifferenzierung
3.1.1.3.4.2 Kategoriale Wahrnehmung von Farben
3.1.1.3.5 Form- und Musterwahrnehmung
3.1.1.3.6 Räumliche Wahrnehmung
3.1.1.3.6.1 Visuelle Klippe
3.1.1.3.6.2 Querdisparation
3.1.1.3.6.3 Bewegungsmerkmale
3.1.1.3.7 Größenkonstanz
3.1.1.3.8 Weiteres aus der Prüfungsliteratur
3.2 Entwicklung von Emotionen
3.2.1 Emotion, Affekt, Gefühl: Begriffserklärung
3.2.1.1 Strukturelle Beschreibung von Emotionen: Reaktionstrias
3.2.1.1.1 Emotionaler Ausdruck
3.2.1.1.2 Subjektives Gefühlserleben
3.2.1.1.3 Periphere physiologische Reaktion
3.2.1.2 Funktionale Charakterisierung von Emotionen
3.2.1.2.1 Emotion als Anpassungsmechanismus: Entkoppelung von Reiz und Reaktion
3.2.1.2.2 Emotionale Reiz- und Situationsbewertung
3.2.1.2.2.1 Globale Situationsbewertung auf der Dimension "Gut - Schlecht" ®Plutchik
3.2.1.2.2.2 Koppelung zwischen spezifischen Reizkonfigurationen und spezifischen emotionalen Bewertungsmustern
3.2.1.2.2.3 Energiebereitstellung
3.2.1.2.3 Kommunikationsfunktion
3.2.2 Die Entwicklung von Emotionskomponenten
3.2.2.1 Entwicklung des emotionalen Ausdrucks
3.2.2.1.1 Universalität des emotionalen Ausdrucks
3.2.2.1.2 Ausdrucksmuster bei Neugeborenen und blind-taub geborenen Kindern.57
3.2.2.1.3 Darstellungsregeln (display rules) und die Entwicklung der Ausdruckskontrolle
3.2.2.2 Entwicklung von Gefühlen
3.2.2.2.1 Die Differenzierungstheorie von Bridge
3.2.2.2.2 Die kognitive-aktivationale Differenzierungstheorie von Sroufe
3.3 Entwicklung von Motivsystemen
3.3.1 Bindung
3.3.1.1 Die Entwicklung der affektiven Bindung an eine bestimmte Person
3.3.1.1.1 Fremdenangst und Trennungsangst als ubiquitäre Entwicklungsphänomene
3.3.1.1.2 Kritik an der Sekundär-Trieb-Konzeption durch die Untersuchungen Harry Harlows
3.3.1.1.3 Das Konstrukt der Bindung nach Bowlby und Ainsworth
3.3.1.1.3.1 Allgemeine Charakteristika von Verhaltenssystemen im Sinne der Ethologie (siehe Hand Out)
3.3.1.1.3.2 Spezifische Charakteristika des Bindungssystems (siehe Hand Out)
3.3.1.1.4 Die Entwicklung des Bindungssystems
3.3.1.1.5 Das Konstrukt des "inner working models"
3.3.1.1.6 Messung interindividueller Unterschiede in der Qualität der Bindung
3.3.1.1.7 Determinanten der Entwicklung interindividueller Unterschiede in der Bindungsqualität
3.3.1.1.8 Stabilität in der Qualität der Bindung
3.3.1.1.9 Qualität der Bindung zum Vater
3.3.1.1.10 Prädiktive Validität
3.3.1.1.10.1 Beziehung zur sozialen Entwicklung
3.3.1.1.10.2 Beziehung zur kognitiven Entwicklung
3.3.2 Neugier
3.3.2.1 Das Konstrukt Neugier
3.3.2.1.1 Neugier (curiosity) und Exploration (exploration): Begriffserklärung
3.3.2.1.2 Charakterisierende Merkmale des Neugiersystems
3.3.2.2 Die Entwicklung des Neugiersystems
3.3.2.2.1 Anzeichen neugiermotivierten Verhaltens bei Neugeborenen
3.3.2.2.2 Entwicklung der Exploration in der frühen Kindheit
3.3.2.3 Messung individueller Unterschiede in der Ausprägung des Neugiermotivs
3.3.2.3.1 Dimensionen individueller Unterschiede
3.3.2.3.2 Beobachtungsverfahren
3.3.2.3.3 Puppenspielverfahren
3.3.2.4 Determinanten in der Entwicklung individueller Unterschiede in der Ausprägung des Neugiermotivs
3.3.2.5 Zusammenhang mit anderen Entwicklungsvariablen
3.3.2.5.1 Neugier und Angst
3.3.2.5.2 Neugier und kognitive Entwicklung
3.3.3 Wirksamkeitsmotivation, Leistungsmotivation
3.3.3.1 Definition von Leistungsmotivation und ihre Messung
3.3.3.2 Die allgemeine Entwicklung des Leistungsmotivs
3.3.3.2.1 Wirksamkeitsmotiv und Kompetenzmotiv als Basismotivationen des Leistungsmotivs
3.3.3.2.1.1 Robert White: Wirksamkeitsmotivation und Kompetenzmotivation
3.3.3.2.1.2 John Mc v. Hunt: Intrinsic motivation
3.3.3.2.1.3 Leon und Marian Yarrow: Mastery motivation
3.3.3.2.2 Erstes Auftreten leistungsmotivierten Verhaltens
3.3.3.2.2.1 Allgemeine Entwicklungsvoraussetzungen (➝ siehe Hand Out)
3.3.3.2.2.2 Anfänge leistungsmotivierten Verhaltens im Wetteifer des Kleinkindes...78 3.3.3.2.2.3 Einfache Gütemaßstäbe und Selbstkonzept als Voraussetzung leistungsmotivierten Verhaltens
3.3.3.2.3 Stabilität des Leistungsmotivs
3.3.3.2.4 Altersbezogene Veränderungen in der Stärke des Leistungsmotivs (life- span-Perspektive)
3.3.3.2.5 Veränderung in der Struktur des Leistungsmotivs: Differenzierung von Fähigkeit und Anstrengung
3.3.3.3 Die Entwicklung individueller Unterschiede in der Stärke und Richtung des Leistungsmotivs
3.3.3.3.1 Die Rolle der Selbständigkeitserziehung (M. Winterbottom)
3.3.3.3.2 Ökologische Faktoren und Faktoren in der sozialen Interaktion als Bedingungen der Entwicklung individueller Unterschiede
4 Abschnitt: Die Entwicklung kognitiver Funktionen
4.1 Die kognitive Entwicklungspsychologie Jean Piagets
4.1.1 Person, Anliegen und Werk
4.1.2 Grundkonzepte der Theorie der kognitiven Entwicklung
4.1.3 Die Periode der sensomotorischen Entwicklung (0-2Jahre)
4.1.3.1 Die 6 Stadien der sensomotorischen Entwicklungsperiode
4.1.3.2 Die Entwicklung der Objektpermanenz
4.1.3.3 Die Entwicklung der Nachahmung
4.1.4 Die Periode des präoperationalen Denkens (2-7Jahre)
4.1.4.1 Stadium des symbolischen und vorbegrifflichen Denkens (2-4Jahre)
4.1.4.2 Stadium des anschaulichen Denkens (4-7Jahre)
4.1.5 Die Periode der konkreten Operationen (7-11/12Jahre)
4.1.6 Die Periode der formalen Operationen (ab ca. 12Jahren)
4.1.7 Das Stadienkonzept Piagets
4.1.8 Bewertung des Theoriesystems Piagets
4.2 Sprachentwicklung
4.2.1 Phänomene, die den allgemeinen Entwicklungsverlauf charakterisieren
4.2.1.1 Lautentwicklung: Lautproduktion - Lautwahrnehmung
4.2.1.2 Erste Wortbedeutungen (Holophrasen)
4.2.1.3 Entwicklungsphänomene zwischen 1;6 und 4 Jahren
4.2.1.3.1 Auftreten erster syntaktischer Regelhaftigkeiten mit 1;6 bis 2 Jahren
4.2.1.3.2 Phonetische Entwicklung
4.2.1.3.3 Wortschatzentwicklung
4.2.1.3.4 Entwicklung von Syntax und Grammatik
4.2.2 Erklärungsmodelle des Spracherwerbs
4.2.2.1 Die verschiedenen Dimensionen oder Komponenten der Sprache
4.2.2.2 Die behavioristische Erklärung des Spracherwerbs
4.2.2.3 Die Kritik von Noam Chomsky und der nativistische Ansatz: Sprachentwicklung als Entwicklung der Syntax und Grammatik
4.2.2.4 Der kognitive Ansatz in der Spracherwerbsforschung: Kognitive Voraussetzungen des Spracherwerbs
4.2.2.5 Der pragmalinguistische Ansatz: Kommunikation und Spracherwerb
4.2.3 .Die Rolle der Sprache der Mutter im Spracherwerbsprozeß
4.3 Gedächtnisentwicklung
4.3.1 Modelle der Funktion des Gedächtnisses
4.3.1.1 Mehrspeichermodelle
4.3.1.2 Inhaltsabhängige Gedächtnisformen
4.3.2 Gedächtnisentwicklung
4.3.2.1 Gedächtnisentwicklung zwischen 0 und 4 Jahren
4.3.2.1.1 Erste Gedächtnisspuren im Langzeitgedächtnis bei Säuglingen
4.3.2.1.2 Episodisches Gedächtnis bei jungen Säuglingen und erste Anzeichen strategischen Vorgehens
4.3.2.1.3 Autobiographisches Gedächtnis und erste Erinnerungen: Das Problem der frühkindlichen Amnesie
4.3.2.1.4 Gedächtnis zwischen 2 und 4 Jahren
4.3.2.2 Gedächtnisentwicklung zwischen 5 und 15 Jahren
4.3.2.2.1 Veränderungen in der Kapazität des Kurzzeitspeichers: Gedächtnisspanne...108
4.3.2.2.2 Entwicklung und Anwendung von Gedächtnisstrategien: Das Konzept des Metagedächtnisses
4.3.2.2.3 Die Bedeutung des Wissens für Gedächtnisleistungen
5 Abschnitt: Soziale Entwicklung
5.1 Entwicklung der Beziehung zu Gleichaltrigen (frühe Interaktionsformen, Gruppenstrukturen, Freundschaftsbeziehungen)
5.1.1 Entwicklung der Interaktion mit Gleichaltrigen
5.1.1.1 Entwicklung in den ersten beiden Lebensjahren
5.1.1.2 Entwicklung in der Vorschulzeit
5.1.1.2.1 Kontaktaufnahme und Strategien zur Kontaktaufnahme in Spielgruppen
5.1.1.2.2 Konflikt in Kindergartengruppen
5.1.2 Entwicklung von Gruppenstrukturen
5.1.3 Die Entwicklung von Freundschaftsbeziehungen
5.1.3.1 Inhaltsorientierte Forschungsansätze
5.1.3.2 Strukturelle Ansätze
5.2 Entwicklung von aggressivem Verhalten
5.2.1 Definitionsversuche
5.2.2 Ursprünge aggressiven oder agonistischen Verhaltens
5.2.3 Stabilität interindividueller Unterschiede im aggressiven Verhalten
5.2.4 Bedingungen der Entwicklung individueller Differenzen in der Ausprägung des Aggressionsmotivs
5.2.4.1 Erziehungsbedingungen
5.2.4.2 Der Beitrag des Individuums zur eigenen Aggressionsentwicklung
5.2.4.3 Die Rolle des Fernsehens
5.3 Prosoziales Verhalten - Altruismus - Moralisches Urteil
5.3.1 Prosoziales und altruistisches Verhalten
5.3.2 Moralisches Urteilen und Handeln
6 Ausgewählte Probleme einer Altersstufen-Systematik
6.1 Entwicklung im Jugendalter
6.2 Entwicklung im Alter
1 Abschnitt: Geschichte, Gegenstand und Perspektiven der Entwicklungspsychologie
1.1 Gegenstandsbestimmung der Entwicklungspsychologie
- Aufgrund der Vielfalt ➝schwierige Abgrenzung
- Wandel/Veränderungen im Verhalten und Erleben (insb. von Menschen), und zwar Veränderungen, die längerfristig wirksam sind (nicht Stimmungsveränderungen etc.)
- Gegenstand der Entwicklungspsychologie ist die mit dem Lebensalter einhergehende Veränderung im Erleben und Verhalten von Lebewesen (Menschen) und beinhaltet Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und Beeinflussung intraindividueller Veränderungen und die interindividuellen Unterschiede dieser Veränderungen während der Ontogenese.
1.1.1 Formale Merkmale des Entwicklungsbegriffs
- Umgangssprachlich➝mit Veränderung/Wandel assoziiertem Ausgangszustand über versch. Zwischenzustände zum Endzustand, mit einer Ordnung in der Abfolge der Zwischenzustände
1.1.2 Abgrenzung zu anderen Teildisziplinen der Psychologie: Das Lebensalter
- Die Abgrenzung ist in der Bezugnahme auf das Lebensalter zu sehen. Zunächst wurde das Zeitkontinuum auf die Kindheit und Jugend beschränkt. Später (in den 80gern) ging man dazu über die gesamte Lebensspanne zu betrachten.
1.2 Die wissenschaftliche Verwendung des Entwicklungsbegriffs
- Der Begriff der Entwicklung taucht in der wissenschaftlichen Literatur im 18.Jh auf. ➝Evolutio explikatio (ursprünglich "Entfalten einer Buchrolle", "Entfaltung des Eingefalteten") ➝beschreibt regelhafte Veränderungsreihen
1.2.1 Präformistische und epigenetische Entwicklungskonzeptionen
- Seit der Antike gibt 2 Konzepte der Entwicklung:
1. Präformationstheorie➝Endgestalt bereits im Keim festgelegt
2. Epigenetische Theorien➝Alles Lebendige hat eine spezifische Lebenskraft. Entwicklung bedeutet aufeinanderfolgende Neubildungen, deren Ausprägung durch die innewohnende Lebenskraft und durch externe Einflüsse bestimmt wird. Es gibt keinen festgelegten Plan der Entwicklung.
1.3 Geschichte der Entwicklungspsychologie
- Philosophen des Altertums➝ Platon/Aristoteles unterteilten den Lebenslauf bereits nach Altersstufen + Vor-/Nachteile der einzelnen Lebensphasen.
- Autobiographische Entwicklungsromane des Mittelalters➝Simplizissimus (Grimmelshausen), zeigen, daß dem Phänomen der seelischen Veränderung während des Lebenslaufs durchaus Beachtung geschenkt wurde.
- Jedoch weder in der Antike, noch im Mittelalter wurde der Entwicklungsgedanke differenziert herausgearbeitet.
- Philippe Aries 60/75 (frz. Historiker)➝versuchte zu belegen, daß bis ins Mittelalter Veränderungen während Kindheit/Jugend längst nicht so registriert wurden, wie es heute selbstverständlich ist. In seinem Buch "Die Geschichte der Kinderheit" macht er deutlich, daß die Kindheit, abgesehen von der Periode der biologischen Abhängigkeit des Kleinkindes, keine eigenständige Lebensperiode war. Er stützt dies auf künstlerische Darstellungen der Kinder aus dieser Zeit, die in ihren Proportionen den Erwachsenen glichen. Kinderarbeit war an der Tagesordnung. Oberflächliche Gefühlszuwendung, Übergangslosigkeit zum Erwachsenenalter, Vergewaltigung, Mord und Züchtigung waren üblich ➝ Mause 75
- Linda Pollock 83 ➝ Gegnerin Aries vertrat Gegenstandpunkt und stützte sich dabei auf Tagebuchstudien. Das könnte aber auch an der Betrachtung der höheren und gebildeten Schichten dieser Zeit gelegen haben.
- Allmähliche Ausbildung des Entwicklungsdenkens vor ca. 200 Jahren. Man begann den Entwicklungsbegriff auf materielle, biologische, historische und seelische Geschehensreihen anzuwenden.
1.3.1 Vorläufer und Anfänge: Locke; Rousseau; Darwin; Preyer; Kindertagebücher
- Namen und Daten zur Geschichte der Entwicklungspsychologie
- John Locke (1632-1704):
-Empirismus
-Seele des Neugeborenen ist eine "tabula rasa", eine leere Wachstafel.
-Lohn und Strafe sind entscheidende Entwicklungsmechanismen.
-Selbstdisziplin und Kontrolle sind wichtig
-Die einzigen Motive waren Lohn und Strafe, durch die sich ein moralischer Mensch entwickelt
- Jean Jacques Rousseau (1712-1778):
-Das Kind, der "edle Wilde", dem eine Entwicklungsordnung angeboren ist (Entwicklungsroman "Emile")
-(Präformistische Entwicklungskonzeption).??????
-Die Selbsttätigkeit des Kindes ist der entscheidende Entwicklungsmechanismus
-Angeborene Kenntnisse des Kindes für Gut und Böse
-Eingriffe der Erwachsenen sind nicht nötig
-Gesundes Wachstum ist garantiert
-Erziehung ist eher störend (Negative Pädagogik)
-Wissen ist ein von Kind und Welt errichtetes Gebäude
- Locke und Rousseau lenkten die Aufmerksamkeit auf die psychischen Entwicklungsphänomene
- Dietrich Tiedemann, Prof. F. Philosophie in Marburg:
1787 Erstes entwicklungspsychologisches Kindertagebuch an Sohn Friedrich
-beobachtete Kinder von Geburt an auf einem breitem Spektrum (Motorik, Sinnesleistungen,
Affekte, Sozialverhalten, Sprechen und Denken)
-es stellten sich die Fragen nach den Konsequenzen der Behandlung durch Erwachsene
-Erst im ausgehenden 19. Und Beginn d. 20 Jh.➝folgten andere dem Vorbild und legten ebenfalls umfangreiche Tagebücher an.
- Charles Darwin: Evolutionstheorie ➝Über den Ursprung der Arten 1859/Über die Abstammung des Menschen 1871
-Variation und Selektion entscheidende Mechanismen; Erbvariationen mit Anpassungsvorteil pflanzen sich mit größerer Wahrscheinlichkeit fort. Die geeigneten Erbvarianten werden ausgewählt und überleben.
-Kindertagebuch über den eigenen Sohn Francis (1877)
-Die enge Verknüpfung der Entstehung der wissenschaftlichen Entwicklungspsychologie mit der Biologie erklärt die langfristige Dominanz der biologisch vorprogrammierten Entfaltung vorgegebener Strukturen.
- Wilhelm Preyer, Jenaer Arzt und Prof. F. Physiologie:
- 1882"Die Seele des Kindes", Beschreibung der Entwicklung seines Sohnes, nach Entwicklungsbereichen gegliedert. Basierend auf Beobachtungen und kleinen Experimenten.
-Anregung weiterer Kindertagebücher, u.a. auch Piaget
- Mit Darwin und Preyer begann die wissenschaftlich, empirische Entwicklungspsychologie
- Ernst Häckel (1866):
-Biogenetisches Grundgesetz
-Die Ontogenese ist eine Rekapitulation (verkürzte Wiederholung) der Phylogenese
- Stanley Hall (1904):
-Psychogenetisches Grundgesetz
-Die Ontogenese stellt eine Rekapitulation der Kulturentwicklung der, wobei der gesetzmäßige Zusammenhang nicht klar ist. Man hat aber in Kinderzeichnungen Entwicklungen der darstellenden Kunst gefunden.
-Beginn der Datenerhebung
-Beginn theoretischer Erklärungsversuche,
-Einteilung der Entwicklung in Phasen
- Ellen Key (Schwedin, 1900)
-"Das Jahrhundert des Kindes"
-Heilpädagogische Orientierung: Psychologische Hilfe für behinderte und benachteiligte Kinder
-nicht akademisch wissenschaftlich, sondern aus sozialer Fürsorge
- A. Binet & Th. Simon (1905):
-Auftrag d. frz. Erziehungsministers, ein Verfahren zu entwickeln, das geistige Behinderungen erkennbar macht.
-Erstes standardisiertes Intelligenzmeßverfahren
-Grundlage: Wachstumsmodell von Entwicklung[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]kontinuierliches Wachsen,
-keine Aufteilung in Phasen
-Messung: Bewältigung altersspezifischer Aufgaben
-Sonderschulzuführungen ➝Später fraglich, weil nach kurzer Übungszeit die entsprechenden Anforderungen erworben werden (Rolle des Lernens/Übung)
- Charlotte Bühler & Hildegard Hetzer 1932
-Kleinkindertests zur Erfassung des Entwicklungsstandes
1.3.2 Entwicklungspsychologie in den USA
1.3.2.1 Child-Guidance-Bewegung
- Child-Guidance-Clinics: ➝ Healey 1909 Chicago
-praktische Erziehungsberatung für benachteiligte und verwahrloste Kinder und Jugendliche; Jugendkriminalität
-medizinisch orientiert;
-Einfluß der Psychoanalyse
-nach dem 1. Weltkrieg als Antwort auf Verwahrlosung
-nach dem 2. Weltkrieg auch in Deutschland Erziehungsberatungsstellen.
1.3.2.2 Child-Welfare-Bewegung
- Child-Welfare-Bewegung: ➝ Cora Hills (Farmersfrau mit 12 Kindern)
-wissenschaftliche Grundlagen der Erziehung bearbeiten;
-grundlagenorientierte Forschungsinstitute
-Unwissenheit ist die Ursache der hohen Säuglingssterblichkeit
-aufklärende Absicht
1.3.2.3 Längsschnittstudien
- Längsschnittstudien:
-Intelligenz- und Persönlichkeitsentwicklung
-körperliche Entwicklung
- Terman 20 ➝Entwicklung der Hochbegabten
- Bayley & Jones ➝Berkeley Growth Study
- Hauptziele ➝Für ein breites Spektrum körperlicher und psychischer Variablen Aufschluß über, die Stabilität/Instabilität von individuellen Entwicklungsverläufen bestimmen und die Vorhersage individueller Entwicklungsverläufe zu geben
1.3.2.4 Behaviorismus
- Behaviorismus:
-Stimulus-Reiz-Lernen[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]Reflexamöbe
-experimentelle Kinderpsychologie
-Entwicklungspsychologie ist eine überflüssige Disziplin
- Watson & Raynor 1920 ➝Experimentelle Konditionierungsversuche bei Kleinkindern
1.3.2.5 Arnold Gesell
- Arnold Gesell 50ger Jahre
-Beobachtung und Beschreibung von Entwicklungsphänomenen
-detaillierte Aufstellung von Entwicklungsnormen spezifischer Verhaltensbereiche für die Altersgruppen 0 bis 16 Jahre
1.3.2.6 Havighurst
- R.Havinghurst 53
- Developmental task[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]Entwicklungsaufgaben
-Sie treten in einer bestimmten Lebensperiode des Individuums auf und führen bei erfolgreicher Bewältigung zu Glück und Zufriedenheit (Happiness) und zu Erfolg bei nachfolgenden
Entwicklungsaufgaben.
-Ein Nichtbewältigen der Entwicklungsaufgabe führt zu Unzufriedenheit des Individuums, zur Ablehnung durch die Gesellschaft und zu Schwierigkeiten bei der Bewältigung späterer Entwicklungsaufgaben.
-Sachverhalte, durch die die Art der Anforderungen und ihr Timing determiniert werden:
- Biologische Veränderungen des Organismus
- Anforderungen von Kultur und Gesellschaft
- Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen des Individuums selbst.
- Entwicklungsaufgaben➝
- 0-2 Jahre➝
2Social Attachment
- Objektpermanenz
- Sensumotorische Intelligenz
- Schlichte Kausalität
- Motorische Funktionen
- 2-4 Jahre➝
- Selbstkontrolle (vor allem motorische)
- Sprachentwicklung
- Phantasie und Spiel
- Verfeinerung der motorischen Fähigkeiten
- 5-7 Jahre➝
- Geschlechtsrollenidentität
- Einfache moralische Unterscheidungen
- Konkrete Operationen
- Gruppenspiel
- 6-12 Jahre➝
- Soziale Kooperation
- Selbstbewußtsein
- Erwerb von Kulturtechniken/Schule (Lesen/Schreiben)
- Spiel und Arbeit im Team
- 13-17 Jahre ➝
- Körperliche Reifung/Geschlechtsreifung
- Formale Operationen
- Gemeinschaft mit Peers
- Heterosexuelle Beziehungen
- 18-22 Jahre ➝
- Autonomie von den Eltern
- Identität in der Geschlechtsrolle
- Internalisiertes moralisches Bewußtsein
- Berufswahl
- 23-30 Jahre ➝
- Heirat
- Geburt von Kindern
- Arbeit/Beruf
- Lebensstil finden
- 31-50 Jahre ➝
- Heim/Haushalt führen
- Kinder aufziehen
- Berufliche Karriere
- Mehr als 50 Jahre➝
- Energien auf neue Rollen lenken
- Akzeptieren des eigenen Lebens
- Haltung zum Sterben entwickeln.
1.3.2.7 Gegenwärtige Trends der Entwicklungspsychologie:
- Großes Interesse an:
- der Erklärung der Entwicklung
- den Mechanismen und Bedingungen der Entwicklung
- differenzierteren Einflußfaktoren vs. globalerer wie "Strenge der Eltern"
- Durchsetzung der Lebensspannenorientierung
- Spezialisierung der Themen
- Interdisziplinäre Ausrichtung
- Verhalten auch als unabhängige Variable
- Großer Einfluß der kognitiven Wissenschaften (Informationsverarbeitung)
- Neues Interesse für Längsschnittmethoden
- Berücksichtigung des ökologischen Kontextes
- Differentielle Entwicklungsverläufe
- Bevorzugung der Beobachtungsmethoden
- Historischer Wandel der Entwicklungsphänomene
1.4 Die Rolle des Lebensalters in der Entwicklungspsychologie
- Verhaltensveränderungen sind nur dann Gegenstand der Entwicklungspsychologie, wenn sie regelhaftig auf das Lebensalter bezogen werden können ➝ Kessel 60
- Dabei hat das Alter selbst keinen Einfluß, sondern die zu einem bestimmten Zeitpunkt eintretenden sozialen und Umwelteinflüsse und der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes.
- Vulnerable/Sensible Phasen ➝ans Lebensalter gebundene Phasen, in denen bestimmte Entwicklungsschritte erfolgen müssen, da sie zu einem späteren Zeitpunkt gar nicht oder nur unzureichend aufgeholt werden können.
Bsp.: Für die Entwicklung des Tiefensehens sind beidäugige Stimuli im 1. Lebensjahr erforderlich.
- Kritisch ist bei der Altersvariablen die Gefahr, daß man die interindividuellen Unterschiede in einer Altersgruppe vernachlässigt.
- Ein Vorteil besteht darin, daß man Altersnormen aufstellen kann (Gesell), die es möglich machen, Entwicklungsverzögerungen und -störungen frühzeitig zu entdecken und zu behandeln.
- Der Verzicht auf die Altersvariable ist in der Entwicklungspsychologie undenkbar.
- Die Einteilung der menschlichen Lebensspanne in Stufen/Phasen hat eine lange Tradition. Die Kriterien sind dabei recht unterschiedlich und nur auf bestimmte Entwicklungsbereiche beschränkt. Ein umfassendes detailliertes Konzept ist nicht möglich, höchstens eine grobe Einteilung:
- Pränatale Phase (die sich z.B. spezifischer aufspaltet in Blastozyste, Embryonalzeit, Fetalzeit, Perinatalzeit)
- Säuglingsphase
- Kindheit
- Adoleszens
- Jugend
- Erwachsenenalter
- Greisenalter
Dabei werden aufgrund der schnellen Entwicklung in der ersten Zeit Tage, Wochen und Monate als Altersabschnitte betrachtet. Im späteren Alter beschränkt man sich hingegen auf Jahresabstände oder noch längere Zeitspannen.
- Biologisches Alter ➝Zustand und Funktionstüchtigkeit des Organismus Psychologisches Alter ➝alterskorrelierte, psychologische Veränderungen Soziales Alter ➝Gesellschaftliche Altersabstufungen und Normen
Subjektives Alter ➝Einstellung des Individuums zu seinem eigenen Alter oder zu Alterungsprozessen allgemein.
- Es gibt zahlreiche auf das Lebensalter bezogene Entwicklungsreihen➝siehe auch Gesell
- Wahrnehmungsleistungen
- Denkleistungen
- Gedächtnisleistungen
- sprachliche/motorische Fertigkeiten
- Intelligenz usw.
- Die Frage nach der Altersabhängigkeit ist nur sinnvoll, wenn die Merkmalsstreuung zwischen den Altersgruppen größer ist als die Streuung innerhalb einer Altersgruppe
1.5 Grundfragen der Entwicklungspsychologie
- Inhalt, Verlauf und Steuerung der Entwicklung
1.5.1 Was verändert sich? (Inhalt)- Entwicklungsvariablen
- Wie sind die Variablen definiert, die auf Veränderung hin betrachtet werden?
- Welche Merkmale des Individuums werden unter dem Entwicklungsaspekt zum Beobachtungsgegenstand gemacht?
- Zunächst muß die Beobachtungsebene festgelegt werden, die Beobachtungseinheiten spezifiziert werden ➝z.B. spezifische Muskelkontraktion vs. globale Verhaltensklassen (Handlungssequenzen)
Dabei gibt es verschiedene Quantifizierungsmöglichkeiten:
- Auftretenshäufigkeit einer Reaktion
- Dauer/Latenz
- Intensität
- Situationsabhängigkeit (welche auslösenden Bedingungen)
- Dabei muß der Konstruktstatus der Entwicklungsvariablen berücksichtigt werden, denn häufig sind Verhaltensmaße nur Indikatoren für etwas anderes und dienen als
- Operationalisierung einer Entwicklungsvariablen (z.B. Fixationsdauer für die Aufmerksamkeit)
- Repräsentatives Maß für eine umfassende Verhaltensklasse (Saugverhalten als orales Verhalten als Maß des Aktivitätsniveaus)
- Indikatoren für eine gedachte, zugrundeliegende Variable (Lutschen als Verhaltensausdruck einer organischen Struktur oder eines sensumotorischen Assimilationsschemas)
Viele der hypothetischen Konstrukte werden mit Tests, Fragebögen, TAT erfaßt.
1.5.2 Wie verändert sich die Entwicklungsvariable? Wie lassen sich die Veränderungen beschreiben? ➝Verlauf
- Mit welchen Begriffen lassen sich die Veränderungen kennzeichnen?
- Qualitativ (Reifung?) oder Quantitativ (Wachstum?)?
- Kontinuierlich oder diskontinuierlich?
- Reversibel/Irreversibel?
- Auf ein Endziel gerichtet oder ungerichtet?
- Isoliert voneinander oder integriert?
- Nur Aufbau- oder auch Abbauprozesse?
- Welcher Art sind die Veränderungen?
- Beobachtet man die Veränderung ein und derselben Variablen?
- Gibt es eine regelhafte Abfolge der verschiedenen Variablen?
- Wie ist der Verlauf der Veränderungen?
- Linear ansteigend oder U-förmig?
1.5.3 Wodurch kommen Veränderungen zustande? - Steuerung der Entwicklung
- Welche Bedingungen und Wirkgrößen bringen sie hervor?
- Wie hängen die zeitlich aufeinanderfolgenden Veränderungen zusammen?
- Entwicklungsfaktoren
- Anlagebedingt?
- Umwelteinflüsse?
Viele zahlreiche Auseinandersetzungen und Kontroversen diesbezüglich, aber letztendlich sind immer beide Faktoren beteiligt. Des weiteren muß auch die Priorität und Bedeutung früherer Entwicklungseinflüsse berücksichtigt werden.
- Die Art der Beziehung der aufeinanderfolgenden Entwicklungsschritte kann verschiedener Art sein➝ Flavell 72:
- Addition ➝Das Hinzukommen eines späteren Verhaltensmerkmals zu einem früheren, ohne Aufgabe des Vorherigen
- Substitution ➝Frühere Verhaltensmerkmale werden mehr oder weniger durch Spätere ersetzt.
- Differenzierung ➝Der spätere Zustand beinhaltet den früheren, durch Konsolidierung, Generalisierung und Stabilisierung
- Mediation ➝Frühere Gegebenheiten fungieren als förderndes Zwischenglied für weitere Entwicklungsschritte.
- Inklusion ➝Früheres wird in späterem eingeschlossen und zu einer neuartigen Struktur integriert.
- Bedingungen von Entwicklungsveränderungen werden aufzudecken versucht durch:
- Experimentelle Manipulation von Entwicklung (Ethische Probleme)
- Untersuchung der Sozialisationsvariablen und ökologischen Bedingungen
- Die Bedingungen der interindividuellen Unterschiede im Entwicklungsverlauf (Entwicklungsgeschwindigkeit) und in der erreichten Funktionshöhe werden untersucht.
1.6 Zusätzliches aus der Prüfungsliteratur
- Definition des Entwicklungsbegriffs kann sehr eng oder aber weiter gefaßt sein.
- Eng➝ Richtungsverlauf der Entwicklung ist unidirektional Abfolge irreversibel
Unabhängig von externen Faktoren Qualitativ-strukturell
Relativ überdauernd
Mit dem Lebensalter in Beziehung stehend.
- Weit➝ Frei von obigen Festlegungen
Sämtliche ontogenetischen Veränderungen, die überdauernd sind Eine Ordnung oder inneren Zusammenhang aufweisen
Mit dem Lebensalter in mehr oder weniger enger Beziehung stehen
- Beobachtbar sind immer nur die Produkte des Entwicklungsprozesses. Dieser Prozeß ist aber erfaßbar durch Verringerung der zeitlichen Abstände zwischen den Beobachtungszeitpunkten.
- Die Entwickungspsychologie steht in enger Beziehung mit anderen Forschungsgebieten:
- Biologie/Genetik
- Entwicklungsphysiologie
- Ethologie
- Kulturanthropologie
- Soziologie
- Übrige psychologische Bereiche
- Die Entwickungspsychologie erarbeitet das Grundlagenwissen, die angewandte Entwicklungspsychologie hat 6 Aufgaben:
- Orientierung über den Lebenslauf
- Ermittlung von Entwicklungsbedingungen
- Prognose von Persönlichkeitsmerkmalen
- Begründung von Entwicklungs- und Interventionszielen
- Planung von Intervention/Maßnahmen
- Bewertung von Entwicklungsinterventionen
2 Abschnitt: Entwicklungsmechanismen
- Aufgrund der Vielfalt der Merkmale ontogenetischer Veränderungen gibt es nur wenige Begriffe zur Charakterisierung der Gesamtentwicklung:
- Wachstum
- Reifung
- Differenzierung
- Lernen
- Prägung
- Sozialisation
2.1 W a chse n und Reifen
2.1.1 Phänomene
2.1.1.1 Wachstum
- Bezeichnet rein quantitative Veränderungen eines Organismus im Hinblick auf Größe, Volumen und Menge
- Ist ein Teilaspekt des Gesamtgeschehens "Entwicklung" sowohl in physischer (Zuwachs der Größe, des Gewicht, der Funktionstüchtigkeit der Organe..) als auch psychischer Hinsicht (Zuwachs des Wortschatzes, der allgemeinen Intelligenz, der Wahrnehmungs- und Gedächtnisleistungen etc.)
- Mengenmäßige Zunahme von:
- Kenntnissen
- Fertigkeiten
- Gedächtnisinhalten
- Gefühlsqualitäten
- Interessen usw.
- Alle zähl- und meßbaren Veränderungen von
- Bewußtseinsinhalten
- Reaktionen
- Leistungen
- Funktionen
in Bezug auf Anzahl, Menge, Größe, Intensität, Dauer, Beschleunigung etc.
- Wodurch die quantitativen Veränderungen zustande kommen, bleibt dabei offen
- Wachstumskurven wurden aufgestellt für alle möglichen Entwicklungsbereiche➝ Gesell/Tanner66
Kopf/Gehirn ➝starker Anstieg bis 4. Lebensjahr, dann langsamer bis 14 Jahre
Lymphatisches Gewebe ➝Schnelles Wachstum bis 12 Jahre, dann Absinken Fortpflanzungsorgane➝sehr langsames Wachstum, erst mit Einsetzen der Adoleszens schneller (Hormone)
Körper ➝siehe Längenwachstum, Verschiebung der Proportionen
Intelligenz /Berkeley Growth Study ➝ Jones & Bayley
- Der typische Verlauf einer Wachstumskurve➝
- zunächst beschleunigter Anstieg des Wachstums
- zunehmende Verlangsamung in Kindheit und Jugend
- leichter Abfall nach Erreichen des Kulminationspunktes
Allerdings sind die Wachstumsverläufe nicht einheitlich, innerkulturell zeigen sie aber die gleiche Charakteristik aufgrund gleichen Klimas, gleicher Ernährungsbedingungen und Umwelt.
Einige der Wachstumsvariablen verlaufen auch geschlechtsspezifisch (körperliche Entwicklung). Durch hormonell bedingte Wachstumsschübe kann es zu erneuten, sprunghaften Veränderungen in der Pubertät kommen➝Puberaler Wachstumsschub (Längenwachstum)
- Klassische psychische Wachstumsstudie (Langzeit) der Intelligenz ➝Berkeley Growth Study➝ Jones & Bayley
Sie verfolgten die Intelligenzentwicklung 61 gesunder Babies vom Zeitpunkt ihrer Geburt bis zu ihrem 21. Lebensjahr. In den ersten 5 Jahren in Monats- und Halbjahresschritten, später im Jahresabstand. Sie verwendeten dabei verschiedene dem Alter entsprechende Entwicklungsstand- und Intelligenzmeßverfahren unter anderem Bayley Scales of Infant Development, Calif. Preschool Test, Stanford Binet Test, Terman McNemar Gruppentest und Wechsler-Bellevue-Test für Erwachsene.
Als gemeinsamer Bezugspunkt, damit man die Ergebnisse der verschiedenen Tests miteinander vergleichen konnte, wurden Mittelwert und Streuung der Testwerte jeder VPN ausgedrückt als Abweichung vom Mittelwert des Testergebnisses mit 16 Jahren.
Erg.: Die Forscher fanden einen ziemlich linearen Verlauf der Intelligenzentwicklung bis zum Alter von 10 bis 12 Jahren, in dem eine Verlangsamung des Wachstums eintrat. Ab ca. 18 Jahre tritt dann eine Stagnation der Intelligenzentwicklung ein.
Kritik: Stichprobe nicht repräsentativ, der durchschnittliche IQ-Wert war sehr hoch (117 Punkte mit 16)
- Eine saubere Trennung zwischen quantitativen und qualitativen Veränderungen ist oft nicht möglich, weil sich auch qualitative Veränderungen aufgrund quantitativer Verschiebungen ergeben.
2.1.1.1.1 Begriff
- Der Begriff stammt ursprünglich aus der Entwicklungsbiologie und bezeichnet quantitative, somatische Veränderungen im Sinne einer Volumenzunahme
2.1.1.1.2 Längenwachstum als Modell psychischen Wachstums: Probleme der Beschreibung, Darstellung und Erklärung
- Hier wird das Körperwachstum (Längenwachstum) in Abhängigkeit vom Alter betrachtet. Zuerst ist ein sehr schnelles Wachstum zu beobachten bis ca. 4 Jahre. In den folgenden Jahren verlangsamt sich die Wachstumsgeschwindigkeit bis, hormonell bedingt mit etwa 12 bis 15 Jahren (bei Mädchen 2,5 Jahre eher) der "Puberale Wachstumsschub" einsetzt.
- Durch die interindividuellen Unterschiede im Zeitpunkt des Einsetzen des Wachstumsschubes werden die Charakteristika der Wachstumskurve verfälscht, weil man mittelt.
Dieses Problem kann gelöst werden, indem man die Kulminationspunkte des Wachstums der verschiedenen Individuen gleichsetzt, unabhängig vom Zeitpunkt ihres Eintretens, und die Charakteristika des Verlaufs über eine bestimmte Zeitperiode vor und nach dem Kulminationspunkt betrachtet.
- M. Faust ➝konnte die Daten des Wachstumsschubes quantifizieren.
Auf dem Höhepunkt des Wachstumsschubes beträgt die Zunahme der Körpergröße 9 - 10 cm pro Jahr, wobei es bei den Jungen eine größere Standardabweichung gibt.
- Wachstumskurven bilden Entwicklungsprozesse nur in Grenzen angemessen ab, vor allem bei gemittelten Gruppenkurven
- Sie haben rein deskriptiven Charakter und ermöglichen keine Aussagen über das Zustandekommen
- Qualitative Veränderungen können durch sie überdeckt werden
- Das Aussehen der Kurven ist u.a. abhängig von den Methoden (Längsschnitt-, Querschnittmethode, Stichprobe...)
2.1.1.2 Reifung
- Die Betrachtung der Entwicklung unter dem Reifungsaspekt hat in der Entwicklungspsychologie lange dominiert.
- Reifungsvorgänge sind universell, d.h. sie kommen unabhängig von exogenen Faktoren in allen Kulturen vor.
- Feststellung von Reifungsprozessen durch ➝Ausschluß exogener Faktoren (Erfahrung/Übung...), was beim Menschen ethische Probleme aufwirft. Trotz des Fehlens exogener Faktoren tritt dann keine Verzögerung im Erwerb eines Merkmals ein.
- Indizes auf die Wirksamkeit von Reifungsprozessen➝Heckhausen 74
- Universelles Auftreten ➝Gleiche Abfolge der Entwicklung bei allen Kindern
- Auftreten in einem eng umgrenztem Altersbereich ➝Hohe Änderungsrate in einem bestimmten Alter, z.B. Anfänge des Laufens oder der Sprachentwicklung
- Nachholbarkeit ➝Unterbundene Entwicklungsschritte können nach Wegfall einer Behinderung sehr schnell nachgeholt werden (allerdings kann die fehlende Nachholbarkeit auf sensible Phasen hindeuten) (Gibt es aber auch im Bereich des Lernens)
- Unumkehrbarkeit (Irreversibel)➝Erzielte Entwicklungsfortschritte gehen nicht mehr verloren (allerdings sind auch auf Erfahrung beruhende kognitive Fähigkeiten nicht umkehrbar, z.B. der Zahlbegriff, Kausalrelationen).
- Für Reifung spricht noch am ehesten der fehlende Vorteil durch besondere Stimulation/Training
- Mc Graw ➝Zum Ausschluß exogener Faktoren ließ er Tauben in engen Röhren aufwachsen, so daß sie ihre Flügel nicht bewegen konnten. Trotzdem konnten sie bei ihrer Freilassung fliegen ➝endogene Determination
2.1.1.2.1 Begriff
- Der Begriff der Reifung stammt auch aus der Biologie und wurde ursprünglich angewandt für die Entwicklung der unreifen Keimzelle bis zu ihrer möglichen Befruchtung
- Im weiteren Sinne bezeichnet er alle Vorgänge, die spontan, aufgrund endogen vorprogrammierter, d.h. durch Vererbung determinierter, innengesteuerter Wachstumsimpulse einsetzen und in ihrem weiteren Verlauf vorwiegend von diesen gesteuert werden.
- Diese Prozesse bedürfen zwar eine den artspezifischen Merkmalen und Bedürfnissen angepaßte Umwelt, sind aber des weiteren von exogenen Faktoren relativ unabhängig.
- Exogene Faktoren wirken höchstens unterstützend oder bahnend.
- Reifung im übertragenen Sinne:
- Kognitive Reifung➝bedeutet lediglich das gesetzmäßige Aufeinanderfolgen, Aufeinanderaufbauen und Auseinanderhervorgehen der einzelnen kognitiven Entwicklungsstufen
- Reifezeit, Reifezustände, reifer Organismus, Schulreife, Hochschulreife, moralische Reife➝Bei all diesen Begriffen sind exogene Faktoren entscheidend, sie haben die Bedeutung des Fertig- oder Ausgewachsenseins in Bezug auf ein bestimmtes Kriterium.
2.1.1.2.2 Reifungsvorgänge (Beispiele)
2.1.1.2.2.1 Ossifikation
- Zum Zeitpunkt der Geburt hat der Säugling noch sehr weiche und biegsame Knochen. Unmittelbar nach der Geburt setzt ein durch genetische und auch exogene Faktoren determinierter Verhärtungsprozeß durch Anreicherung von Mineralien (Calcium) ein, der bei bestimmten Knochen erst mit dem Ende der Adoleszenz abgeschlossen ist.
2.1.1.2.2.2 Muskelbildung und willkürliche Kontraktion
- Zwar sind alle Muskelfasern bei der Geburt vorhanden, sie wachsen aber bis zum 40fachen ihrer Größe
2.1.1.2.2.3 Myelinisierung
- Erst mit ca. 4 Jahren abgeschlossen ermöglicht sie eine Zunahme der Nervenleitgeschwindigkeit
2.1.1.2.2.4 Koordination und Integration von Hirnarealen
- In den ersten Lebensmonaten erfolgt eine Verschiebung von Bewegungsabläufen vom Kleinhirn (Reflexe) zum Großhirn (Kortex). Während die frühkindliche Motorik durch viele Reflexhandlungen gekennzeichnet ist (Saug-, Greifreflex, Kreuzfang usw.) die durch Rückenmark und Kleinhirn gesteuert werden, gehen viele der Reflexe ab dem 3. Lebensmonat verloren und das Kind erlangt die kortikale, willkürliche Kontrolle über seine Bewegungsabläufe.
2.1.1.2.2.5 Dendritensprossung
- Zu Anfangs tritt ein überschüssiges Wachstum von Dendriten auf, die anschließend wieder reduziert werden.
2.1.1.2.2.6 Synapsenbildung
- Setzt schon in der pränatalen Phase ein
2.1.1.2.3 Entwicklung der Fortbewegung als Modell psychischer Reifung: Probleme der Beschreib ung und die Bedeutung der Übung
- Reflexhandlungen der frühkindlichen Motorik zu zunehmender kortikaler Kontrolle siehe oben (Koordination und Integration von Hirnarealen).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Aldrich & Norval 46 ➝fanden zu 95% eine ähnliche Abfolge des Erwerbs der motorischen Fähigkeiten und ordneten sie den Alterseinheiten zu.
- Heckhausen ➝spricht von einer "Sachimmanenten Entfaltungslogik", d.h. die Abfolge der Entwicklungssequenz ist in der Sache selbst festgelegt.
- Dennis & Dennis 1940 ➝ Studie Hopi-Indianer
Untersuchten die Kinder dieser Indianer die 3 Monate lang permanent auf einem Wickelbrett festgebunden werden und dann im Laufe des 1. Lebensjahres nur allmählich davon befreit werden und verglichen sie mit einer Kontrollgruppe (ebenfalls Hopi-Kinder).
Sie unterschieden sich nicht im Zeitpunkt in dem sie alleine laufen lernten. Auch nachfolgende Untersuchungen bestätigten dies.
- Ist Laufenlernen ein anlagebedingter Reifungsprozeß?
- Zelazo, Zelazo et al. 72 ➝Experiment mit Auslösung des Schreitreflexes
Für 12 Minuten täglich lösten sie bei Säuglingen den Schreitreflex aus und konnten zeigen, daß die Entwicklung der Fortbewegung sehr wohl durch spezifische Übungen beeinflußt werden kann. Die Kinder lernten früher laufen als die Kontrollgruppe (?)
- Erklärung: Die Auslösung des Schreitreflexes stellt eine Bahnung zum Großhirn dar, die für die spätere Koordination kortikaler Bahnen hilfreich ist.
- Biogenetische Entwicklungstheorien
1. Entwicklung ist ein biologisch determinierter Prozeß
2. Psychische Entwicklung ist ein Entfaltungsprozeß, eine reifungsabhängige Ausdifferenzierung
3. Die Entwicklung zeigt sich vornehmlich in qualitativen Veränderungen
- Phasenmodell der Entwicklung➝Oswald Kroh 1887 - 1955
Drei-Stufen-Modell
Der Übergang zwischen den Phasen/Stufen ist stets krisenhaft
- 1. Trotzphase (mit etwa 4 Jahren)
- 2. Trotzphase (12 - 13 Jahre, Pubertät)
- 3. Trotzphase (Übergang zum Erwachsenenalter)
Diese Sequenz ist festgelegt, schubhaft, irreversibel und unabhängig von sozialen Einflüssen
- Die Reifung geht der Betätigung der jeweiligen Funktion voraus. Entfaltung erfolgt durch Übung. Die Funktionsreife ist endogen vorgegeben, eine exogene Beschleunigung ist nicht möglich, wohl aber eine Hemmung/Störung.
- Kritik➝Phasenmodelle täuschen Einheit und Ordnung vor.
2.1.1.3 Weiteres aus der Prüfungsliteratur
2.1.1.3.1 Differenzierung
- Fortschreitende Ausgliederung unähnlicher Teilgebiete aus einem anfänglich ungegliedertem, einheitlichem Ganzen
Bsp.: Die motorische Entwicklung ist zuerst unkoordiniert und es kommt zu Massenbewegungen des ganzen Körpers, zunehmend werden immer verschiedenere und spezialisiertere Bewegungen einzelner Glieder ausgeführt.
- Gesell ➝Entwicklungsrichtung des Säuglings/Kleinkindes folgt:
- Cephalokaudalem Trend ➝Verfeinerung der Bewegung erfolgt zuerst am Kopf, dann folgen Hals, Rumpf und Beine
- Proximodistalem Trend ➝Verfeinerung von der Zentralachse des Körpers hin zu den Extremitäten
- Weitere Beispiele die mit dem Begriff der Differenzierung gekennzeichnet werden können sind:
- Entwicklung der Unterscheidung Ich/Nicht-Ich, Bekannt/Fremd
- Differenzierung der Emotionen und Motive
- Das Gegengewicht zur Differenzierung ➝ Hierarchische Zentralisierung, Integration, Organisation
Zuerst gibt es eine undifferenzierte, wechselseitige Abhängigkeit aller Funktionen➝ Horizontale Abhängigkeit
Dann die Steuerung und Kontrolle durch übergeordnete Mechanismen für spezifische Funktionen
➝Vertikale Abhängigkeit
- K. Lewin➝sieht in der Differenzierung eine Zunahme der kognitiven Felder, einschließlich der Konsolidierung der Grenzen zwischen den Feldern mit anschließender Verselbständigung des zuvor voneinander abhängigen.
2.1.1.3.2 Lernen ➝ siehe dort 2.2
2.1.1.3.3 Prägung
- Umgangssprachlich➝Eingravieren, Einprägen von Merkmalen, jemand ist durch seine schlimme Kindheit, seinen dominanten Vater o.ä. geprägt.
- Vorwissenschaftlich➝Hinterlassen von bleibenden Eindrücken durch die Umwelt, wobei der Empfänger passiv ist und durch die betreffenden Eindrücke in seinen potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt und in eine bestimmte Richtung festgelegt wird.
- Lorenz 35 ➝Prägung ist ein einmaliger, irreversibler Vorgang der Spezialisierung eines Auslöseschemas für bestimmte Instinkthandlungen, der nur während einer kurzen Zeitspanne (kritische/sensible Periode) bald nach der Geburt stattfinden kann
- Welches Verhalten geprägt wird ist artspezifisch. Bestimmte Reizmerkmale müssen gegeben sein, denn ein Individuum läßt sich nicht auf jedes Reizobjekt prägen.
- Nachweis der Prägung➝Nachfolgeverhalten gegenüber dem ersten bewegten Objekt bei verschiedenen Vogelarten und einigen Säugern (Ziegen, Schafe, Hunde, einige Primaten)
➝Überlebensvorteil
- Merkmale von Prägungsvorgängen➝Lorenz 35/Sucklin 72
1. Verschränkung angelegter Reaktionsmuster mit Reizgegebenheiten der Umwelt
2. Einwirkungsmöglichkeit der Umwelt ist auf eine genetisch determinierte Zeitspanne beschränkt
3. Sobald die Prägung erfolgt ist, ist sie stabil und irreversibel
4. Durch Prägung werden artspezifische Merkmale des Reizobjekts gelernt.
5. Die Verknüpfung eines Verhaltensmusters mit bestimmten Auslösereizen erfordert nicht unbedingt aktuelle Funktionstüchtigkeit oder eine Äußerung des Verhaltens während der Prägungsphase, z.B. kann sich das spätere Paarungsverhalten auf Objekte richten auf die vor der Geschlechtsreife eine Prägung von Nachfolgeverhalten stattfand.
6. Prägungseffekte sind nicht auf Bekräftigung oder Triebreduktion zurückzuführen
- Hess ➝Zur Nahrungsprägung von Entenküken
Er stellte fest, daß die Entenküken eine angeborene Präferenz für weiße Kreise auf blauem Grund haben, verstärkte aber nur die Reaktion auf weiße Dreiecke auf grünem Grund, auf die dann täglich eine zweistündige Löschperiode erfolgte.
Ergebnis: Die Küken haben die sensible Phase für den Prägungsvorgang um den 3. Tag, trotz Extinktionsverfahren behielten die Küken einmal verstärktes Verhalten bei.
- Modifikation des Begriffs der "Kritischen Phase" zu "Sensibler Phase" aufgrund der nicht vollkommenen Irreversibilität oder ausschließlichen Beeinflußbarkeit in einem bestimmten Zeitraum.
- Oft wurde die Prägung auch als eine besondere Art des Lernens betrachtet, als zweigleisiger Prozeß der Klassischen und Instrumentellen Konditionierung. Die scharfe Trennung zwischen Prägung und Lernprozessen wurde inzwischen aufgegeben, es gibt aber trotzdem einige
Unterschiede.
- Nicht-Assoziativität ➝Nicht jeder Reiz (neutral) löst die Reaktion aus
- Unabhängigkeit von Verstärkern ➝Nur ein einziger Stimulus ist beim Prägungsvorgang beteiligt
- Im Humanbereich scheinen bei der ersten sozialen Bindung Prägungsvorgänge eine Rolle zu spielen➝ Bowlby/Ainsworth 69/75
Das Vorhanden-/Nicht-Vorhandensein einer kompetenten Pflegeperson scheint die soziale Entwicklung nachhaltig zu beeinflussen (Entbehrungsstudien bei Heimkindern).
Die sensiblen Phasen sind beim Menschen eher "Optimale Perioden"
2.1.1.3.4 Sozialisation
- Viele Definitionen, weil einige Forscher die aktive, andere die passive Rolle des Individuums betonen.
Gegenwärtig➝Sozialisation ist der umfassende Titel für den hypothetischen Prozeß des sozialen Lernens, der durch wechselseitige Interaktion zwischen voneinander abhängigen oder aufeinander bezogenen Personen gekennzeichnet ist. Die Interaktionen werden im Laufe der Entwicklung immer symmetrischer und führen allmählich zur Ausbildung sozial relevanter Verhaltens- und Erlebnisschemata. Schließlich wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den eigenen Wünschen und Bedürfnissen und den eventuell damit interferierenden Wünschen und Bedürfnissen anderer erreicht.
- Es gibt 4 Modelle der Sozialisation:
1. Trichtermodell➝Child
Sozialisation ist der passive Vorgang fortschreitender Einengung und Festlegung des Verhaltens. Der Anpassungsdruck und Konformitätszwang werden in diesem Modell betont.
Kritik: Aktive Beteiligung des Kindes am Sozialisationsprozeß wird verkannt. Ein reiner Anpassungszwang erklärt nicht den sozialen Wandel. Sozialisation wird nicht als lebenslanger Prozeß betrachtet. Einengung und Festlegung des Verhaltens scheint widerlegt.
2. Rollentheorien der Sozialisation➝Brim 69/Sacler 69/(Mead 34/Linton 36)
- Sozialisation ist das Hineinwachsen des Individuums in gesellschaftlich definierte Rollen/Positionen an die bestimmte Erwartungen geknüpft sind (Qualifikationen etc.).
- Innerhalb der verschiedenen Geschlechts- und Altersgruppen, Verwandtschaftsgruppen, Beschäftigungsgruppen, Statusgruppen und Freundschafts- und Interessengruppen können verschiedene Positionen eingenommen werden.
- Diese Positionen können zugeschrieben oder erworben sein.
- Von einem Individuum können mehrere Positionen eingenommen werden und jede Position hat eine oder mehrere Gegenpositionen (Lehrer - Schüler, Arzt - Patient usw.).
- In unserer Gesellschaft gibt es für viele Positionen keine einheitlichen Rollenerwartungen, dafür aber verschiedene Bezugsgruppen, nach denen sich die Individuen richten.
- Eine Rolle besteht u.U. auch aus mehreren Segmenten (Lehrer als Pauker, als Kollege usw.).
- Rollen sind interdependent, d.h. ändert sich die Rolle eines Partners, dann ändert sich auch die Rolle des anderen Partners.
- Auffällig wird die Rolle erst bei einem Rollenwechsel oder beim "Aus der Rolle fallen".
- Rollenerwartungen sind schwer zu ändern (gesellschaftliche Sanktionen).
3. Sozialisation als Abfolge und Bewältigung von Entwicklungsaufgaben➝Havighurst 48
- Die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben ist ein wesentliches Sozialisationsziel.
- Die Bewältigung späterer Entwicklungsaufgaben wird durch Meisterung vorangegangener Entwicklungsaufgaben erleichtert.
- Einige der Aufgaben sind biologisch determiniert➝Ausscheidungskontrolle/Fortpflanzungsfähigkeit
- Wieder anderer sind gesellschaftlich determiniert➝Schul-, Berufseintritt, Heirat...(aber auch vom Individuum selbst bestimmte Aufgaben)
- Die Bewältigung einzelner Aufgaben wird von allen Mitgliedern einer Gesellschaft verlangt und bei Nichterfüllung sanktioniert, andere Aufgaben sind weniger verpflichtend
- Einige Aufgaben sind langfristig vorhersagbar/planbar➝Antizipatorische Sozialisation
- Andere Aufgaben treffen einen Plötzlich und unerwartet➝Verlust des Ehepartners, des Arbeitsplatzes etc.
4. Bidirektionales Modell der Sozialisation➝Richard Bell 68/77
- Die aktive Rolle und die Beeinflussungsmöglichkeiten des Kindes werden betont.
- Unterschiedliche Kinder reagieren auf objektiv gleiches Verhalten der Eltern anders und rufen durch ihr eigenes Verhalten unterschiedliche Reaktionen bei den Eltern hervor.
- Später legte Bell mehr Betonung auf die wechselseitige Beeinflussung.
- Eltern und Kinder haben ein hierarchisch organisiertes Verhaltensrepertoire (keine ein für allemal festgelegten Erziehungstechniken z.B.) und können ihre Verhaltensweisen abhängig vom Verhalten des Interaktionspartners in vorhersagbarer Weise variieren.
- Jede der Parteien hat eine obere und untere Toleranzgrenze in Bezug auf die Intensität, Häufigkeit, situative Angemessenheit des Verhaltens des Partners. Wird die Obergrenze überschritten, erfolgt eine Reduktion durch Kontrollaktionen. Wird die Untergrenze überschritten, erfolgt eine Stimulation der unzureichenden/fehlenden Verhaltensweisen.
- Die Hauptfunktion des elterlichen Verhaltens ➝Das Verhalten des Kindes innerhalb der optimalen Bandbreite zu halten. Ist dies der Fall, so befindet sich das System im Gleichgewicht und es gibt keine direkten Kontrollreaktionen.
- Das Modell berücksichtigt auch die kognitiven Prozesse von Eltern und Kind. Die Interaktionspartner reagieren nicht nur auf das aktuelle Verhalten des Partners, sondern auch auf ihre eigene Interpretation/Antizipation des Verhaltens.
- Beeinflussungsmethoden von Kindern für ihre Eltern➝Pauls & Johann 84
- Konstruktiv-aktive Steuerung➝Logische Argumente und Kompromißaushandlungen
- Vorwürfe und oppositionelle Steuerung➝Drohen, Trotzen, Fordern und Erpressen
- Steuerung durch Bestrafung➝Schreien, Nerven und Blamieren
- Passiv-resignative Steuerung➝Demonstrative Hilf- und Machtlosigkeit
- Steuerung durch Schmusen/Streicheln
- Verlangen einer Begründung von Vorschriften, Verboten, Einstellungen und Urteilen
- Die empirische Untersuchung von Sozialisationsprozessen versucht Zusammenhänge (Korrelationen) zwischen einzelnen soziokulturellen Faktoren (Erziehungspraktiken, Familienstrukturen, Kulturellen Wertvorstellungen) und interindividuellen Unterschieden, oder Gemeinsamkeiten der Entwicklung innerhalb einer Kultur oder zwischen den Kulturen aufzudecken.
Die Entwicklungspsychologie versucht Wenn-Dann-Beziehungen zwischen sozialen Einflüssen und der Verhaltensentwicklung von Individuen nachzuweisen, wobei ein direkter Nachweis aufgrund der Korrelationsstudien nicht möglich ist.
- Im Rahmen der Bochumer Langzeitstudie wurden z.B. die Mutter-Kind-Interaktionen bei den Hausaufgaben im Zusammenhang mit der Leistungsmotiventwicklung im Grundschulalter untersucht ➝ Trudewind & Husarek 79 (siehe Leistungsmotiventwickung)
- Ökopsychologischer Ansatz➝Bonfenbrenner 76/79/81
- Hier wird die Verschachtelung individueller, sozialer und gesellschaftlicher Einflüsse betrachtet.
- Nach einer Ausarbeitung postuliert der Autor 4 sich hierarchisch überlagernde Systeme:
- Mikrosysteme ➝Aktivitäten, Rollen und interpersonelle Beziehungen in der unmittelbaren Umgebung eines Individuums
- Mesosysteme ➝Die Beziehungen zwei oder mehrerer Mikrosysteme denen ein Individuum angehört
- Exosysteme ➝Settings, denen das Individuum zwar nicht angehört, die jedoch sein Mikro- und Mesosystem beeinflussen oder die von ihnen beeinflußt werden
- Makrosysteme ➝Regelhaftigkeit der Formen oder des Inhalts von Systemen niedriger Ordnung, die in der Gesamtkultur oder einer Subkultur gegeben sind, einschließlich der diesen Regelhaftigkeiten zugrundeliegenden Überzeugungen und Ideologien
- Dimensionen und Auswirkungen der familiären Sozialisation
- Hauptinteresse➝Zusammenhang elterlicher Erziehungspraktiken und den Charakteristiken von Kindern und Jugendlichen.
- Hauptdimensionen des Erziehungsstils➝Schäfer 59
- Autonomie vs. Kontrolle
- Wärme/Liebe vs. Feindseligkeit
Je nach Kombination ergeben sich verschiedene Erziehungsstile. (Dimensionen nur auf Elterninterviews gestützt)
➝Becker 64
- Permissivität vs. Restriktivität
- Wärme vs. Feindseligkeit
- Spätere Untersuchungen auch durch Beobachtung und Befragung auch der Kinder.
➝Baumrind 66/71
- Fordernd vs. Antwortend
- Durch Kombination der positiven/negativen Ausprägungen dieser Merkmale ergeben sich 4 Erziehungsstile:
- Autoritär-autokratisch ➝Diese Kinder zeigen geringe soziale Kompetenz im Umgang mit Peers. Sie sind wenig spontan und zeigen eine schwache Internalisierung moralischer Normen. Ihr eigenes Verhalten sehen sie als extern gesteuert und schätzen sich selbst gering.
- Nachgiebig-permissiv ➝Diese Kinder sind impulsiv und aggressiv und dabei sehr unselbständig. Die Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung fehlt.
- Autoritativ-reziprok ➝Diese Kinder sind selbständig im Denken und im sozialen Handeln. Sie zeigen eine hohe soziale Verantwortlichkeit und beherrschen ihre aggressiven Impulse und sind dabei selbstsicher mit hoher Selbstwertschätzung.
- Indifferent-unbeteiligt ➝Diese Kinder können weniger eindeutig eingeordnet werden. Es scheint ein optimales, mittleres Maß der Beteiligung zu geben, das sich dann positiv auswirkt. Extrem geringe und auch extrem hohe Beteiligung ist schädlich.
- Die Korrelationen zwischen den Erziehungsstilen und den Merkmalen der Kinder sind im allgemeinen nicht sehr hoch. Der Erziehungsstil ist nur ein Faktor unter vielen. Der Erziehungsstil ist selbst zum Teil nur Reaktion auf das Verhalten des Kindes.
- Durch die Komplexität von Sozialisationsprozessen ergeben sich methodische Schwierigkeiten, weshalb man sich auf eine oder wenige der Sozialisationsvariablen beschränkt
Mögliche Variablen➝Weinert 72
- Schulbildung, Beruf und Einkommen der Eltern
- Die Wohngegend
- Freunde/Verwandtschaft
- Das Familienklima➝soziale Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern
- Persönlichkeitseigenschaften der Eltern
- Erziehungsverhalten
- Persönlichkeitsmerkmale des Kindes
- Vorangegangene, gleichzeitig wirkende und nachfolgende Sozialisationseinflüsse
2.1.2 Biologische Grundlagen der Entwicklung
- Man fragt primär nach den biologischen Grundlagen der Entwicklung, wobei die Umwelt nur eine Restgröße ist. (Genau andersherum bei einer lerntheoretischen Betrachtung)
2.1.2.1 Evolution und Phylogenese des Menschen
- Charles Darwin 1859➝1. Evolutionstheorie
Sie erklärt:
- Die Erscheinungsvielfalt des Lebens
- Die Vielfaltseinschränkungen innerhalb einer Art
Darwin kannte die Mendelschen Gesetze noch nicht, die zusammen mit seiner Evolutionstheorie zur sogenannten synthetischen Evolutionslehre geführt haben.
- Erbliche Variationen und Natürliche Selektion sind die Motoren der Evolution.
- Definition der Art (in der synthetischen Evolutionslehre):
Natürliche Populationen oder Gruppen von Populationen, die sich tatsächlich oder potentiell miteinander unter natürlichen Bedingungen kreuzen und fortplanzungsmäßig gegen andere Gruppen isoliert sind.
➝Stack 81
- Mendelsche Gesetze ➝1865
- Aufschlüsselung der DNA➝Watson & Crick 53
- Phänotyp ➝Beobachtbares Erscheinungsbild des Organismus. Er ist variabel im Rahmen des vom Genotyp gesetzten Bereich. Rückschlüsse vom Phänotypen auf den Genotyp sind nicht möglich.
- Reaktionsnorm ➝Bezeichnet das mögliche Spektrum von Phänotypen, je nach Umweltbedingungen, für einen bestimmten Genotyp.
2.1.2.1.1 Mechanismen der Evolution
1. Mutation ➝Sie ist nicht gerichtet sondern zufällig (siehe auch Hand Out).
- Genmutation ➝Veränderung in der Abfolge der Basen auf einem Abschnitt der DNA, der für eine bestimmte Aminosäurenkette kodiert (Basentripletts)
- Chromosomenmutation ➝Der Mensch hat 46 Chromosomenpaare. Abweichungen dieser Zahl oder Verdoppelung einzelner Chromosomen kann schwerwiegende, aber auch positive Folgen haben.
- Genommutation ➝Betrifft die Gesamtheit des genetischen Materials einer Zelle
2. Rekombination ➝ Eine Mischung der Gene jener Personen die sich fortpflanzen. Ermöglicht durch die sexuelle Fortpflanzung und damit der Meiose (siehe dort).
3. Selektion ➝Gibt der Evolution die Richtung, indem die geeigneten, d.h. an die entsprechenden Umwelt angepaßten Individuen überleben. (Bsp.: Birkenspanner)
4. Elimination und Isolation ➝Gendrift
- Down-Syndrom/Trisomie 21 (umgspr. Mongoloismus aufgrund der Falte am Auge)
➝London Down 1866
Down klassifizierte zu der Zeit Geistesschwache; die Mechanismen der Vererbung waren aber derzeit unbekannt.
➝Le Jeune 59
Erarbeitete die Grundlagen für die Erklärung des Down-Syndroms.
- Das 21. Chromosom liegt in 3facher statt doppelter Ausführung vor (ist triploid).
- 20 - 25% aller geistig Behinderten haben dieses Syndrom, dabei ist aber jedes dieser Kinder ein
Individuum.
- Diese Chromosomenabweichung entsteht durch Non-Disjunktion (Nicht-Trennung) der homologen Chromosomen bei der Meiose, oder aber bei der Mitose (dann wird es Mosaiksyndrom genannt).
- Kennzeichen und Faktoren des Down-Syndroms
- 50% der Geborenen haben einen Herzfehler, sie leiden an einem unzulänglichen Immunsystem, was häufige Infekte nach sich zieht.
- Eins von 700 - 900 Neugeborenen ist betroffen
- Das Down-Syndrom korreliert mit dem Alter der Mutter ab 35 Jahre zum Zeitpunkt der Konzeption. Das Risiko steigt dann auf das 10fache.
- Mögliche Faktoren ➝Alterung der Ovozyte, zunehmende Disregulation der hormonellen Faktoren, weniger spontane Aborte bei Störungen der Eizelle oder auch Kumulation von schädlichen Faktoren, wie z.B. Röntgenstrahlen.
- Merkmale aus entwicklungspsychologischer Sicht
- Niedriger Muskeltonus
- Geringe Initiative/Passivität
- Bänder und Gelenke sind überdehnbar
- Die Exploration ist beeinträchtigt/fehlendes Greifen nach Objekten
- Beeinträchtigung der Aufmerksamkeitssteuerung und des motorischen Verhaltens
- Langsame Informationsverarbeitung, vor allem die sequentielle Infoverarbeitung fällt schwer.
- Sprachentwicklung beeinträchtigt➝Deformation des Rachenraumes (der obere Gaumen ist nicht sehr gewölbt); lange, dicke Zunge. Nur 50% der Kinder lernen Sprechen (um die Entwicklung in Gang zu setzen sind fördernde exogene Faktoren notwendig).
- Die geistige Entwicklung ist verzögert (halbes Entwicklungstempo)
- Die sozialen Fähigkeiten sind weniger beeinträchtigt, im 1. Lebensjahr werden aber weniger emotionale Reaktionen gezeigt und auch weniger Angst.
- Erwachsene mit dem Down-Syndrom erreichen etwa den Entwicklungsstand eines 4 - 10jährigen Kindes.
2.1.2.1.2 Genetik und Vererbung
2.1.2.1.2.1 Struktur der DANN
- In den Chromosomen im Zellkern befinden sich 3,2 2 10-12 g. DNA
In dieser kleinen Menge befindet sich die gesamte Erbinformation.
- Die DNA bildet eine Doppelspirale, deren Stränge sich umeinander winden. Das Rückgrat dieser Stränge bilden abwechselnd Phosphat- und Zuckermoleküle. An die Zuckermoleküle sind die 4 Basen Adenin, Thymin und Cytosin Guanin jeweils über Wasserstoffbrücken verbunden. 3 dieser Basen kodieren jeweils für eine Aminosäure.
- Replikation ➝Die Spirale wird von einer Seite her durch ein spezifisches Enzym geöffnet. Dann legen sich die jeweiligen Bindungspartner an die nun ungepaarten Basen (die frei im Plasma vorhanden sind) an und es entstehen 2 identische Doppelspiralen der DANN
2.1.2.1.2.2 Proteinsynthese
- Jeweils 3 Basen (Triplets) kodieren für eine Aminosäure, welche die Bausteine für die Organe (Strukturproteine), die Hormone, Enzyme und Neurotransmitter sind.
- Es gibt ca. 20 Aminosäuren aus denen alle Proteine bestehen.
- Mit den 4 Basen, jeweils in Dreierkombination lassen sich 64 Triplets konstruieren.
- Transkription ➝Da die Proteinsynthese nicht im Zellkern stattfindet, sondern an den Ribosomen im endoplasmatischen Reticulum und im Zytoplasma, bildet sich an einem Strang der
Doppelhelix ein Komplementärstrang aus Ribonukleinsäure (RNA) . Sie ist ebenso aufgebaut wie die DNA, nur wird die Base Thymin durch Uracil ersetzt und die Zuckermoleküle tragen ein Atom O2 mehr.
- Translation ➝Diese sogenannte Messenger-RNA wird aus dem Zellkern ins Zytoplasma transportiert wo sich die Ribosomen an der m-RNA aufreihen und die Paarung jeweils eines der Triplets mit einem Triplet der Transfer-RNA bewerkstelligt, welches wiederum auf seiner anderen Seite nach dem Schlüssel-Schloß-Prinzip jeweils die für das Triplet spezifische Aminosäure trägt. Gesteuert durch Start-, bzw. Stoppkodons entsteht nun die spezifische Aminosäurekette, die dann entlassen wird.
- Diese Aminosäurenkette geht aufgrund ihrer eigenen Beschaffenheit und auch mit Hilfe von Enzymen weitere Bindungen sowohl mit sich selbst oder auch anderen Polypeptiden ein, und bildet eine dreidimensionale Struktur.
2.1.2.1.2.3 Chromosomentheorie der Vererbung
- Bei höheren Organismen gibt es eine komplizierte Auffaltung der DNA im Zellkern zu Chromosomen. Dies geschieht mit Hilfe von Histonen, wobei der genaue Aufbau aber unbekannt ist.
- Die Gene liegen linear auf diesen Chromosomen, die nur während des Prozesses der Zellteilung sichtbar werden.
- Jede Art hat eine konstante Anzahl von Chromosomenpaaren. Der Mensch hat 23 Paare (22 Autosomenpaare und 1 Gonosomenpaar).
- Einige wenige Zelltypen z.B. die roten Blutkörperchen, haben keine Zellkerne und damit auch keine Chromosomen. Die Keimzellen haben nur den einfachen (haploiden) Chromosomensatz.
- Der Mensch hat 3,2 2 10-12 Gramm DNA, was ausreichend ist für 5 2 106 durchschnittliche Proteine, wobei das durchschnittliche Protein aus ca. 200 Aminosäuren besteht, die 600 Basen für ihre Kodierung erfordern. Aber nicht die gesamte DNA kodiert Proteine, sondern sie übernimmt auch Kontrollfunktionen der Proteinsynthese (Regulatorgene➝Operon-Modell), Funktionen bei der Zellteilung oder Strukturierung der Chromosomen, oder hat gar keine Funktion (selfish DNA)
- Die tatsächliche Anzahl von Strukturgenen (Proteinsynthese) ist viel kleiner als die mögliche Anzahl von etwa 5 Millionen. Schätzungen gehen von etwa 1oo.ooo Genen beim Menschen aus.
2.1.2.1.2.4 Mitose
- Viele Körperzellen bleiben nach Ende der Wachstumsphase weiterhin teilungsfähig, z.B. Haut und Schleimhäute.
Andere wiederum nur bei Beschädigung, wie die Leber.
Wieder anderer insbesondere die Nervenzellen verlieren ihre Teilungsfähigkeit vollständig ab etwa dem 2. Lebensjahr.
- Bei der Teilung durch Mitose wird das genetische Material verdoppelt und auf die Tochterzellen verteilt, so daß hinterher zwei identische Zellen vorliegen (falls keine Mutation vorliegt)
- Die Mitose verläuft in 4 Phasen:
- Prophase ➝Die DNA faltet sich zu den Chromosomen auf und verdoppelt sich (Replikation). Ein Chromosom besteht dann aus zwei Chromatiden, d.h. es liegt der 4fache Chromosomensatz vor.
Die Kernmembran löst sich auf.
- Metaphase ➝Die Chromosomen ordnen sich in einer Ebene an und der Spindelapparat bildet sich aus.
- Anaphase ➝Die Chromatiden trennen sich und werden zu den Polen der Zelle gezogen. Die Membranbildung der neuen Zellen beginnt.
- Telophase ➝Die neuen Kernmembranen bilden sich vollständig aus und auch die Zellmembranen.
Die Teilung der beiden identischen Tochterzellen findet statt.
2.1.2.1.2.5 Meiose
- Würden die Keimzellen ebenfalls den diploiden Chromosomensatz tragen, würde sich die Anzahl der Chromosomen in jeder neuen Generation verdoppeln. Deshalb muß der Chromosomensatz der Keimzellen zunächst halbiert werden.
- In der Meiose entstehen aus einer diploiden Stammzelle 4 haploide Keimzellen. Bei den höheren Säugetieren geschieht dies in den Ovarien und Testikeln.
- Auch die Meiose vollzieht sich in Phasen:
- Prophase 1 ➝Sie vollzieht sich ähnlich wie bei der Mitose. Der Chromosomensatz wird verdoppelt und kondensiert. Die Kernmembran löst sich auf. Der Spindelapparat beginnt sich auszubilden.
Im Unterschied zur Mitose aber legen sich die homologen Chromosomen (also jeweils die beiden Partner eines Chromosomenpaares) aneinander (Synapsis). Hierdurch entsteht die Möglichkeit homologes Material (also Gene der gleichen Loci) auszutauschen. Die Punkte an denen sich die homologen Chromosomen überkreuzen nennt man Chiasmata, den Vorgang des Austauschs Cross- Over (siehe dort).
- Metaphase 1 ➝Die Chromosomen ordnen sich in der Äquatorialebene an und verbinden sich mit den Spindelfasern.
- Anaphase 1 ➝Es erfolgt eine Trennung der Chromosomenpaare, nicht aber der Chromatiden.
- Telophase 1 ➝Die Chromosomenpaare erreichen die Zellpole. Bei einigen Organismen erfolgt bereits jetzt die Bildung der Membranen, bei anderen, auch beim Menschen erfolgt jetzt die zweite meiotische Teilung, die genau wie die Mitose verläuft. Hier werden dann die identischen Chromatiden geteilt.
2.1.2.1.2.6 Cross-Over und Rekombination
- Der Austausch des genetischen Materials während der Prophase 1 der Meiose ist für die Evolution sehr wichtig. Die beiden homologen Chromosomen sind in ihrem Informationsgehalt nicht identisch. Eins stammt vom Vater und eins von der Mutter.
- Mutationen an einem bestimmten Lokus sind möglich, so daß ein Individuum verschiedene homologe Chromosomen haben kann.
- Bei der meiotischen Teilung der entstehenden Keimzellen können mütterliche oder väterliche Chromosomenabschnitte durch ein Cross-Over zu einem neuen Chromosom vereint werden, so daß dieses u.U. mit keinem der elterlichen Chromosomen identisch ist. Das Resultat ist eine Zunahme der genetischen Variation durch Entstehung neuer Chromosomen
➝Rekombination/Rekombinanten
- Bsp.: In einem Kartenspiel stellen Herz, Kreuz, Pik und Karo die verschiedenen Ausführungen eines Gens dar➝Allele. Die Karte, König, Bube oder auch Sieben sind die Genorte➝Loci
- Gibt es nun bei einem Individuum verschiedene Allele für einen Genort, so spricht man von
➝ Heterozygotie an dem bestimmten Locus. Gibt es nur gleiche Allele an einem Lokus, spricht man von➝ Homozygotie für diesen Ort
- Die Summe aller Allele einer Art nennt man ➝Genpool
- Einen Genlocus mit nur einem mögliche Allel (nicht nachweisbar) nennt man monomorph Einen Locus mit mehreren möglichen Allelen im Genpool entsprechend polymorph.
- Im Durchschnitt gibt es beim Menschen 3 Allele pro Locus.
- Jedes Individuum kann von der Mutter deren mütterliches (Großmutter) oder väterliches (Großvater) Chromosom erhalten; das entsprechende gilt auch für den Vater. Also gibt es 4 Möglichkeiten für die Zusammenstellung des Chromosoms. Da alle 23 Chromosomen beim Menschen unabhängig von den restlichen Chromosomen vererbt werden, gibt es in den Nachkommen ein beliebiges Mischungsverhältnis aus den zwei großväterlichen und den zwei
großmütterlichen Chromosomen➝das macht 423 Möglichkeiten und das bei nur 416 Bewohnern des Planeten.
- Allerdings führt die Vielfalt der Allele nicht notwendigerweise zu einer ebensolchen Vielfalt der Phänotypen (aufgrund möglicher selektiver Neutralität der Allele?)
2.1.2.1.2.7 Die Mendelschen Gesetze
- 1. Uniformitätsgesetz ➝Die erste Filialgeneration ist genetisch und phänotypisch uniform.
- 2. Aufspaltungsgesetz ➝Die Filialgeneration 2 spaltet sich beim Genotypen in 1:2:1, der Phänotyp spaltet sich beim dominant-rezessiven Erbgang in 3:1 auf (aufgrund dominanter und rezessiver Allele), während er beim intermediären Erbgang dem Verhältnis der Genotypen entspricht.
- Wie kann man bei einem Phänotypen, der das dominante Merkmal trägt Homo- bzw. Heterozygotie des Genotyps feststellen?
Man kreuzt das Individuum mit einem phänotypischen Träger des rezessiven Merkmals (der genotypisch homozygot sein muß). Ist das fragliche Individuum genotypisch homozygot, so ist die Filialgeneration uniform. Liegt hingegen Heterozygotie vor, so spaltet sich die Filialgeneration phänotypisch 1:1.
- 3. Unabhängigkeitsregel ➝Bei Mehrfachkreuzungen (von Merkmalen) werden die Merkmale unabhängig voneinander vererbt. (Hier hatte Mendel einfach nur Glück, daß die Merkmale monogen, d.h. nur durch ein Gen bestimmt waren, und das die verantwortlichen Gene zusätzlich auf verschiedenen Chromosomen lagen.
- Heute weiß man um die Genkopplungsgruppen, die keine unabhängige Vererbung von Merkmalen ermöglichen. Und man weiß auch um die Geschlechtsgebundene Vererbung, wie sie zum Beispiel bei der Farbenblindheit vorliegt. Bei der Frau liegt das verantwortliche Gen auf dem X-Chromosom immer heterozygot vor und weil das Allel für die Farbenblindheit rezessiv ist, kommt dieses Phänomen bei ihr nicht zum tragen. Sie kann das rezessive Allel des X-Chromosoms aber sehr wohl an ihre Söhne weitergeben, denen das 2. gesunde Allel fehlt aufgrund der XY- Kombination bei Männern.
2.1.2.1.3 Erbgut und Umwelt
- Bei der Anlage-Umwelt-Problematik gibt es eine große Bandbreite von Möglichkeiten. Es gibt sowohl stabile Merkmale➝die auch unter Kaspar-Hauser-Bedingungen phänotypisch in Erscheinung treten. Z.B. die Gesänge einiger Singvögel und wahrscheinlich aller Insekten.
- Bei anderen Merkmalen wiederum spielen Lernvorgänge eine große Rolle➝Die Sprachfähigkeit des Menschen zum Beispiel, für die über 100 Gene verantwortlich sind (Polygenie). Die Umwelt übernimmt dabei häufig die Feineinstellung.
2.1.2.1.3.1 Schema der genetischen Wirkkette
- Die genetische Information steuert zwar die Proteinbiosynthese, aber exogene Faktoren und interne Wechselwirkungen tragen ihren Teil dazu bei.
- Durch Proteinsynthese, exogene Faktoren und interne Wechselwirkungen werden die Zellfunktionen gesteuert.
- Auch die Organfunktionen werden über diesen Weg gesteuert.
- Und von dort aus die geschieht die Funktionssteuerung des gesamten Organismus, was auch Verhalten im weitesten Sinne beinhaltet. Durch dieses Verhalten kann nun auch die Umwelt beeinflußt werden.
- Auf allen Ebenen können exogene Faktoren und interne Wechselwirkungen ihren Einfluß ausüben.
- Ein Beispiel für die internen Wechselwirkungen:
Die genetische Information steuert die Proteinsynthese, wo auch wieder Enzyme zur Steuerung der Zellfunktionen synthetisiert werden. Dies ist aber nur möglich, wenn dem Körper von außen
bestimmte Vitamine, Aminosäuren (die der Körper nicht herstellen kann, etwa 8) und Spurenelemente zugeführt werden (Jod z.B.), welche wieder für den Aufbau von anderen Wirkstoffen des Körpers (Hormone z.B.) gebraucht werden.
2.1.2.1.3.2 Das Beispiel der Phenylketonurie
- Dies ist ein Krankheitsbild (aufgrund Mutation) im Stoffwechsel der Aminosäure Phenylalanin. Hierbei fehlt aufgrund der Genmutation die Fähigkeit das Enzym Hydroxylase zu synthetisieren, die verantwortlich ist für die Bildung des Wachstumshormons Thyrosin (mit Hilfe des Phenylalanin).Die Akkumulation von Phenylalanin im Blut der Betroffenen führt zu einem IQ- Wert von unter 50 Punkten, da sie sich schädigend auf die Entwicklung des Gehirns auswirkt (Myelinisierung).
- Diese Schädigung ist mit Hilfe exogener Faktoren, nämlich einer phenylalaninarmen Diät bis ins Jugendalter hinein, zu vermeiden.
- Die Phenylketonurie wird rezessiv vererbt. Für das Auftreten der Krankheit muß also Homozygotie vorliegen.
2.1.2.2 Evolution und Ontogenese: Biologische Grundlagen des Erfahrungserwerbs
- Evolution ➝Erhebliche Ausweitung des Hirnvolumens im Verlauf der Evolution des Menschen zu beobachten<
Während das Gehirn der Schimpansen ca. 394cm3 hat, sind es beim Menschen 1400 cm3.
- Durch diesen Zuwachs wurden neue kognitive Leistungen und auch kurzfristigere Umweltanpassungen möglich.
- So erwarb der Homo sapiens sapiens vor etwa 40 -30.000 Jahren
- Die Sprachfähigkeit
- Ein lernfähiges ZNS
- Die Offenheit von Verhaltenssystemen, d.h. weniger festgeschriebene Verhaltensweisen (Instinkte)
- Ontogenese ➝Voraussetzung für diese neuen Leistungen ist aber die Fürsorge durch die Eltern und die Speicherung von Erfahrungen.
Die Fürsorge ist notwendig, sonst müßten die Säuglinge fertiger auf die Welt kommen, was aufgrund des Kopfumfanges nicht möglich ist.
- Die basale Erfahrungsbildung ist allerdings erst möglich bei ausreichend ausgereiften Sinnesorganen und ZNS.
- Lt. Brazelton ➝bringt das Neugeborene aber die Zielstrebigkeit und die Fähigkeit Informationen/Erfahrungen zu speichern bereits mit, ist also keine "Tabula rasa".
2.1.2.3 Embryonal- und Fetalentwicklung
- Die Schwangerschaft dauert in der Regel 38 Wochen (40 Wochen nach der letzten Regel ist der Geburtstermin.
- Man teilt die Schwangerschaft ein in 3 oder 4 Phasen:
1. Blastozyste➝
- Bis zur Einnistung im Uterus (6. - 12. Tag).
- 4 - 5 Minuten nach der Befruchtung teilt sich die Zelle bereits das erste Mal. Nach vierfacher Teilung gibt es erste Spezialisierungen, während vorher die Zellen omnipotent waren, d.h. noch jedes Gewebe oder Organ ausbilden konnte.
- Es bildet sich nun auch die Blastozystenhöhle mit den Trophoplasten zur Ernährung des Keims.
2. Embryonalzeit➝
- Bildung der Chorionzotten die den Embryo mit dem mütterlichen Stoffwechsel verbinden (Nidation 13.Tag).
- Aus dem dreiblättrigen Keim entwickeln sich alle Gewebe und Organe.
- Am 21. Tag entsteht das Herz aus zwei Blutgefäßen, die miteinander verschmelzen und beginnt
sofort zu schlagen (der Embryo ist noch keine 2mm groß).
- Das Gehirn beginnt sich am 26 - 28. Tag zu Bläschen auszubilden, die Verdauungsorgane entwickeln sich, Armknospen werden sichtbar.
Am 21. Tag folgen die Beinknospen (der Embryo ist 6mm groß).
Es folgt die Ausbildung der Augenbecher und die Verbreiterung der Handplatten.
- Ab dem 40. Tag Fußplatten, pigmentierte Retina und Ohrwülste.
- Es folgen die Fingerstrahlen, die Zehenstrahlen, die Augenlider entwickeln sich und auch die Brustwarzen werden sichtbar.
- Um den 50. Tag sind die Arme bereits länger und beugen sich, die Finger sind zuerkennen und trennen sich dann.
- Nur 2 Tage später, mit 53 Tagen wird die erste Bildung von Synapsen im Gehirn beobachtet. Hiermit ist die Grundlage für die Informationsverarbeitung gelegt. Der Embryo ist gerade mal 2,4 cm groß.
Mit 56 Tagen oder 8 Wochen sind alle inneren und äußeren Organe angelegt. Der Embryo macht erste Wahrnehmungserfahrungen. Die Reflexzentren für die Atemtätigkeit haben sich entwickelt und das Atmen wird bereits geübt.
Taktile Funktionsfähigkeit schon im ersten Monat nachweisbar und entsprechende Reaktionen im
2. Monat.
3. Fetalzeit➝
- 9 Wo.: Die Augen des Fötus schließen sich, der Kopf wird runder, er macht noch fast die Hälfte der Körpergröße (5cm) aus. Fötus reagiert mit Bewegungen des ganzen Körpers.
- 10. Wo.: Nach und nach wird die ganze Körperöberfläche empfindlich für taktile Reize (ausgehend von den Extremitäten). Der Fötus kann eine Faust machen und Ellenbogen- und Handgelenk unabhängig voneinander bewegen. Auch der Gleichgewichtssinn beginnt zu funktionieren (Auslösung des Nystagmus). Das Geschlecht wird erkennbar.
- 12. Wo.: Knochenbildung schreitet fort. Der Gaumen schließt sich, erste Saugreflexe treten auf. Der Fötus kann schlucken und schmecken.
- 14. - 16. Wo.: Knochenbildung weit fortgeschritten, das Skelett ist beim Röntgen gut zu entdecken. Das Gehör entwickelt sich. Das Herz pumpt 30 l Blut/Tag. Das Chorion ist mit der Uterusschleimhaut zur Plazenta zusammengewachsen. Kopfbehaarung beginnt sich zu entwickeln.
- 18. - 20. Wo.: Käseschmiere hat sich ausgebildet (Vernix caseosa). Augenbrauen und Haare sprießen. Beginn der Myelinisierung des Gehirns. Die Stäbchen sind differenziert. Erste kindliche Bewegungen. Der Fötus ist 16 bis 21 cm groß.
- 22. Wo.: Bisher frühester Zeitpunkt, an dem ein zu früh geborenes Kind am Leben erhalten werden kann (in Deutschland 26. Wo.)
- 24. Wo.: Fingernägel sind ausgebildet
- 26. Wo.: Der Fötus wird außerhalb des Mutterleibs lebensfähig, weil sein Atemsystem schon funktioniert (wenn auch unzulänglich). Die Augen öffnen sich. (25cm groß)
- 28. Wo.: Die Augen sind ganz geöffnet, die Haare wachsen stärker, die Perinatalzeit beginnt.
4. Perinatalzeit➝
- 30. Wo.: Zehennägel sind ausgebildet. Fettpolster hat sich stark vermehrt.
- 32. Wo.: Die Haut wird rosig und glatt, die Extremitäten werden rundlicher.
- 36. Wo.: Auch der Körper wird rundlicher, jeden Tag lagern sich 14 g Fettgewebe ein.
- 38. Wo.: Geburtstermin. Viele Kinder werden 14 Tage vor oder nach diesem Termin geboren.
- Das Geburtsgewicht beträgt etwa 3000 - 4000 g und das Neugeborene ist 50 - 56 cm groß. Der kleine Körper ist noch von der Käseschmiere überzogen.
- Das System Schwangerschaft ist sehr störanfällig. 30% der befruchteten Eizellen sterben bereits vor der Einnistung ab. Nach der Nidation sterben noch weitere 12 - 15 % ab und 2% werden tot geboren.
- Dies geschieht aufgrund von Mutationen, Chromosomenabberationen und auch exogenen Faktoren (sowohl physische als auch psychische)➝Solche teratogenen Einflüsse können zu Mißbildungen führen, wobei die Dauer der Einwirkungen und die genetische Ausstattung von Mutter und Kind wichtig sind.
- Die Auswirkungen solch teratogener Einflüsse betreffen meist die Organe, die gerade angelegt werden oder sich in der größten Entwicklungsphase befinden.
- Teratogene Einflüsse➝
- Rauchen der Mutter➝Niedrigeres Geburtsgewicht, bis dato keine weiteren direkten Schäden nachgewiesen (Plazentadurchblutung verringert).
- Alkohol➝ Dringt problemlos in den kindlich-mütterlichen Kreislauf ein. Oft werden die Kinder mit weitem Augenstand und schmalen Augen geboren. Wahrscheinlich gibt es große Beeinträchtigungen im kognitiven Erleben und im Verhalten.
- Streß➝ Bei den Untersuchungen zur Streßwirkung gibt es methodische Probleme, da es komplizierte Wechselwirkungen zwischen Streß und Hormonhaushalt während der Schwangerschaft gibt. Die allgemeine Aussage, daß Streß schädlich ist kann (noch nicht) bewiesen werden.
- Ionisierende Strahlen➝ Alpha-, Beta-, Röntgenstrahlen
- Hypo-, und Hyperthermie während der Schwangerschaft
- Mechanische Faktoren➝Nidationsstörungen, Plazentastörungen, Abtreibungsversuche etc.
- Störungen der Sauerstoffversorgung➝Hypoxie, Hypoxämie
- Krankheiten, Fehlbildungen und Alter der Mutter
- Infektionen der Mutter➝Röteln, Poliomyelitis, Windpocken, Virusgrippe
- Bakterienerkrankungen der Mutter➝Toxoplasmose
- Ernährung der Mutter➝Vitaminmangel oder -überschuß (Vitamin A), Mangel an Spurenelementen
- Hormonale Disregulation bei der Mutter➝Diabetes
- Medikamente➝Analeptika, Analgetika, Morphin, Antibiotika, Antirheumatika (Salizylsäure), Chemotherapeutika, spezifische Hormone (Kortikosteroide, Androgene, Gestagene, Östrogene, Insulin), Narkotika (Äther), Barbiturate, etc..
- Impfstoffe➝Pocken, Poliomyelitis
- Rausch- und Suchtgifte
- Pestizide, Herbizide
- und andere chemische Substanzen (Kosmetika?)
2.2 Lernen
- Lernen ist eine exogene Steuerung von Entwicklung
- Lernen kann mehr oder weniger überdauernde Verhaltensänderungen aufgrund von Erfahrung, Übung und Beobachtung nach sich ziehen.
- Verhaltensänderungen werden auch durch vorübergehende physiologische Zustände beeinflußt➝Ermüdung, sensorische Adaptation, Medikamente und müssen von Lernprozessen abgegrenzt werden.
- Dies kann sich schwierig gestalten, weil der Lernprozeß aus dem Verhalten erschlossen werden muß und auch latent stattfinden kann, d.h. sich erst zu einem späteren Zeitpunkt im Verhalten zeigen kann.
- Lernprozesse wurden in vielen Forschungsparadigmen untersucht:
- Klassisches Konditionieren
- Instrumentelles/Operantes Konditionieren
- Lernen wurde sehr ausgiebig erforscht aufgrund der leichteren Beobachtbarkeit und der Möglichkeit der experimentellen Manipulation.
- Der Behaviorismus ging sogar davon aus, daß die ganze Entwicklungspsychologie eine überflüssige Domäne wäre, da Entwicklungspsychologie Lernpsychologie sei. Allerdings war diese verfrühte optimistische Einstellung nicht haltbar.
- Watson und auch Pawlow nahmen an, daß alle Mechanismen des Lernens ubiquitär sind, was nicht richtig ist.
- Kindheit und Jugend sind eine evolutionär stabile Strategie, die die Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbedingungen erhöht. Durch Erfahrungserwerb und Lernen sind keine starren Verhaltensschemata in dem Maße mehr erforderlich. Es gibt aber angelegte biologische Möglichkeiten, die in hohem Grade modifizierbar sind.
- Viel wurde auch in der Tierverhaltensforschung in Bezug auf Lernprozesse getan. Thorndike ➝ Law of effect: Hedonistische Verhaltensweisen/Reaktionen werden wiederholt (also solche Reaktionen, die zu einem unmittelbaren Lustgewinn führen oder solche, die einen unangenehmen Effekt vermeiden)
- Anatomisch-morphologisch ist Lernen ab der Geburt möglich und nachweisbar; eventuell auch pränatales Lernen. Obwohl das zentrale Nervensystem des Neugeborenen noch nicht voll funktioniert, ist vielleicht nur wenig Stimulation erforderlich, um die entsprechenden Pfade eine Gedächtnisspur generieren zu lassen.
2.2.1 Formen des Erfahrungserwerbs
Verschiedene Arten des Lernens:
- Assoziationslernen
- Sprachlernen
- Wahrnehmungslernen
- Kognitives Lernen
- Beobachtungslernen/Lernen am Modell
- Mediationslernen usw.
- Klassisches Konditionieren ➝Pionier Pawlow
Zuerst konditionierte er den Speichelfluß eines Hundes auf einen akustischen Reiz, der jeweils in den Konditionierungsdurchgängen unmittelbar vor einer Nahrungsaufnahme präsentiert wurde. Der Hund reagierte danach mit Speichelfluß sobald er den akustischen Reiz wahrnahm.
- Viele Versuche folgten in denen man versuchte die Bedingungen unter denen diese Konditionierung auf einen ehemals neutralen Reiz zu spezifizieren. Man variierte die Intervalle zwischen konditioniertem Reiz (CS) und unkonditioniertem Reiz (UCS➝der Reiz, auf den normalerweise die Reaktion erfolgt). Man fand das man auch einen zuvor konditionierten Stimulus benutzen konnte um auf einen weiteren neuen Stimulus zu konditionieren➝ Konditionierung höherer Ordnung.
- Die ersten Studien der Klassischen Konditionierung bei Kindern ➝ Krasnogorskii et al. 13
schlugen fehl, weshalb angenommen wurde, daß KK bei Säuglingen in den ersten 6 Monaten ausgeschlossen ist aufgrund der kortikalen Unreife.
- Denisova & Figurin 29 ➝zeigten aber, daß Säuglinge antizipatorisch Saugen, wenn sie in ihre gewohnte Fütterungshaltung gebracht werden.
- Marquis 41 ➝bewies aber die KK auf einen auditiven Reiz (Summton), der unmittelbar vor Gabe des Fläschchens präsentiert wurde schon bei Neugeborenen. Nach 5 Trainingstagen reagierten die Säuglinge mit Saugen bereits auf den Summton.
Außerdem konnte er auch die Temporale Konditionierung nachweisen, indem er Säuglinge, die an einen festen 3-Stunden-Fütterungsplan gewohnt waren auf einen 4-Stunden-Plan umstellte und mit einer Kontrollgruppe, die von vornherein alle 4 Std. gefüttert wurde, verglich. Die Experimentalgruppe zeigte während der 4. Stunde erhöhte Körperaktivität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand der Entwicklungspsychologie?
Die Entwicklungspsychologie befasst sich mit den Veränderungen im Erleben und Verhalten von Lebewesen (insbesondere Menschen) im Zusammenhang mit dem Lebensalter. Sie beinhaltet die Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und Beeinflussung intraindividueller Veränderungen sowie die interindividuellen Unterschiede dieser Veränderungen während der Ontogenese.
Welche formalen Merkmale kennzeichnen den Entwicklungsbegriff?
Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Entwicklung mit Veränderung/Wandel assoziiert, von einem Ausgangszustand über verschiedene Zwischenzustände zu einem Endzustand, wobei eine Ordnung in der Abfolge der Zwischenzustände besteht.
Wie grenzt sich die Entwicklungspsychologie von anderen Teildisziplinen der Psychologie ab?
Die Abgrenzung erfolgt primär durch die Bezugnahme auf das Lebensalter. Ursprünglich beschränkte sich die Betrachtung auf Kindheit und Jugend, später wurde die gesamte Lebensspanne einbezogen.
Welche zwei grundlegenden Entwicklungskonzeptionen gibt es seit der Antike?
1. Präformationstheorie: Die Endgestalt ist bereits im Keim festgelegt. 2. Epigenetische Theorien: Entwicklung bedeutet aufeinanderfolgende Neubildungen, deren Ausprägung durch innewohnende Lebenskraft und externe Einflüsse bestimmt wird. Es gibt keinen festgelegten Plan.
Wer waren wichtige Vorläufer und Wegbereiter der Entwicklungspsychologie?
Wichtige Persönlichkeiten sind John Locke, Jean Jacques Rousseau, Charles Darwin, Wilhelm Preyer und Dietrich Tiedemann, die durch ihre philosophischen Überlegungen, Kindertagebücher und empirischen Beobachtungen den Grundstein für die wissenschaftliche Entwicklungspsychologie legten.
Was sind die Kernpunkte der Child-Guidance- und Child-Welfare-Bewegung in den USA?
Die Child-Guidance-Bewegung bot praktische Erziehungsberatung für benachteiligte Kinder und Jugendliche, während die Child-Welfare-Bewegung wissenschaftliche Grundlagen für die Erziehung erarbeiten wollte und aufklärerische Absichten verfolgte.
Was kennzeichnet Längsschnittstudien in der Entwicklungspsychologie?
Längsschnittstudien untersuchen die Entwicklung von Individuen über einen längeren Zeitraum hinweg, um Aufschluss über die Stabilität/Instabilität von Entwicklungsverläufen zu erhalten und Vorhersagen über individuelle Entwicklungsverläufe zu treffen.
Was ist die Kernaussage des Behaviorismus bezüglich der Entwicklungspsychologie?
Der Behaviorismus betrachtete die Entwicklungspsychologie als überflüssig, da er alle Verhaltensweisen auf Reiz-Reaktions-Muster zurückführte und die Bedeutung von Lernprozessen betonte.
Was sind "Developmental Tasks" (Entwicklungsaufgaben) nach Havighurst?
Entwicklungsaufgaben treten in einer bestimmten Lebensperiode auf und führen bei erfolgreicher Bewältigung zu Glück und Zufriedenheit. Nichtbewältigung führt zu Unzufriedenheit und Schwierigkeiten bei späteren Entwicklungsaufgaben.
Welche gegenwärtigen Trends prägen die Entwicklungspsychologie?
Gegenwärtig liegt ein großes Interesse an der Erklärung der Entwicklung, den Mechanismen und Bedingungen, differenzierteren Einflussfaktoren, der Lebensspannenorientierung, Spezialisierung der Themen, interdisziplinärer Ausrichtung, Betrachtung von Verhalten als unabhängige Variable, dem Einfluss kognitiver Wissenschaften, neuen Interesse an Längsschnittmethoden, der Berücksichtigung des ökologischen Kontextes, differentielle Entwicklungsverläufe, Bevorzugung der Beobachtungsmethoden und historischen Wandel der Entwicklungsphänomene.
Welche Rolle spielt das Lebensalter in der Entwicklungspsychologie?
Verhaltensveränderungen sind nur dann Gegenstand der Entwicklungspsychologie, wenn sie regelhaftig auf das Lebensalter bezogen werden können. Das Alter selbst hat keinen direkten Einfluss, sondern die zu einem bestimmten Zeitpunkt eintretenden sozialen und Umwelteinflüsse sowie der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes sind entscheidend.
Was sind "vulnerable/sensible Phasen" in der Entwicklung?
Vulnerable/sensible Phasen sind altersgebundene Zeiträume, in denen bestimmte Entwicklungsschritte erfolgen müssen, da sie später nicht oder nur unzureichend aufgeholt werden können.
Welche grundlegenden Fragen werden in der Entwicklungspsychologie gestellt?
Die Grundfragen beziehen sich auf Inhalt (Was verändert sich?), Verlauf (Wie verändert sich die Entwicklungsvariable?) und Steuerung der Entwicklung (Wodurch kommen Veränderungen zustande?).
Was bedeutet "Wachstum" im entwicklungspsychologischen Kontext?
Wachstum bezeichnet rein quantitative Veränderungen eines Organismus in Bezug auf Größe, Volumen und Menge, sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht.
Was ist "Reifung" und wie unterscheidet sie sich von Wachstum?
Reifung bezeichnet Vorgänge, die spontan, aufgrund endogen vorprogrammierter, d.h. durch Vererbung determinierter, innengesteuerter Wachstumsimpulse einsetzen und vorwiegend von diesen gesteuert werden. Sie sind relativ unabhängig von exogenen Faktoren, während Wachstum quantitative Veränderungen beschreibt, unabhängig von den zugrunde liegenden Prozessen.
Welche Indikatoren sprechen für die Wirksamkeit von Reifungsprozessen?
Universelles Auftreten, Auftreten in einem eng umgrenzten Altersbereich, Nachholbarkeit, Unumkehrbarkeit und fehlender Vorteil durch besondere Stimulation/Training.
Was bedeutet "Differenzierung" in Bezug auf Entwicklung?
Differenzierung beschreibt die fortschreitende Ausgliederung unähnlicher Teilgebiete aus einem anfänglich ungegliederten, einheitlichen Ganzen.
Was ist "Prägung" und welche Merkmale kennzeichnen sie?
Prägung ist ein einmaliger, irreversibler Vorgang der Spezialisierung eines Auslöseschemas für bestimmte Instinkthandlungen, der nur während einer kurzen Zeitspanne (kritische/sensible Periode) stattfinden kann. Merkmale sind u.a. Verschränkung angelegter Reaktionsmuster mit Reizgegebenheiten der Umwelt, Begrenzung der Einwirkungsmöglichkeit der Umwelt auf eine genetisch determinierte Zeitspanne, Stabilität und Irreversibilität.
Was ist "Sozialisation" und welche Modelle gibt es?
Sozialisation ist der umfassende Titel für den hypothetischen Prozess des sozialen Lernens, der durch wechselseitige Interaktion zwischen voneinander abhängigen Personen gekennzeichnet ist. Es gibt verschiedene Modelle, darunter das Trichtermodell, Rollentheorien der Sozialisation, Sozialisation als Abfolge und Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und das bidirektionale Modell der Sozialisation.
Welche biologischen Grundlagen prägen die menschliche Entwicklung?
Evolution, Genetik, Vererbung, Embryonal- und Fetalentwicklung sind grundlegende biologische Prozesse, die die Entwicklung des Menschen maßgeblich beeinflussen.
Was sind Mutationen, Rekombination und Selektion im Kontext der Evolution?
Mutationen sind zufällige Veränderungen des genetischen Materials. Rekombination ist die Neukombination von Genen während der sexuellen Fortpflanzung. Selektion ist der Prozess, bei dem Individuen mit vorteilhaften Merkmalen eher überleben und sich fortpflanzen.
Was ist die Phenylketonurie und wie wird sie behandelt?
Phenylketonurie ist eine Stoffwechselstörung, bei der die Aminosäure Phenylalanin nicht abgebaut werden kann, was zu geistiger Behinderung führt. Sie wird durch eine phenylalaninarme Diät behandelt.
Was ist die Meiose?
Bei der Teilung durch Mitose wird das genetische Material verdoppelt und auf die Tochterzellen verteilt, so daß hinterher zwei identische Zellen vorliegen (falls keine Mutation vorliegt)
Was ist der Cross-Over?
Die Punkte an denen sich die homologen Chromosomen überkreuzen nennt man Chiasmata, den Vorgang des Austauschs Cross- Over
Was bedeutet "Lernen" im entwicklungspsychologischen Sinn?
Lernen ist eine exogene Steuerung von Entwicklung. Es bezeichnet mehr oder weniger überdauernde Verhaltensänderungen aufgrund von Erfahrung, Übung und Beobachtung.
Welche Formen des Erfahrungserwerbs gibt es?
Es gibt verschiedene Arten des Lernens, darunter Assoziationslernen, Sprachlernen, Wahrnehmungslernen, kognitives Lernen, Beobachtungslernen/Lernen am Modell und Mediationslernen.
- Quote paper
- Cornelia Kortmann (Author), 2001, Entwicklungspsychologie Vorlesungen 1+2, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104782