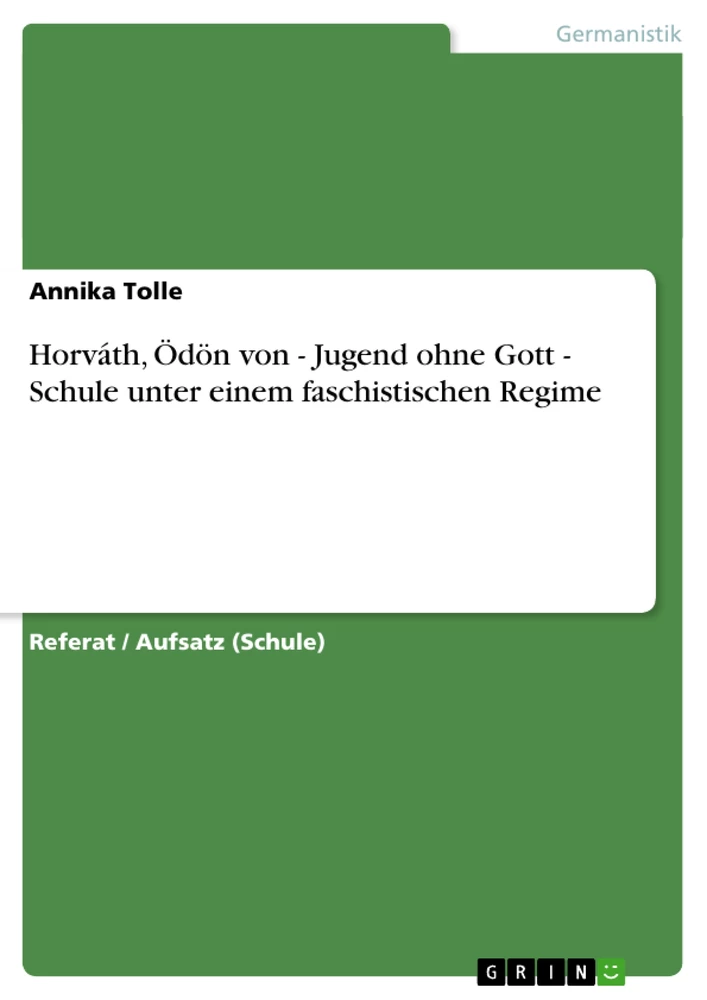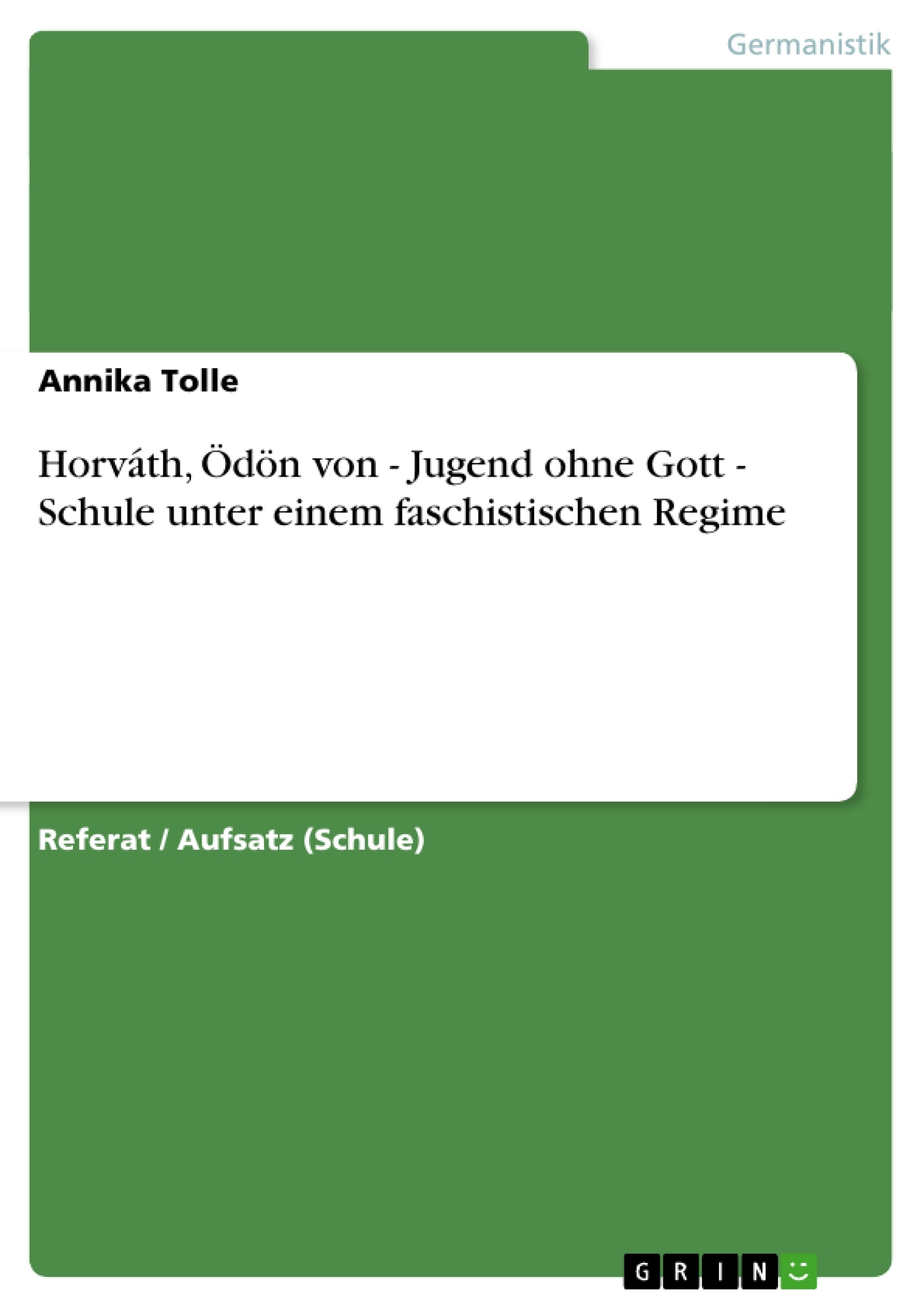In einer Zeit ideologischer Verblendung und moralischen Verfalls, wo das Echo von Propaganda lauter hallt als der Ruf der Menschlichkeit, steht ein Lehrer am Scheideweg. Ödön von Horváths "Jugend ohne Gott" ist mehr als nur eine Geschichte; es ist ein erschütterndes Zeugnis der Verführungskraft des Faschismus und der stillen Rebellion des Gewissens. Begleiten Sie einen Geschichtslehrer im Deutschland der 1930er-Jahre, der sich in einem Netz aus Angst und Anpassung wiederfindet. Seine Schüler, indoktriniert mit Hass und blindem Gehorsam, spiegeln die dunkle Realität einer Gesellschaft wider, die ihre Seele verkauft hat. Als ein Mord das Klassenzimmer erschüttert, wird der Lehrer gezwungen, sich seiner eigenen Feigheit zu stellen und die Wahrheit zu suchen, selbst wenn diese ihn alles kostet. Tauchen Sie ein in eine beklemmende Atmosphäre von Misstrauen und Verrat, in der Freundschaften zerbrechen und Ideale auf dem Altar der Ideologie geopfert werden. "Jugend ohne Gott" ist ein zeitloser Roman über Schuld, Sühne und die Bedeutung, in einer Welt der Unmenschlichkeit Mensch zu bleiben. Erleben Sie, wie ein Mann seinen Glauben an die Menschheit wiederentdeckt, während um ihn herum alles zusammenbricht. Eine fesselnde Erzählung über die Verstrickungen des Einzelnen in totalitären Systemen, die zum Nachdenken über Zivilcourage, Widerstand und die Verantwortung jedes Einzelnen in dunklen Zeiten anregt. Die Geschichte beleuchtet auf erschreckende Weise, wie politische Ideologien die Jugend manipulieren und zu Grausamkeiten verleiten können. "Jugend ohne Gott" ist nicht nur ein Roman über die NS-Zeit, sondern auch ein Spiegel für unsere heutige Gesellschaft, in der Populismus und Extremismus wieder an Boden gewinnen. Es ist eine Mahnung, wachsam zu bleiben und für unsere Werte einzustehen, bevor es zu spät ist. Die spannungsgeladene Handlung, die psychologisch tiefgründigen Charaktere und die zeitlose Thematik machen diesen Roman zu einem Muss für jeden, der sich mit den dunklen Kapiteln der Geschichte auseinandersetzen und die Lehren daraus für die Zukunft ziehen möchte.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Der Autor: Ödön von Horváth
2. Der Roman: Jugend ohne Gott
2.1 Inhaltsangabe
2.2 Machart
2.3 Die Intention des Autors
3. Schule unter einem faschistischen Regime
3.1 Schule im faschistischen Deutschland
3.2 Die Lehrer
3.2.1 Der Ich - Erzähler
3.2.2 Julius Caesar
3.3 Die Schüler
3.3.1 Der Z
3.3.2 Der N
3.3.3 Der T
3.3.4 Der Klub
3.3.5 Die Problematik der Jugend ohne Gott
3.4 Der Realismus des Romanendes
Schluss
Literaturverzeichnis
Einleitung
Wir müssen von der Jugend alles fernhalten, was nur in irgendeiner Weise ihre zukünftigen militärischen Fähigkeiten beeinträchtigen könnte - das heißt: wir müssen sie moralisch zum Krieg erziehen. Punkt!1
Diesen Satz könnte man als Schlüsselzitat des Romans Jugend ohne Gott bezeichnen, da er viele Informationen enthält, die für das Thema Schule unter einem faschistischen Regime von Bedeutung sind. In dieser Facharbeit soll deutlich gemacht werden, wie sich viele Schüler und Lehrer während des Nationalsozialismus verhalten haben und wie sie miteinander umgegangen sind. Denn auch damals gab es unter Lehrern und Schülern zwei verschiedene Einstellungen: die einen unterwarfen sich dem politischen System und schlossen sich einfach der Mehrheit an, die anderen versuchten ihre eigene Meinung zu behalten und sich nicht von den Nazis einwickeln zu lassen. Und kein anderer Roman wäre für diese Darstellung des Schulsystems besser geeignet als Ödön von Horváths Jugend ohne Gott.
Ich habe Interesse an diesem Thema, da ich als Deutsche sehr häufig mit dem Nationalsozialismus konfrontiert werde, sei es in der Schule oder einfach auf der Straße, denn die rechten Gruppen in Deutschland werden immer stärker. Gerade der Teil Schule ist interessant, da sich das Schulsystem von damals in vielerlei Hinsicht von unserem heutigen abhebt. Interessant finde ich, einmal zu recherchieren, wie sich die Schüler unter der Herrschaft der Nazis verhalten haben, da es für mich heute kaum noch nachzuvollziehen ist, wie man sich einer Macht so einfach unterwerfen konnte. Ich denke es ist klar, dass ich mich bei meinen Recherchen nur auf den deutschen Nationalsozialismus beschränke, da das für mich als Deutsche am interessantesten ist. Trotzdem sind meine Ergebnisse auch auf andere faschistische Länder übertragbar, da in fast allen Ländern nach den gleichen Prinzipien gehandelt wurde.
Den Schwerpunkt meiner Arbeit habe ich auf die Lehrer und Schüler in Jugend ohne Gott gelegt, da diese beiden Gruppen die Hauptträger des Schulsystems sind und deren Ansichten und Einstellungen deswegen wichtig sind.
1. Der Autor: Ödön von Horváth
Ödön von Horváth (eigentlicher Name: Edmund Josef von Horváth) wurde am 9.Dezember 1901 um 4:45 Uhr in Susak bei Fiume - dem heutigen Rijeka - in Kroatien, dem damaligen Jugoslawien, geboren. Seine Eltern waren der Diplomat Dr. Edmund Josef Horváth und Maria Hermine Prehnal, sein jüngerer Bruder hieß Lajos. Nachdem Horváth ein erzbischöfliches Internat in Budapest besuchte, zog er 1913 nach München zu seiner Familie, die schon länger dort lebte, weil Horváths Vater dort arbeitete. Erst mit 14 Jahren schrieb Horváth den ersten deutschen Satz, da er so oft umziehen musste, dass er nie eine Sprache richtig lernen konnte. 1916 zog die Familie nach Pressburg und 1918 wieder nach Budapest. Nachdem seine Familie Ungarn verlassen hatte, lebte Horváth bei seinem Onkel in Wien, wo er das Abitur machte und danach ging er nach München, wo er bis 1921/22 Theaterwissenschaften, Germanistik und Philosophie studierte. In München schrieb er einige Werke, von denen er sich dann aber wieder distanzierte und sie vernichtete. Bald darauf beschloss Horváth sich in Berlin niederzulassen, weil er glaubte, dort den Stoff für seine Stücke zu finden. 1927 schrieb er die Historie Sladek oder die schwarze Armee, worin er die politischen und sozialen Zeitumstände deutlich machte und dadurch die Nationalsozialisten provozierte. 1929 fand die Uraufführung der Bergbahn statt, worin Horváth den Kampf zwischen Kapital und Arbeit beschrieb. Als nächstes beendete Horváth 1930 den Roman Der ewige Spießer. Das Jahr 1931 wurde für Horváth das erfolgreichste Jahr. So fand in diesem Jahr die Uraufführung des Stückes Geschichten aus dem Wiener Wald statt und Horváth erhielt den Kleistpreis für seine Kritik am Nationalsozialismus, wodurch er sich den Zorn der Nazis zuzog. 1932 stellte Horváth die Stücke Kasimir und Karoline und Glaube Liebe Hoffnung fertig.
Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 wurden Horváths Stücke an den deutschen Bühnen abgesetzt. Daraufhin verließ Horváth Deutschland und fuhr zuerst nach Salzburg, dann nach Wien. Von Wien aus fuhr er nach Budapest, um die ungarische Staatsbürgerschaft zu behalten. 1934 wurden Horváths Stücke auch an österreichischen Theatern verboten. Noch im gleichen Jahr zog er zurück nach Berlin, wo er versuchte, sich durch Briefe und die Vermeidung jeder öffentlichen Kritik mit den Nazis zu arrangieren. Das Aufführungsverbot für Horváths Stücke blieb aber trotzdem bestehen. 1937 schrieb er in Henndorf bei Salzburg den Roman Jugend ohne Gott. Ein paar Monate später, am 28.Mai 1938, ging Horváth nach Paris, wo er sich zu Verhandlungen über eine Verfilmung seines Romans Jugend ohne Gott treffen wollte. Bei einem Gewitter am 1. Juni 1938 wurde Horváth auf dem Champs - Èlysées von einem herunterfallenden Ast erschlagen.
2. Der Roman
2.1 Inhaltsangabe
Die Handlung setzt am 34. Geburtstag des Erzählers ein und zeigt uns das Bild eines Gymnasiallehrers für Geschichte und Geographie, der gerade Aufsätze korrigiert, in welchen sehr menschenverachtende und fremdenfeindliche Ansichten der Schüler deutlich werden. Obwohl der Lehrer diese Antworten für schrecklich falsch hält, darf er die Aufsätze jedoch nicht verbessern, da die Schüler nur das aufgeschrieben haben, was sie täglich im Radio hören und was das gesamte Volk für richtig halten sollte. Bei der Rückgabe kann der Lehrer sich jedoch nicht zurückhalten und teilt einem Schüler mit, dass seine Arbeit völlig falsche Ansätze hätte, woraufhin er eine Verwarnung des Direktors bekommt. Danach fangen die Schüler an den Lehrer zu bespitzeln, um ihn zu hintergehen. Der Lehrer bleibt aber stark und lässt sich von seinen Schülern nicht unterkriegen. Kurz nach diesem Zwischenfall fährt die ganze Klasse mit dem Lehrer in ein Zeltlager, dass der vormilitärischen Ausbildung der Jugendlichen dienen soll. Der Lehrer ist innerlich entsetzt, als er sieht, wie die Jungen marschieren und mit Waffen hantieren. Später wird er Zeuge eines Überfalls von zwei Jungen und einem Mädchen auf eine alte blinde Frau. Als er merkt, dass sich sein Schüler Z heimlich mit Eva, der Anführerin der Räuberbande, trifft, wird er neugierig und bricht am nächsten Tag das Kästchen auf, in dem sich das Tagebuch des Z befindet. Darin liest er von einer Liebesbeziehung zwischen dem Z und Eva und an dessen Schluss steht: „Jeder, der mein Kästchen anrührt, stirbt!“2. Nachdem der Lehrer das Tagebuch gelesen hat, gelingt es ihm jedoch nicht, das Kästchen wieder richtig zu verschließen und der Z bemerkt, dass jemand in seinem Tagebuch gelesen hat. Er beschuldigt jedoch den N, der mit ihm das Zelt teilt. Der Lehrer hat zwar ein schlechtes Gewissen, sagt dem Z aber nicht, dass er das Kästchen aufgebrochen hat. Er bemerkt, dass der T die ganze Sache genauestens verfolgt. Kurze Zeit später wird der N ermordet aufgefunden und es stellt sich heraus, dass Eva und Z an dem Mord beteiligt sind.
Im Laufe des Prozesses gibt der Z, obwohl er unschuldig ist, den Mord zu, weil er denkt Eva habe N ermordet und er sie aus Liebe schützen will. Da der Lehrer darauf als Zeuge aussagen muss, kann er sein Geheimnis nicht länger bewahren und gibt zu, dass er das Kästchen aufgebrochen hat. Als der Verdacht dann schließlich auf Eva fällt, gibt sie zu Protokoll, dass sie gesehen habe, wie plötzlich ein Junge mit Fischaugen aufgetaucht sei und den N erschlagen habe. Sofort fällt der Verdacht des Lehrers auf den T, von dem er sich schon immer beobachtet fühlte. Ein paar Tage später kommt ein anderer Schüler aus seiner Klasse zu ihm, der gerade mit ein paar anderen einen antifaschistischen Klub gegründet hat, und erzählt dem Lehrer, dass er glaube, der T hätte den N ermordet. Zum Schluss gelingt es dem Lehrer mit Hilfe seiner Schüler den T, der sich jedoch erhängt, als er merkt, dass der Lehrer auf seiner Spur ist, als den Mörder des N zu entlarven. Nachdem der Fall sich dann endgültig aufgeklärt hat, nimmt der Lehrer ein Stellenangebot als Lehrer an einer Missionarsschule in Afrika an, da er seinen Beruf, nach allem, was passiert war, in seiner Heimat nicht mehr ausüben darf.
2.2 Machart
Der Roman wird von einem Ich-Erzähler, aus der Erzählperspektive des Lehrers erzählt, was dem Leser einen guten Eindruck über Gefühle und Ansichten der Hauptperson gibt. Da die Sichtweise des Erzähler sehr eingeschränkt ist, versucht Horváth mit Hilfe von Dialogen und „Figurenperspektiven“3 auch die Ansichten der anderen Personen deutlich zu machen. So erfährt der Leser zum Beispiel durch das Tagebuch des Z von dessen Gefühlen und Gedanken und von den Vorgängen im Lager bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Den Roman könnte man zudem in zwei Erzählebenen unterteilen. Erstens die Handlungsebene, in der der Leser erfährt, was geschieht und wie sich die Dinge entwickeln und zweitens die Reflexionsebene, in der der Leser Gedanken und Reflexionen des Lehrers erfährt.
Die 149 Seiten des Romans Jugend ohne Gott lassen sich außerdem in drei größere Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt umfasst 34 Seiten und enthält Informationen über die ganze Situation des Lehrers und dessen Umfeld, wie zum Beispiel die Schule und die Schüler. Im zweiten Abschnitt, der 48 Seiten lang ist, dreht sich alles um das Ferienlager und die Ereignisse dort und der dritte Abschnitt, mit 66 Seiten am längsten, erzählt von dem Prozess und dessen Folgen.
Die Überschriften der Kapitel sind mit dem Kapitelinhalt, besonders durch Wortwiederholungen mit dem Kapitelschluss verbunden. Die Verknüpfung der Kapitel gelingt Horváth, indem er Formulierungen vom Ende eines Kapitels an den Anfang des nächsten stellt. Viele Kapitelüberschriften enthalten über die Information, um was es in diesem Kapitel geht hinaus auch metaphorische Bedeutung, so dass jeder Leser sich ein eigenes Bild bezüglich des Kapitelinhalts machen kann.
Horváths Sprache in dem Roman zeichnet sich aus durch Einwortsätze, Parataxen, wie zum Beispiel „Er weint./ Ich werfe einen Blick auf Gott./ Er lächelt./ Warum?“4, und Auslassungen, bzw. Verkürzungen. Auffällig bei der Tempuswahl Horváths ist, dass er häufig zwischen Präsens und Präteritum hin und her wechselt. Diesen Wechsel nimmt er vor, um Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, zu vergegenwärtigen.
In gewisser Weise könnte man auch von einer Art Tagebuchform sprechen die Horváth verwendet. So erzählt der Ich - Erzähler die Ereignisse nämlich in chronologischer Reihenfolge und nennt ab und zu genaue Daten, wie man es in einem Tagebuch tut: „25. März.“5.
2.3 Die Intention des Autors
Nachdem Horváths Stücke an deutschen und österreichischen Theatern verboten wurden, ging er über ein paar Umwege nach Henndorf bei Salzburg. Da er seine Arbeit bis zu diesem Zeitpunkt nicht richtig ausführen konnte, hatte Horváth Geldsorgen: „Ich muß dies Buch schreiben. Es eilt, es eilt! Ich habe keine Zeit, dicke Bücher zu lesen, denn ich bin arm und muß arbeiten, um Geld zu verdienen, um essen zu können, zu schlafen.[...]“6. Und so schrieb er über das Thema, was ihm am nähesten lag: den Nationalsozialismus. Kaum jemand hatte so viele Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus gemacht, wie Horváth, der Deutschland aufgrund seiner Provokationen gegenüber den Nazis öfters verlassen musste und die ganze Vorgeschichte des Nationalsozialismus’ hautnah erlebt hat.
Der Grund dafür, warum er nach so vielen Theaterstücken plötzlich ein Prosawerk schrieb, liegt darin, dass es wenig Sinn hatte Theaterstücke zu schreiben, die hinterher dann doch nicht aufgeführt werden durften, da der Name Horváth auf der Liste des „schändlichen und unerwünschten Schrifttums“ stand. Horváth sagte dazu selbst: „[...] das Stückeschreiben ist für uns Spielschreiber deutscher Sprache vorderhand sinnlos geworden, weil wir kein Theater mehr haben, das uns bringt!“7.
Insgesamt kann man Jugend ohne Gott als eine Faschismuskritik bezeichnen, in welcher Horváth den Menschen und sein Verhalten in dieser schweren Zeit zeigen will, wie er 1937 auch seinem Freund Franz Theodor Csokor schrieb:
[...] Es ist mir dabei noch etwas aufgefallen, nämlich daß ich, ohne Absicht, auch zum erstenmal den sozusagen faschistischen Menschen (in der Person des Lehrers) geschildert habe, an den [sic!] die Zweifel nagen - - oder besser gesagt: den Menschen im faschistischen Staate.[...]8
3. Schule unter einem faschistischen Regime
3.1 Schule im faschistischen Deutschland
Der Völkische Staat hat [...] seine gesamte Erziehungsarbeit in erster Linie [...] einzustellen [...] auf das Heranzüchten kerngesunder Körper. Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung der geistigen Fähigkeiten. Hier aber wieder an der Spitze die Entwicklung des Charakters, besonders die Förderung der Willens- und Entschlußkraft , verbunden mit der Erziehung zur Verantwortungsfreudigkeit, und erst als letztes die wissenschaftliche Schulung.9
Dieses Zitat spiegelt sehr gut wieder, was Hitler unter Erziehung verstand. Er sah nämlich Erziehung nicht in seiner eigentlichen Bedeutung, als „sozialen Umgang zwischen Menschen mit dem Ziel, zu Erziehende (zumeist Kinder und Jugendliche) an gültige gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen heranzuführen sowie eine freie und unabhängige Persönlichkeit herauszubilden“10, sondern eher als ein Heranzüchten von Soldaten, die freudig in den Tod gehen sollten. Die Entwicklung der Persönlichkeit des Einzelnen lehnte Hitler immer ab, da er ein großes Volk mit einem gemeinsamen Denken formen wollte. Während vieles, was Hitler und seine Propaganda versprachen, Lügen waren, hatte er im Hinblick auf Erziehungsziele und - methoden sehr menschenverachtende Ansichten, die er durchaus offen aussprach. So formulierte er sie nicht in Geheimreden, sondern in hunderttausendfach verbreiteten Publikationen. Das Ziel sämtlicher Einrichtungen der Erziehung war es „gegebenes Menschenmaterial zu schleifen“11. So sollten die Jungen zu Soldaten und die Mädchen zu Frauen erzogen werden, die wieder Männer zur Welt bringen. Während Hitler einerseits die völlige Unfreiheit und Entwürdigung seiner Untertanen forderte und verwirklichte, verstand seine Propaganda es zusätzlich, diesen Untertanen das Gefühl zu geben, sie seien die wahren Herren der Welt. Hitler verlangte folgendes von der Erziehung des Jugendlichen: „Seine gesamte Erziehung und Ausbildung muß darauf angelegt werden, ihm die Überzeugung zu geben, anderen unbedingt überlegen zu sein.“12.
3.2 Die Lehrer
3.2.1 Der Ich - Erzähler
Der Lehrer spielt in der ganzen Handlung eine sehr wichtige Rolle, da er auch noch der Erzähler des Romans ist. Er ist 34 Jahre alt und Lehrer an einem städtischen Gymnasium. Sehr auffällig ist gleich zu Beginn der Handlung, dass er mit seiner Stelle als Lehrer nicht zufrieden ist: „Nein, zufrieden bin ich eigentlich nicht.“13. Diese Unzufriedenheit will und darf er jedoch nach außen nicht zeigen, da er eigentlich froh sein müsste, dass er überhaupt einen Job hat: „Du hast doch eine sichere Stellung mit Pensionsberechtigung und das ist doch in der heutigen Zeit, wo niemand weiß, ob sich morgen die Erde noch drehen wird, allerhand!“14. Der Grund dafür, dass der Lehrer mit seiner Stelle unzufrieden ist, ist seine Abneigung gegen die Nazis und gegen das gesamte politische System: „Wenn ich in der Zeitung lese, daß einer von denen umgekommen ist, denke ich: ‚Zu wenig! Zu wenig!’“15.
Obwohl er es eigentlich nicht mit sich vereinbaren kann, muss er den Schülern falsche, menschenverachtende, aber vorgegebene Themen beibringen, ohne sich dagegen wehren zu können:
Ich werde mich hüten als städtischer Beamter, an diesem lieblichen Gesange auch nur die leiseste Kritik zu üben! Wenns auch weh tut, was vermag der einzelne gegen alle? Er kann sich nur heimlich ärgern.16
Darin erkennt man aber auch wie feige der Lehrer eigentlich ist. Anstatt seine Ansichten über das System, welches ihm verhasst ist, offen mitzuteilen, nimmt er es lieber so hin wie es ist. Er findet es schrecklich, dass es möglich ist, eine ganze Gesellschaft so zu beeinflussen, dass sie alles, was man ihr erzählt glaubt und danach handelt: „Und während ich weiterlese, höre ich immer das Radio: es lispelt, es heult, es bellt, es girrt, es droht - und die Zeitungen drucken es nach und die Kindlein, sie schreiben es ab.“17. Dabei tut der Lehrer eigentlich nichts anderes, als nach Befehlen zu handeln.
Außerdem merkt man schnell, dass zwischen dem Lehrer und seinen Schülern eine gewisse Distanz besteht. So redet er sie zum Beispiel immer nur mit dem Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens an, wenn er über sie redet. Diese Distanz resultiert sicher aus den verschiedenen Idealen der Schüler und des Lehrers: „Ich rede eine andere Sprache.“18. Während der Lehrer sehr humanistisch denkt und versucht dieses Denken auch seinen Schülern zu vermitteln, stößt er bei ihnen auf harten Widerstand, da die Schüler nur das zu dieser Zeit herrschende Ideal akzeptieren. Jeder Versuch des Lehrers seinen Schülern ein kleines Stück seiner humanistischen Vorstellungen zu vermitteln scheitert und endet meist zum Nachteil des Lehrers. Ein Beispiel hierfür ist der Versuch einem Schüler beizubringen, dass Neger auch Menschen sind, worauf er sofort eine Verwarnung des Direktors bekommt.
Der Lehrer ist außerdem eine entscheidende Romanfigur, da er während der Handlung eine starke Entwicklung durchmacht. Nachdem sein Leben am Romananfang von Feigheit19 und Passivität geprägt ist, sagt er im Prozess am Romanende doch noch die Wahrheit, ohne an die Konsequenzen zu denken. Dies tut er, da er plötzlich wieder den Glauben an Gott gefunden hat. Der Lehrer glaubte nämlich schon lange nicht mehr an Gott, da der wahre Gott, seiner Meinung nach, das ganze Unheil, das zu dieser Zeit geschah, nicht zugelassen hätte:
„Komisch: ich glaube an den Teufel, aber nicht an den lieben Gott.“20. In einer Verhandlungspause hört er ihn dann jedoch zu sich sprechen und befolgt seinen Rat auszusagen: „Die Zeit, in der ich an keinen Gott glaubte, ist vorbei. Heute glaube ich an ihn.“21.
Auch im Bezug auf Eva verändert sich der Lehrer. Aus der anfangs sexuellen Begierde: „Sie muß einen schönen Rücken haben. [...] Sie gefällt mir immer mehr. [...] Sie hat herrliche Beine. [...]“22 wird Nächstenliebe: „Ich möchte ihr helfen, damit sie nicht friert.“23. Insgesamt ist der Lehrer eine sehr wandlungsfähige Person, die eine starke Abneigung gegen das ganze nationalsozialistische System hat.
3.2.2 Julius Caesar
Julius Caesar ist 60 Jahre alt und ein alter Kollege des Lehrers. Er war Altphilologe in einem Mädchenlyzeum, bevor er ein Verhältnis mit einer minderjährigen Schülerin hatte und dadurch vom Dienst suspendiert wurde. Deshalb bezeichnet ihn der Erzähler als „gestrandete Existenz“24. Nun verdient er sein Geld als Hausierer, der versucht den Leuten allen möglichen Schund zu verkaufen. Im Text nennt ihn der Erzähler auch einen Erotomanen25, da er versucht dem Lehrer den Unterschied der drei Generationen mit Hilfe des von Generation zu Generation immer geringer werdenden Verlangens nach Frauen deutlich zu machen. Als die drei Generationen bezeichnet Caesar hierbei die seine, die des Lehrers und die der Schüler. Er ist nämlich der Meinung, dass die Jugend von heute „keine korrekte Pubertät mehr hat [...]“26, da „[...] für die das Weib überhaupt kein Problem mehr [ist], denn es gibt keine wahrhaften Frauen mehr, es gibt nur lernende, rudernde, gymnastiktreibende, marschierende Ungeheuer!“27. Ihm ist die Jugend also, genauso wie dem Lehrer, suspekt. Hier sieht man eine deutliche Parallele zum Lehrer, da Julius Caesar die gleichen Ansichten vertritt. Jedoch ist er im Verhältnis zum Lehrer sehr einseitig, da er nicht bereit ist seine Meinung über die Jugend zu ändern. Caesar selbst bezeichnet sich außerdem als Amateurastrologen und prophezeit das Zeitalter der Fische, in welchem „die Seele des Menschen unbeweglich wie das Antlitz eines Fisches“28 wird und „kalte Zeiten“29 kommen. Er meint damit das Zeitalter des Nationalsozialismus und einen gewissen Egoismus, den die Jugend, „deren einzige Ideale Hohn und Spott sind“30, besitzt. Man könnte auch vermuten, dass Julius Caesar schon eine Vorahnung auf das hat, was passiert, nämlich den anschließenden Mord an N, obwohl das völlig unmöglich ist, da Julius Caesar überhaupt nicht weiß, was zur Zeit im Umfeld des Lehrers geschieht.
Abschließend ist zu sagen, dass Julius Caesar ein Mensch ist, der in einer völlig anderen Zeit aufgewachsen ist und so auch nicht richtig nachvollziehen kann, was mit der heutigen Jugend geschieht.
3.3 Die Schüler
3.3.1 Der Z
Der Z ist ein Schüler aus der Klasse des Lehrers, der im ersten Teil des Romans überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Erst im Zusammenhang mit den Ereignissen im Zeltlager tritt er in den Vordergrund. Es ist wichtig über ihn Bescheid zu wissen, da er sich in einigen Punkten von seinen Mitschülern abhebt. Im Roman wird er als Junge beschrieben, der von einem starken Individualismus geprägt ist, so steht er zum Beispiel beim Exerzieren zu weit vorn und lässt sich „schwer einreihen“31, trotzdem wirkt er aber ziemlich unauffällig. Außerdem führt er Tagebuch und macht sich sein eigenes Bild von allem, was um ihn herum geschieht: „Er denkt über sich nach, hat er gesagt.“32. Das unterscheidet ihn sehr stark von seinen Mitschülern, die sich völlig von dem System einwickeln lassen und nur das tun, was man ihnen befiehlt. Gerade durch sein Tagebuch wirkt er menschlicher und durchschaubarer als die anderen Schüler, da man durch sein Tagebuch weiß, was er denkt und fühlt: „[...] ich soll die Kerze auslöschen, aber ich tus nicht, weil ich sonst überhaupt zu keinem Tagebuch mehr komme und ich möcht doch eine Erinnerung fürs Leben.“33. Das macht ihn auch in irgendeiner Weise sympathisch. Auch beim Z kann man Parallelen zum Ich-Erzähler entdecken. So passt er sich meistens an, reflektiert sehr viel und hat eine Abneigung gegenüber den Plebejern: „[Lehrer:] Warum raufst du immer mit den N? [Z:] Weil er ein Plebejer ist.“34, wobei die Metapher der Plebejer hier für „den Aufstieg einer bestimmten sozialen Schicht zur Macht“35 steht. Obwohl er unter starkem Druck des N steht, der ihn hasst, da der Z die ganze Nacht hindurch in sein Tagebuch schreibt und der N deshalb nicht schlafen kann, lässt er sich nicht davon abbringen sein Tagebuch zu führen. Das lässt darauf schließen, dass er eine sehr willensstarke Person ist. Außerdem ist er verbal und körperlich sehr aggressiv: „Heute Nachmittag hab ich mit dem N gerauft, ich bring ihn noch um. Der R hat dabei was abbekommen, was stellt sich der Idiot in den Weg!/ Der N ist rot, er blutet aus dem Mund.“36. Von seinen Mitschülern unterscheidet ihn seine Erfahrungen mit der Liebe, die er mit Eva sammelt: „Dann umarmte sie mich wieder und wir waren zusammen. Dabei fragte sie mich, was tun wir jetzt? Ich sagte, wir lieben uns.“37.
Einen vollkommen anderen Z erlebt man dann während der Gerichtsverhandlung. Hier gibt er sich als vernachlässigter und einsamer Junge: „Das ist doch keine Mutter! [...] Nie kümmert sie sich um mich, immer nur um ihre Dienstboten![...]“38. Das Verhältnis zu seiner Mutter ist sehr gespannt, da er es schrecklich findet, dass seine Mutter die Dienstboten schlecht behandelt und da er seit dem Tod seines Vaters, der immer auf seiner Seite stand, alleine gegen die gemeinen Machenschaften seiner Mutter ankämpften muss. Außerdem hat der Z sehr naive Vorstellungen im Bezug auf Eva. Er hat sich schwer in sie verliebt und hofft, dass er für immer mit Eva zusammenbleiben wird, während sie die ganze Zeit nur mit ihm gespielt und ihn benutzt hat: „ ‚Nein’, sagte sie leise, ‚ich liebe ihn nicht.’ “39.
Der Z ist also ein Individualist, den seine Naivität fast ins Gefängnis gebracht hätte.
3.3.2 Der N
Auch der N, der mit Vornamen Otto heißt und dessen Vater Bäckermeister ist, ist einer der Schüler des Lehrers. Er ist ein typisches Beispiel für einen Jugendlichen, der dem politischen System und der Ideologie der Nationalsozialisten vollkommen verfallen ist. Das zeigt sich darin, dass er in einem Aufsatz zu dem Thema „Warum müssen wir Kolonien haben?“40 schreibt: „Alle Neger sind hinterlistig, feig und faul.“41. So stellt er jedes selbstständige Denken ab und überlässt dies den Nationalsozialisten. Deshalb findet er es auch schrecklich, dass der Z Tagebuch schreibt, in dem er über sich selbst nachdenkt und bezeichnet das Tagebuchschreiben als „Blödsinn“42. Er handelt nur nach Anweisung, zum Beispiel als er den Lehrer im Auftrag seines Vaters bespitzelt und wirkt hinterlistig, da er dem Lehrer eins auswischt, indem er seinem Vater von der Aussage des Lehrers berichtet, dass auch die Neger doch Menschen seien. Aber nicht nur der Autorität seines Vaters unterwirft der N sich, sondern auch der des Feldwebels, von dem er nach einem Fehler getadelt wird: „Der N schweigt. Er wird rot und trifft mich mit einem flüchtigen Blick.“43. So kann man allgemein sagen, dass er sich der gerade herrschenden Autorität unterwirft.
Außerdem ist der N in zweifacher Weise Opfer. Zum einen ist er das Opfer des T und zum anderen ist er Opfer des politischen Systems und dessen Ideologie.
3.3.3 Der T
Genauso wie der Z und der N gehört der T zu den Schülern des Lehrers. Er wohnt zusammen mit seiner Mutter und seinem Vater, der aufgrund seiner Arbeit als Konzernleiter fast nie zu Hause ist, in einer Villa mit einem Garten und einem Park im vornehmen Villenviertel der Stadt. Das Wohnviertel wird vom Erzähler als so vornehm beschrieben, dass sogar „die Luft bedeutend besser ist als dort, wo ich [der Lehrer] wohne.“44. Auch die Innenausstattung der Villa wird als sehr teuer beschrieben. Zu den Angestellten der Familie des T gehören unter anderem ein Pförtner und ein Diener. Dieses ganze Umfeld des T hebt ihn von seinen Mitschülern N, dessen Vater nur Bäckermeister ist, und Z, dessen Vater schon lange tot ist, ab.
Der T ist ein höflicher, stiller Junge, der nur dem Lehrer auffällt. Zum ersten Mal tut er dies bei der Beerdigung der Schülers W, der an einer Erkältung gestorben war, als der Lehrer bemerkte, wie der T ihn anstarrte und „seltsam starr lächelte.“45. Außerdem beschreibt der Erzähler immer wieder die „hellen runden Augen, die ihn ohne Schimmer und Glanz anstarren wie die eines Fisches.“46. Diese Augen sind ein Zeichen dafür, dass der T keine Gefühle hat und sind sehr charakteristisch für ihn, da sie im Buch sehr oft wiederholt werden. Außerdem ist der T sehr wissbegierig, was besonders in den Bereichen Sexualität, Geburt und Tod deutlich wird, zum Beispiel als der N dem Lehrer berichtet, warum er glaubt, dass der T den N ermordet hat:
„Aber wissen Sie, Herr Lehrer, der T ist entsetzlich wißbegierig, immer möcht er alles genau wissen, wie es wirklich ist, und er hat mir mal gesagt, er möcht es gern sehen, wie einer stirbt. [...] - er hat auch immer davon phantasiert, daß er mal zuschauen möcht, wenn ein Kind auf die Welt kommt.“47
Sein späterer Selbstmord zeigt am Schluss des Romans, dass der T ziemlich feige, ängstlich und labil ist. Er hat zwar den Mut jemanden zu töten aber nicht den Mut sich den Konsequenzen zu stellen. So wählt er lieber den „leichtesten“ Weg sich aus der Affäre zu ziehen: den Selbstmord.
3.3.4 Der Klub
Der Klub besteht aus vier Jungen, von welchen zwei ehemalige Schüler des Lehrers sind, und tritt erst am Ende des Romans in Erscheinung. Neben den beiden Schülern bilden ein Bäckerlehrling und ein Laufbursche den Klub. In Aktion tritt aber als einziges Mitglied nur der Schüler B, der mit dem Lehrer in Kontakt tritt. Gegründet wurde der Klub, weil sich die Schüler nicht mehr von den anderen Mitschülern unterdrücken lassen wollten und ihre antifaschistischen Vorstellung irgendwo ausleben wollten: „Damals haben wir doch alle unterschrieben, daß wir sie nicht mehr haben wollen - aber ich tats nur unter Druck, denn sie haben natürlich sehr recht gehabt mit den Negern.“48. Die Jungen treffen sich wöchentlich zum Lesen verbotener Schriften und zur anschließenden Diskussion darüber, womit sie dem Lehrer sehr ähnlich sind:
„Ich mag nicht mehr marschieren und das Herumkommandiertwerden kann ich auch nicht mehr ausstehen, da schreit dich ein jeder an, nur weil er zwei Jahre älter ist! Und dann die faden Ansprachen, immer dasselbe, lauter Blödsinn!“49
Zum ersten Mal erfährt der Lehrer von dem Bestehen des Klubs, als ihn der B zu Hause besucht, um ihm zu erzählen, warum der Klub denkt, dass der T der Mörder des N sein könne. Für diesen Besuch beim Lehrer entscheiden sie sich, da der Lehrer „ der einzige Erwachsene ist, den sie kennen, der die Wahrheit liebt“50. Das bedeutet, dass die Klubmitglieder dem Lehrer vertrauen und sie ihm helfen wollen. Der Klub hat nämlich durch die Aussage des Lehrers vor Gericht erkannt, dass er ähnliche Ansichten hat, wie die Mitglieder. Der Leitsatz des Klubs lautet: „Für Wahrheit und Gerechtigkeit!“51. Durch diesen Leitsatz werden wieder die Parallelen zum Lehrer deutlich, der ja auch sehr humanistische Vorstellungen hat. In einer gewissen Weise könnte man den Klub auch als eine Art antifaschistische Partei bezeichnen, da seine Mitglieder nicht nur verbotene Bücher lesen und diskutieren, sondern auch danach leben wollen. Außerdem ist der Klub straff organisiert wie eine Partei: es gibt Satzungen, Paragraphen und einen Leitsatz. Dass die Mitglieder des Klubs hochmotiviert sind, kann man daran erkennen, dass sie alles tun um den T als Mörder zu entlarven und sogar Klubberichte verfassen, um den Lehrer über die laufenden Vorgänge und Fortschritte zu informieren.
Insgesamt kann man den Klub als eine antifaschistische Partei bezeichnen, die sich nicht von den Nazis unterdrücken lässt und sich nicht nach der neuen Ideologie richtet, sondern ihre eigenen Vorstellungen hat und auch auszuleben versucht.
3.3.5 Die Problematik der Jugend ohne Gott
Das Hauptproblem der im Roman Jugend ohne Gott beschriebenen Jugend ist, dass sie völlig verzerrte und falsche Wertvorstellungen eingehämmert bekommt:
Alles Denken ist ihnen verhasst. Sie pfeifen auf den Menschen! Sie wollen Maschinen sein, Schrauben, Räder, Kolben, Riemen - doch noch lieber als Maschinen wären sie Munition: Bomben, Schrapnells, Granaten. Wie gerne würden sie krepieren auf irgendeinem Feld! Der Name auf einem Kriegerdenkmal ist der Traum ihrer Pubertät.“52
Durch die von den Nationalsozialisten vorgegebenen Richtlinien, wie zum Beispiel die Pressezensur oder die Schulverordnungen, können sich die Jugendlichen in ihrer Pubertät gar nicht normal entwickeln, sondern lernen sehr früh, was es heißt zu gehorchen und das zu tun, was man gesagt bekommt. Der Erzähler beschreibt dies mit: „Sie ziehen durch schiefe Voraussetzungen falsche Schlußfolgerungen.“53.
So haben die Jugendlichen gar kein Chance sich ihre eigene Meinung zu bilden. Sie bekommen ihr ganzes Leben lang die Meinung anderer als die einzig richtige erzählt. Auch als Gefangene des Systems könnte man sie bezeichnen, denn wer anders denkt, denkt falsch. Und die Schule kann nichts daran ändern, den Schülern falsche Vorstellungen (wie zum Beispiel, dass Neger keine Menschen sind) beibringen zu müssen, da auch sie den Richtlinien der Nazis unterliegt und sich daran halten muss: „Sie vergessen das geheime Rundschreiben 5679 u/33!“54.
Weil die Schüler es nicht anders gewohnt sind, nehmen sie diese Unterdrückung des eigenen Willens und der eigenen Persönlichkeit hin. Auch ihre Eltern unterstützen sie bei den eigentlich vollkommen schrecklichen und bösartigen Taten, wie zum Beispiel beim Bespitzeln des Lehrers. Außerdem wird ihnen immer gesagt, dass es die größte Ehre ist für ihr Vaterland in den Krieg ziehen zu dürfen und dadurch eine ganze Nation zu retten. Das stößt bei den Jugendlichen natürlich auf große Zustimmung, denn wer will nicht einmal der Held der Nation sein. Nur leider vergessen sie dabei die andere Seite des Krieges, wie Tod und Leid, oder diese anderer Seite wird ihnen einfach vorenthalten. Natürlich ist es sehr wichtig für die Nazis eine Jugend zu formen, die frei von Vorurteilen und hochmotiviert ist, denn ohne dies würde das ganze politische System unter Hitler gar nicht funktionieren.
Abschließend ist sichtbar, dass die Jugendlichen eigentlich gar nichts dafür können, dass sie so schrecklich und gemein sind, da sie nur so handeln und sich nur so verhalten, wie es ihnen ihr ganzes Leben lang beigebracht wird. Sie sind Opfer des nationalsozialistischen Systems und können sich nicht daraus befreien.
3.4 Der Realismus des Romanendes
Betrachtet man das Romanende, fällt einem sofort auf, dass es ein ziemlich außergewöhnliches Ende ist. Und es bleibt zu untersuchen, wie realistisch es zu sehen ist. Der letzte Satz des Romans lautet: „Der Neger fährt zu den Negern.“55. Das bedeutet, nachdem der Lehrer vom Schuldienst suspendiert worden ist und eine Stelle als Lehrer in einer Missionsschule in Afrika angeboten bekommt, entscheidet er sich, die Stelle anzunehmen und nach Afrika zu ziehen. Doch es scheint so, als hätte Horváth das letzte Kapitel völlig ungeachtet der Tatsache geschrieben, dass es in seinem ganzen Roman um das gerade neu an die Macht gekommene Naziregime geht. Denn ein Lehrer, der vom Schuldienst suspendiert ist, konnte unter der nationalsozialistischen Herrschaft bestimmt nicht einfach so nach Afrika auswandern, nur weil er hier keinen Job mehr hat. Statt dessen wäre er wahrscheinlich verhaftet worden und in ein Gefängnis oder ein Konzentrationslager gebracht worden, denn Hitler duldete keine Feiglinge.
Insofern halte ich das Romanende für nicht realistisch. Auf die Frage warum Horváth es trotzdem gewählt hat, habe ich nur eine Erklärung: Vielleicht wollte er Deutschland einfach einmal darstellen, wie er „es gern hätte“. Oder besser gesagt, wie der Leser von damals sich dieses Romanende gewünscht hätte. Für viele von ihnen wäre es nämlich der größte Wunsch gewesen, dem ganzen politischen System einfach so entfliehen zu können und woanders noch einmal ganz von vorne anzufangen. Obwohl die Menschen wussten, dass ihr Wunschtraum unter den Nazis niemals wahr werden würde, konnten sie wenigsten beim Lesen von Jugend ohne Gott einmal ihrer Phantasie freien Lauf lassen, weil Horváth ihnen einfach das schrieb, was sie gerne lesen wollten.
Schluss
Abschließend bin ich der Meinung, dass es Ödön von Horváth wunderbar gelungen ist, Lehrer und Schüler unter einem faschistischen Regime darzustellen. Er versteht es gut, Charaktere präzise und anschaulich zu beschreiben, so dass man sich gut in sie hineinversetzen kann. Das Verhalten der Schüler in Jugend ohne Gott deckt sich in allen Punkten mit den Verhaltensweisen, die den Schülern des Nationalsozialismus’ in sämtlicher Sekundärliteratur zugeordnet sind. Das ist aber auch nicht großartig verwunderlich, schließlich hat Horváth ja leibhaftig miterlebt, wie sich das Thema Schule unter einem faschistischen Regime in den dreißiger Jahren verhielt.
Außerdem kann ich gut nachvollziehen, warum der Roman schon damals sehr beliebt war. Nachdem er 1937 im Allert de Lange Verlag erschienen war, wurde er in zahlreiche Sprachen übersetzt und verkaufte sich großartig. Auch Hermann Hesse war sehr von Jugend ohne Gott begeistert. So schreibt er 1937 in einem Brief an Alfred Kubin:
Ein kleines Buch empfehle ich Ihnen, eine Erzählung ›Jugend ohne Gott‹ von Horváth. Vielleicht erwischen Sie sie irgendwo; sie hat Fehler, ist dennoch großartig, und schneidet quer durch den moralischen Weltzustand von heute.56
Auch die meisten übrigen Personen waren begeistert von Horváths Werk, da es eine große Faschismuskritik war und es nicht viele Schriftsteller gab, die den Mut hatten die Nazis zu provozieren. Der österreichische Schriftsteller und Kritiker Oskar Maurus Fontana fasste letztendlich die öffentliche Meinung zusammen:
[...] Hier gewinnt er apokalyptische57 Gewalt, hier hört man - zum ersten Mal bei Horváth - den Herzschlag echter Ergriffenheit, hier ist seine spielerische Leidenschaft zur Gestalt und zum Gleichnis gebändigt.58
Und auch noch heute erfreut sich der Roman großer Beliebtheit. In Deutschland gehört er sogar zu den im Schulunterricht sehr häufig gelesenen Lektüren. Denn, da sich die meisten Schüler heutzutage auch im Deutschunterricht mit dem Thema Nationalsozialismus befassen, bietet ihnen Jugend ohne Gott eine gute Grundlage zum erforschen der Nazi-Zeit. Außerdem ist der Roman relativ einfach zu lesen, da Horváth ziemlich einfache Satzkonstruktionen verwendet und deshalb für Schüler gut verständlich und leicht zu bearbeiten.
Nun möchte ich zum Schluss meiner Facharbeit noch etwas zu meiner Vorgehensweise bei der Bearbeitung des mir vorgegebenen Themas sagen. Insgesamt hat mir das Schreiben dieser Facharbeit Spaß gemacht, da ich eigenständig arbeiten musste und daraus viel gelernt habe. Nämlich, wie ich mir meine Zeit vom Beginn der Arbeit bis zum Ende am besten einteile, welche verschiedenen Recherchemittel es gibt, wie ich aus sehr viel Material das Brauchbarste herausfiltere und dass fünfzehn Seiten ziemlich wenig sind.
Ich bin in meiner Arbeitsweise so vorgegangen, dass ich zuerst einmal alle Materialien gesammelt habe, die in irgendeiner Weise etwas mit Ödön von Horváth, dem Roman Jugend ohne Gott und der Schule während des Nationalsozialismus zu tun haben. So nutzte ich zum Beispiel die Herzog - August - Bibliothek und die Stadtbücherei Wolfenbüttel, um mir Sekundärliteratur zu beschaffen. Auch über das Internet fand ich einige Daten heraus, von denen ich aber die meisten leider nicht verwenden konnte, da sie nicht präzise genug waren. Als zweiten Schritt fing ich an, das Material auszusortieren, dass für mein Thema wichtig ist, bevor ich zum Schluss versucht habe das ganze Material sinnvoll als Text zusammenzustellen. Und das Ergebnis ist nun diese Facharbeit.
Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
Horváth, Ödön von. Jugend ohne Gott. Erste Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1983
Sekundärliteratur:
Hildebrandt, Dieter. Horváth. Kurt Kusenberg. Erste Auflage. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1975
Krischke, Traugott. Ödön von Horváth. Kind seiner Zeit. Erste Auflage. München: Wilhelm Heyne Verlag, 1980
Microsoft Encarta 97 Enzyklopädie, 1993-1996, Microsoft Corporation
Ortmeyer, Benjamin. Schulzeit unterm Hitlerbild. Walter H. Pehle. Erste Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 1996
Schlemmer, Ulrich. Ödön von Horváth. Jugend ohne Gott. Klaus - Michael Bogdal. Clemens Kammler. Zweite Auflage. Band 65. München: R. Oldenbourg - Verlag GmbH, 1997
[...]
1 Horváth, Ödön von: Jugend ohne Gott. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1983, S.19/20. (des weiteren bezeichnet mit Jugend ohne Gott)
2 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.69
3 Schlemmer, Ulrich: Ödön v. Horváth. Jugend ohne Gott. R. Oldenbourg-Verlag GmbH, München ²1993, S.36.
4 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.82
5 Jugend ohne Gott, a. a. O., S. 11
6 Schlemmer, Ulrich, a .a. O., S.9
7 Hildebrandt, Dieter: Horváth. Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg 1975, S.107
8 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.158
9 Hitler, Adolf: Mein Kampf. München 1937, S.459 zitiert in Ortmeyer, Benjamin: Schulzeit unterm Hitlerbild. Fischer Taschenuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main April 1996, S. 20
10 Microsoft Encarta 97 Enzyklopädie, 1993-1996, Microsoft Corporation
11 Hitler, Adolf, a. a. O., S.455 zitiert in Ortmeyer, Benjamin, a. a. O., S.21
12 Hitler, Adolf, a. a. O., S.456 zitiert in Ortmeyer, Benjamin, a. a. O., S.23
13 Jugend ohne Gott, a. a. O., S. 11
14 Jugend ohne Gott, a. a. O., S. 11
15 Jugend ohne Gott, a. a. O., S. 25
16 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.13
17 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.14
18 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.16
19 siehe Zitat 6, Seite 7
20 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.57
21 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.94
22 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.73/74
23 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.124
24 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.27
25 Mensch mit gesteigertem Geschlechtstrieb
26 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.29
27 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.29
28 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.30
29 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.30
30 Schlemmer, Ulrich, a. a. O., S.69
31 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.39
32 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.62
33 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.64
34 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.61
35 Schlemmer, Ulrich, a. a. O., S.77
36 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.67/ 70
37 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.67
38 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.98
39 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.104
40 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.12
41 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.13
42 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.61
43 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.39
44 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.127
45 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.34
46 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.34
47 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.115
48 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.116
49 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.116
50 Jugend ohne Gott, a. a. O., S. 118
51 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.120
52 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.24
53 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.13
54 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.19
55 Jugend ohne Gott, a. a. O., S.149
56 Zitat aus einem Brief von Hermann Hesse an Alfred Kubin zitiert in Krischke, Traugott: Ödön von Horváth. Kind seiner Zeit. Wilhelm Heyne Verlag, München 1980, S. 245
57 Apokalypse = Bezeichnung für eine literarische Gattung religiösen Schrifttums, worin auf eine bestimmte Weise das Ende der Welt gedeutet wird.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Horváths Jugend ohne Gott?
Das Hauptthema des Romans Jugend ohne Gott ist die Darstellung von Schule und Gesellschaft unter einem faschistischen Regime, insbesondere während des Nationalsozialismus in Deutschland. Der Roman untersucht die Auswirkungen von Propaganda, Ideologie und politischem Druck auf Lehrer, Schüler und die Jugend im Allgemeinen.
Wer ist der Autor von Jugend ohne Gott?
Der Autor von Jugend ohne Gott ist Ödön von Horváth.
Worum geht es in Jugend ohne Gott?
Jugend ohne Gott erzählt die Geschichte eines Lehrers, der in einer von Faschismus geprägten Gesellschaft arbeitet. Er ist desillusioniert und entfremdet von seinen Schülern, die von Nazi-Ideologie indoktriniert sind. Der Roman verfolgt die Ereignisse im Ferienlager der Klasse und die anschließenden Ermittlungen nach einem Mord, bei dem Schüler verwickelt sind. Der Lehrer durchläuft im Laufe der Geschichte eine Wandlung.
Wie ist der Roman aufgebaut?
Der Roman wird aus der Ich-Perspektive des Lehrers erzählt. Er ist in drei größere Abschnitte unterteilt: die Einführung des Lehrers und seines Umfelds, die Ereignisse im Ferienlager und der Prozess sowie dessen Folgen. Die Kapitel sind oft durch Wortwiederholungen und metaphorische Bedeutungen miteinander verbunden.
Wer sind die Hauptfiguren in Jugend ohne Gott?
Die Hauptfiguren sind: der Ich-Erzähler (der Lehrer), Z, N, T und Eva. Julius Caesar, ein alter Kollege des Lehrers, tritt ebenfalls als eine bedeutende Nebenfigur auf.
Wie wird die Schule im faschistischen Deutschland in Jugend ohne Gott dargestellt?
Die Schule wird als ein Ort der Indoktrination dargestellt, an dem Schüler gezwungen werden, faschistische Ideologien zu akzeptieren und zu verbreiten. Die Lehrer stehen unter Druck, sich dem System anzupassen und die vorgegebenen Inhalte zu unterrichten. Kritische Meinungen werden unterdrückt.
Welche Rolle spielt der Lehrer in Jugend ohne Gott?
Der Lehrer ist eine ambivalente Figur. Anfangs ist er passiv und feige, passt sich dem System an, obwohl er es ablehnt. Im Laufe der Handlung entwickelt er sich jedoch weiter, findet seinen Glauben an Gott wieder und sagt am Ende die Wahrheit aus, was zu seiner Suspendierung führt.
Wer ist der Mörder im Roman?
Der Mörder ist der Schüler T. Er erhängt sich, als er merkt, dass der Lehrer ihm auf der Spur ist.
Was ist der Klub in Jugend ohne Gott?
Der Klub ist eine Gruppe von antifaschistischen Schülern, die sich heimlich treffen, um verbotene Schriften zu lesen und zu diskutieren. Sie unterstützen den Lehrer bei der Aufklärung des Mordfalls.
Wie realistisch ist das Ende von Jugend ohne Gott?
Das Ende, in dem der Lehrer nach Afrika auswandert, wird als nicht sehr realistisch angesehen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein vom Schuldienst suspendierter Lehrer unter dem Naziregime einfach so ausreisen konnte. Es wird vermutet, dass Horváth dies als eine Art Wunschtraum für seine Leser darstellen wollte.
Was ist die Botschaft von Jugend ohne Gott?
Die Botschaft ist eine Kritik am Faschismus und seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft, insbesondere auf die Jugend. Der Roman zeigt, wie Ideologie und Propaganda zu Entmenschlichung und Gewalt führen können und betont die Bedeutung von individueller Verantwortung und Widerstand.
- Arbeit zitieren
- Annika Tolle (Autor:in), 2001, Horváth, Ödön von - Jugend ohne Gott - Schule unter einem faschistischen Regime, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104711