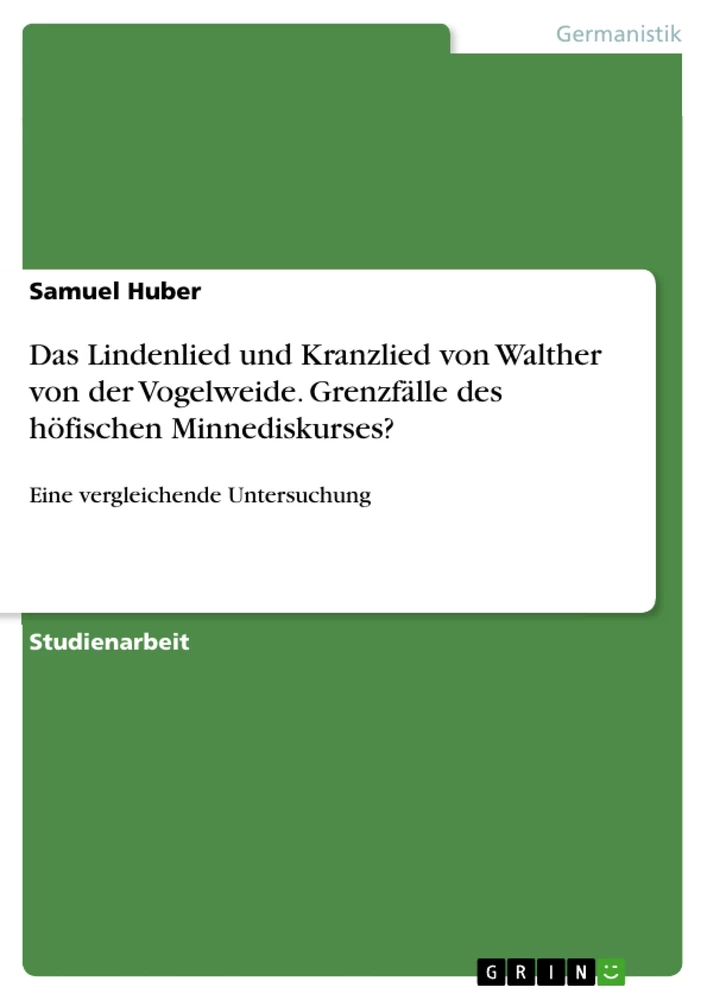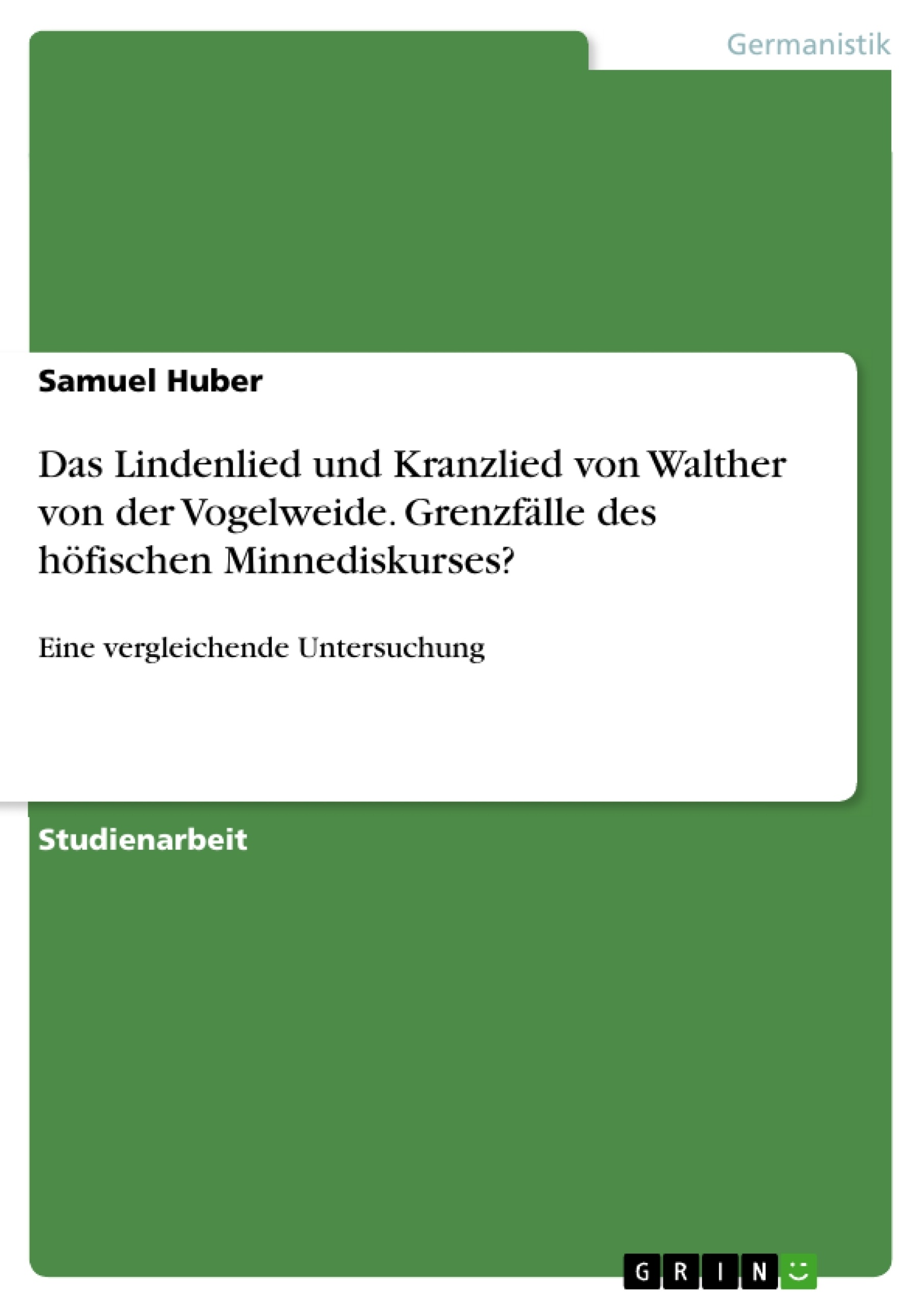In der Arbeit wird das „Lindenlied“ (L 39,11) und das „Kranzlied“ (L 74,20) von Walther von der Vogelweide unter dem Leitaspekt des höfischen Minnediskurses zusammengeführt und beleuchtet. Ziel der vergleichenden Darstellung wird dabei eine Gegenüberstellung beider Lieder und ihrer impliziten Wirkungsstrategien sein. Diese fragt gleichsam nach den Möglichkeiten, Potenzialen und Grenzen von Walthers Sang im Kontext höfischer Wertediskussion und unternimmt davon ausgehend einen Ausblick auf die Konstruktion von Dichterbildern.
Die Forschung zu Walther von der Vogelweide hat ihren Gegenstand mit einer Vielzahl an Zuschreibungen bedacht und mannigfaltige Deutungen herausgearbeitet, die zur Konstruktion unterschiedlicher Dichterbilder beigetragen haben und Walther selbst in immer neues Licht zu rücken suchten. Dabei sind die einzigen über seine Person Auskunft gebenden Zeugnisse, die unter seinem Namen überlieferten Strophen und seine Abbildung in der Großen Heidelberger Liederhandschrift, die wiederum das Produkt einer konzessiven Übertragung eines aus seinen Worten entnommenen Selbstbildes ist. Eben diesen Umständen, Walthers Standing in der Literaturgeschichte einerseits und den fehlenden Fakten zur historischen Figur anderseits, die eine Annäherung an den Künstler ausschließlich über die Kunst selbst zu- und daher den Versuch einer Trennung obsolet erscheinen lassen, verdankt die Walther-Forschung ihre Bandbreite an Interpretationsmöglichkeiten, die sich nicht zuletzt in den vielfältigen Entwürfen von Dichterbildern niederschlägt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lindenlied (L 39,11)
- Kranzlied (L 74,20)
- Vergleichende Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit zwei prominenten Liedern von Walther von der Vogelweide: „Under der linden“ (L 39,11) und „Nemt, frouwe, disen kranz'“ (L 74,20). Ziel ist es, die Lieder im Kontext des höfischen Minnediskurses zu untersuchen, ihre Wirkungsstrategien zu vergleichen und die Konstruktion von Dichterbildern in ihrer Rezeptionsgeschichte zu beleuchten.
- Der höfische Minnediskurs als Raum der Reflexion und Aushandlung von Minne-Dienst und höfischer Gesellchaftsordnung
- Walthers „Walther-Rolle“ als Erneuerer und Überwinder älterer Minnesang-Konzeptionen
- Die Grenzfälle des höfischen Minnediskurses in Walthers Lindenlied und Kranzlied
- Die Interpretationsgeschichte der beiden Lieder und ihre Bedeutung für die Konzeptionalisierung des Sangs
- Die Konstruktion von Dichterbildern im Kontext der Rezeption Waltherscher Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Forschungslandschaft zur Walther-Lyrik, diskutiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Interpretation und stellt die beiden untersuchten Lieder im Kontext der bestehenden Forschung vor.
Lindenlied (L 39,11)
Dieses Kapitel fokussiert auf Walthers Lindenlied, seine Rezeptionsgeschichte und die Interpretationen des Liedes in der aktuellen Forschung. Es beleuchtet die Besonderheiten des Liedes, seine Struktur, seine Thematik und die im Lied enthaltenen impliziten Wirkungsstrategien.
Kranzlied (L 74,20)
Hier wird das Kranzlied von Walther von der Vogelweide analysiert, seine Besonderheiten im Kontext der höfischen Lyrik beleuchtet und die Interpretationsgeschichte des Liedes betrachtet. Es werden Verbindungen zur bestehenden Forschung zum Kranzlied hergestellt und vergleichende Aspekte zu anderen Liedern des Repertoires aufgezeigt.
- Quote paper
- Samuel Huber (Author), 2021, Das Lindenlied und Kranzlied von Walther von der Vogelweide. Grenzfälle des höfischen Minnediskurses?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1043928