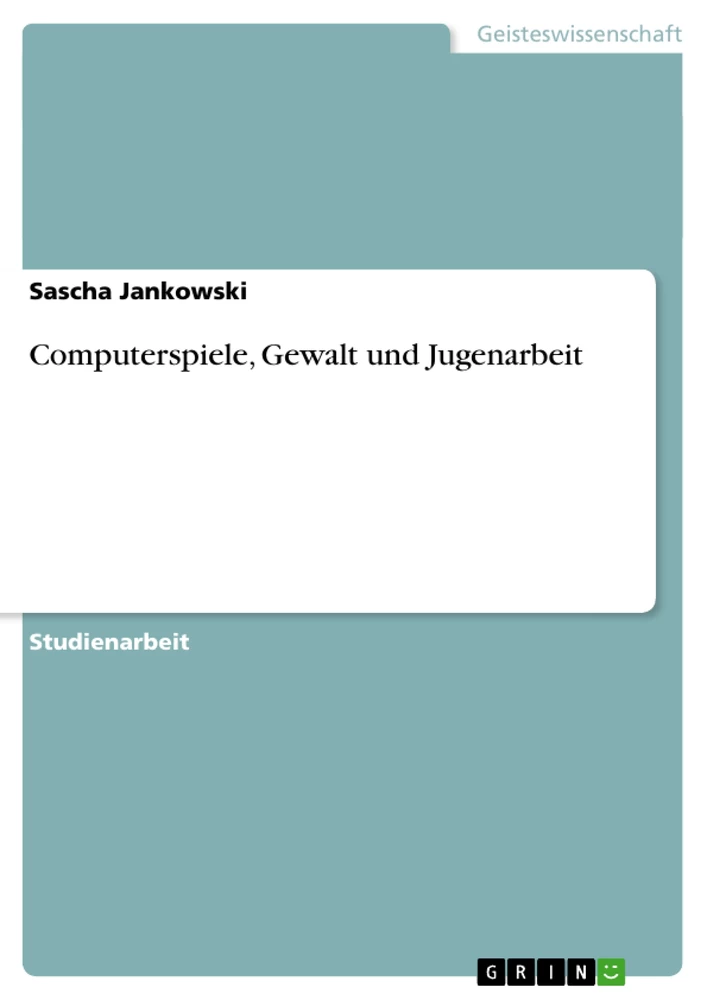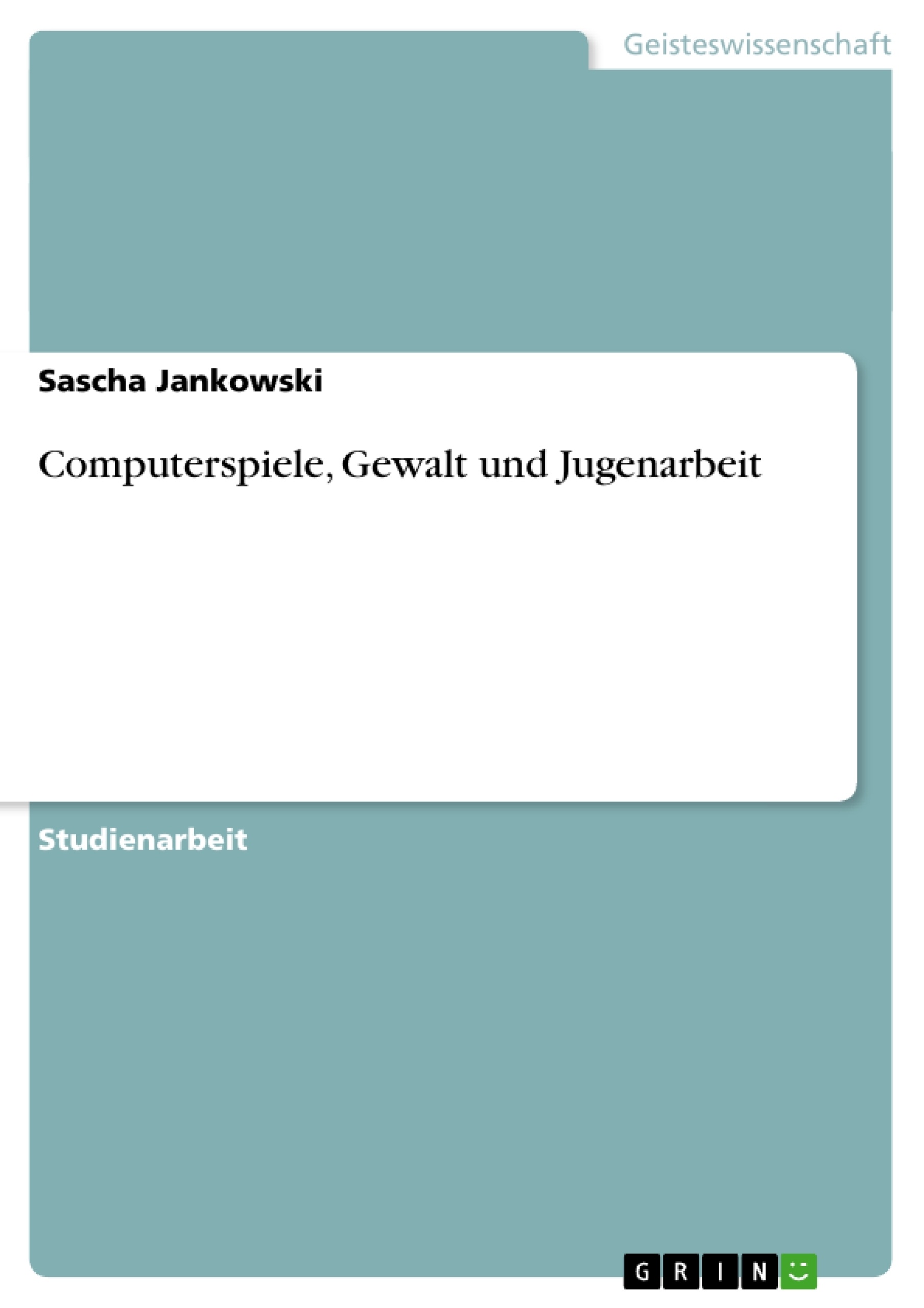Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist überhaupt Gewalt
2.1 Ursachen von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen
3. Zur Nutzung von Computerspielen
3.1 Grundmuster der Computerspiele
3.2 Warum werden gewalthaltige Computerspiel so gern gespielt?
4. Gewalt in Computerspielen - Gefährdung oder nützliches Ventil? Die Medienwirkungsforschung
4.1 Die theoretischen Modelle
5. Befragung zur Nutzung von Computerspielen
6. Interview mit einem Jugendarbeiter aus dem Jugendtreff Harsum
6.1 Die Meinung eines Jugendlichen
7. Herausforderungen für die offene Jugendarbeit - Weitergehende Überlegungen zur Nutzung von Computerspielen in der Jugendarbeit
7.1 Aktzeptierende Medienpädagogik
8. Zusammenfassung und eigene Meinung
9. Literaturverzeichnis
Anhang A. - Anregungen zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema
Anhang B. - Folie 1
Computerspiele, Gewalt und Jugendarbeit
1. Einleitung:
Der Zusammenhang von Computerspielen und Gewalt im Leben der Kinder und Jugendlichen und die Rolle der Jugendarbeit im Hinblick auf Computerspiele (gerade mit gewalthaltigen Inhalten) in Jugendzentren, ist Thema meines Referats.
Zu diesem Thema bin ich gekommen, weil ich im Jugendzentrum Sarstedt den Computerraum betreue und dort oft von Kindern und Jugendlichen nach Spielen gefragt werde, die von der USK mit „nicht geeignet unter 18 Jahren“ eingestuft werden. Mir stellte sich oft die Frage, wie sinnvoll es ist, die Spiele zu verbieten, die von der USK mit der Alterseinstufung ab 16J. oder ab 18J. bewertet worden sind, wenn diese doch ausdrücklich von den Kindern und Jugendlichen gespielt werden wollen und höchst wahrscheinlich in der Peer-Gruppe oder sogar alleine gespielt werden. Ich habe bei uns im Jugendzentrum 10 Kinder und Jugendliche zu ihrem Computerspielverhalten befragt und ein ca. 12 minütiges Video gedreht in dem das Nutzungsverhalten der Kinder nachvollziehbar gemacht werden soll. Außerdem habe ich, um eine Vergleichsmöglichkeit mit meiner Arbeit und den Ergebnissen aktueller Medienwirkungsuntersuchungen zu bekommen, einen Jugendarbeiter interviewt, der in einem Jugendzentrum arbeitet in welchem Computerspiele ebenfalls sehr gefragt sind.
2. Was ist überhaupt Gewalt?
Wenn man die Nutzung von Computerspielen mit gewalthaltigen Inhalten reflektieren will, muß man zunächst einmal festhalten, das Gewalt in Computerspielen etwas völlig anderes ist als konsumierte Gewalt im Fernsehen oder die reale Gewalt. Die real erlebte (oder ausgeübte!) Gewalt bewegt sich selbstverständlich auf einer intensiveren „Erlebensstufe“. Die konsumierte Fernsehgewalt unterscheidet sich von der „gespielten“ Gewalt im Computerspiel insofern, als dass das Fernsehen einen weitaus größeren Realitätsfaktor besitzt, als ein Computerspiel. Die Toten in den Nachrichten, sind wirklich tot und oft ist im Fernsehen schon nicht mehr zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Die Gewalt im Computerspiel ist deswegen vielleicht nicht unbedingt weniger bedenklich, aber sie spielt sich im wahrsten Sinne des Wortes, doch auf einer anderen Stufe ab, „es geht hier um Aggressivität, die nur so tut, als wolle sie jemand schädigen, und die, solchermaßen sorgfältig aus der Realität ausgegrenzt, allen Beteiligten Spaß macht.“1
Die Kinder bekommen natürlich mit, dass das Thema Gewalt unter Kindern und Jugendlichen z.B. in den Medien sehr heftig debattiert wird, dieser Umstand macht das Thema Gewalt für die Kinder auch interessanter.
Gewalt tritt dort zu Tage, wo „Zudringlichkeiten, (...) das physische, psychologische oder gesellschaftliche Wohlbefinden des einzelnen oder bestimmter Gruppen in schmerzhafter oder schädlicher Weise beeinträchtigen.“2. Ausgehend von dieser Definiton von Gewalt, kann vermutet werden, das gewalthaltige Computerspiele die Psyche von Kindern und Jugendlichen auf schädliche Weise beeinträchtigen können. Doch ist der Einfluß solcherlei gespielter Gewalt abhängig vom Entwicklungsstand des Spielenden.
Möchte man untersuchen ob ein Zusammenhang zwischen gespielter Computergewalt und dem realen Verhalten der Spieler besteht, so sollte zunächst einmal geschaut werden, welche Ursachen gewalttätiges Verhalten von Kindern und Jugendlichen sonst haben könnte.
2.1 Ursachen von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen (auch abnehmende Fähigkeit zu Mitleid und Mitgefühl / Unrechtsbewußtsein):
- wachsende Orientierungslosigkeit (mangels familiärer Leitbilder?), Entwurzelung
- Verunsicherung und Perspektivlosigkeit (Arbeitslosigkeit)
- starke Konsumorientiertheit (Konsumdruck durch die Werbung bei gleichzeitig fehlenden finanziellen Ressourcen => Frustration)
- Armut, Isolierung und Ausgrenzung
- Gewalt in den Medien (zunehmende Gewalttätigkeit in der Gesellschaft, scheinbar gerechtfertigte Gewalt), Leitbildcharakter der Medien, meine Hypothese ist, daß das Fernsehen einen weit größeren Einfluß auf das Verhalten von Kindern hat, da zum einen das gesellschaftlich anerkannte Medium schlechthin Einfluß auf Weltbilder und Wertvorstellungen ausübt, außerdem sind die Menschen, die im Fernsehen agieren real (Grenze von Realität und Fiktion ist kaum noch erkennbar), im Gegensatz zu den Bits und Bytes im Computer.
3. Zur Nutzung von Computerspielen
Die Nutzung von Computerspielen, die Spielhäufigkeit, die Wahl der Spiele und damit die Auswirkungen der Spiele sind zunächst abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. Alter, Geschlecht, Bildung und Biographie der Spieler.
Langeweile, Leerzeiten, fehlende attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten und eine sich entwickelnde Eigendynamik fesselt die Spieler vor den Computer und Videospielen. Demnach sind die Computerspiele und Spielkonsolen lediglich Beschäftigungsobjekte 2.Wahl. Jedoch, „(...) wenn sich die Faszination der Video- und Computerspiele nicht in der Funktion des Zeitfüllens bzw. Zeitüberbrückens erschöpft, wenn sich also beim Einlassen auf ein Spiel eine eigene Dynamik entwickelt, durch die, wie bei anderen Spielen auch, die übrige Realität zur Nebensache werden kann, dann kann das nicht per se negativ bewertet werden. Schließlich (...) wenn Kinder beim Lesen eines spanneden Buches oder beim intensiven Spielen z.B. mit einer Puppe oder einem Konstruktionsspielzeug eine Zeitlang geistig in einer Als-ob-Welt versinken, dann würde das heute in der Regel sogar eher positiv kommentiert.“3
Problematisch wird es bei Kindern, bei denen „Prozesse der Vereinsamung, des Realitätsverlusts oder der dauerhaften Vereinseitigung von Interessen und Aktivitäten“ zu beobachten sind. Die Ursachen dafür, das manche Kinder vor ihren Computer „kleben“ bleiben, müssen wohl im sozialen Umfeld vermutet werden (Bedingungen des Aufwachsens, Vernachlässigung...).
3.1 Grundmuster der Computerspiele
Dieses Spielgenre der Kampfspiele beinhaltet sowohl einfache und unrealistische Abschießspiele (z.B. Weltraumkampfspiele), Ballerspiele (auch „Shoot’em up“, „Ego- Shooter“ oder „3d-Shooter“ wie Half-Life, Unreal, Quake, Doom etc.), die in ihrem Spielablauf von unrealistisch bis sehr realistisch einzustufen sind und Prügel- bzw. Kampfsportspiele (auch „Beat’em up“, z.B. Streetfighter). Die kampfbestimmten Handlungsmuster der Spiele erfordern vom Spieler Reaktionsschnelligkeit, rasches Auffassungsvermögen, räumliches Orientierungsvermögen, eine gute Auge-Hand- Koordination, Resistenz gegen Streß und Gefahrensituationen.4
Die restlichen Spielgenre (also Adventure: (Action-Adventure. (z.B.Indiana Jones), Rätsel- Adventure (z.B. Monkey Island), Rollenspiele (strategisch, z.B. Fallout)), Simulationsspiele (Wirtschaft, Schlachten, Aufbau- und Systemsimulation), Sportspiele, Jump’n’Run-Spiele, Renn- und Flugspiele, Denk- und Geschicklichkeitsspiele), möchte ich an dieser Stelle nicht weiter erörtern, weil sich die gewaltätigen Inhalte und Handlungen, nicht unbedingt als die Hauptaufgabe im Spielgeschehen ausdrücken. Wobei anzumerken ist, das manche Spiele die Genre übergreifend sind, auch die Grenzen zum Fragwürdigen überschreiten (z.B. Horror- Action-Adventure wie Resident Evil, das Autorennen „Deathcarz“, bei dem es Ziel ist möglichst viele Passanten und Tiere mit einem Auto zu überfahren, und selbstverständlich die gesamte Palette der Kriegs- und Schlachtensimulationen).
Die „Sozialisationsinstanz“ der Video- und Computerspiele wurde besonders von dem Kölner Professor für Spiel- und Interaktionspädagogik Jürgen Fritz beleuchtet: „Er sieht Spiel und Spiele als Spiegel der Wirklichkeit und Spielzeug als Vermittler zwischen innerer und äußerer Welt an, also zwischen der Welt der Wünsche und Gefühle der Kinder auf der einen und der Welt der Gegenstände und Menschen, mit denen es handeln möchte, auf der anderen Seite. Aus dieser Sicht greift bspw. eine auf den Bereich der Computerspiele beschränkte Kritik an Kampf- und Kriegsspielen zu kurz, weil sich darin lediglich vorherrschende gesellschaftliche Muster des Umgangs mit Konflikten widerspiegeln. Gleichzeitig ist das Spielen solcher Spiele (und das Spielen überhaupt) nicht gleichzusetzen mit realen Handlungen, sondern ist ein Prozeß, der als individuelle Auseinandersetzung mit der (äußeren) Realität begriffen werden muß und an eine phantasierte Zwischen-Welt gebunden ist, in der sich sowohl die innere als auch die äußere Welt wiederfindet. Spielerisch eignen sich Kinder (und Jugendliche) so Ausschnitte aus der gesellschaftlich-historisch entstandenen Welt an und erweitern dabei zugleich ihr Verständnis dieser Welt und ihre eigenen Wahrnehmungs- und Handlungskompetenzen.“5
Die Grundmuster und Aufgaben in den Spielen lassen sich wie folgt benennen: Kampf, Erledigung bestimmter Aufgaben, Bereicherung und Steigerung des Profits, Verstärkung (z.B. personale Ausdehnung), Verbreitung (z.B. räumliche Ausdehung), Ziellauf, Prüfung (z.B. der eigenen Taktik oder Strategie), Bewährung und Ordnung.
„Die Grundmuster der Bildschirmspiele, so sehr sie sich auch mit anderen Inhalten befrachten, verweisen auf bestimmte Aspekte in den Lebensthematiken und kulturellgesellschaftlichen Verhaltensmustern der Spieler:
a) Auseinandersetzungen führen und Konflikte mit andern Menschen austragen,
b) Aufgaben zur Zufriedenheit erledigen,
c) reicher werden, an Fähigkeiten und Möglichkeiten wachsen,
d) den eigenen Wirkungskreis erweitern, die Einflußzone vergrößern,
e) als Erster eine Aufgabe erfüllen und ans Ziel gelangen, f`) Prüfungs- und Bewährungssituationen bestehen,
g) Elemente des Lebens in eine sinnvolle (brauchbare, nützliche) Ordnung bringen.“6
3.2 Warum werden gewalthaltige Computerspiele so gern gespielt?
Computerspiele mit gewalttätigen Inhalten werden vorwiegend von Jungen gespielt, während die Mädchen diese eher ablehnen und andere Spiele oder kreative Anwenderprogramme bevorzugen. Die gewalthaltigen Spiele haben für Jungen einen besonderen Reiz, weil sie im Spiel die „Initiationsriten einer männlich geprägten Gesellschaft“7 durchleben können.
Insbesondere die Schock- und Splattereffekte (z.B. auseinanderfetzende „virtuelle“ Menschen) in den Spielen bieten den Spielern eine Fluchtmöglichkeit aus dem erlebnisarmen Alltag (wie auch bei Filmen), die Angstlust wird angesprochen: „In einer Welt, in der keine richtigen Abenteuer mehr zu bestehen sind und sich die Mann-Bilder, die durch Medien transportiert werden, in real life nicht leben lassen, bekommt Doom den Charakter einer virtuellen Mutprobe. Inszeniert als Ersatz-Abenteuer (in abgedunkelten Räumen und angeschlossen an die Stereoanlage) gelingt es, ein Stück weit in die unwirkliche Welt der „Verdammnis“ einzutauchen und sich die gewünschten Adrenalin-Kicks zu holen.“8 Doom ist der Vorläufer des heute sehr beliebten Ego- oder auch 3D(imensional)-Shooter. Dort ist es Aufgabe des Spielers auf einem fremden Planten in dunklen Dungeons (Verliese und Katakomben) ein Dimensionstor zu finden (welches von verantwortungslosen Wissenschaftlern geöffnet wurde und aus welchem nun Monstren aus der Hölle erscheinen) und zu schließen. Dabei muß der Spieler gegen mutierte Kameraden und Monster kämpfen. Der Spieler hat ein geradezu kriegerisches Waffenarsenal (von Nahkampfwaffen bis zu Raketenwerfern) zur Verfügung. Auf dem Bildschirm sieht der Spieler seine Spielfigur aus der Ich-Perspektive. Es ist nur die Hand und die gerade ausgewählte Waffe des Spielers zu sehen. In der Mitte des Bildschirms befindet sich ein Fadenkreuz mit dem der Spieler auf die Gegner zielt. Im Spiel gibt es keine andere Möglichkeit, als alle Gegner zu töten.
Es sind auch nicht immer unbedingt nur die Inhalte, welche die Spiele so faszinierend machen, sondern „(...) das Gefühl von Kontrolle, Spielbeherrschung und Erfolg zu genießen und im „Flow“ (das Verschmelzen von Handlung und Bewußtsein, keine Nebengedanken, kein reflektieren der eigenen Person, der Verfasser) der Spielhandlungen einzutauchen. Dabei steht eben nicht das Einüben reaktiver Handlungsschemata im Mittelpunkt, sondern das Entwickeln von Taktiken und flexiblen, reaktionsschnellen Handlungsfähigkeiten, (...)“9, also der Spaß am Spiel steigt wenn man den Spielanforderungen gewachsen ist, das Spiel beherrscht und kontrolliert, und somit die Spielaufgabe lösen kann. Andernfalls besteht die Gefahr einer Frustrations-Aggressions-Spirale, die sich z.B. durch auf den Tisch hauen, gegen den Monitor hauen, Beschimpfungen, Wut, Computer ausschalten, und allgemein schlechte Laune ausdrücken kann. Diese negativen „Folgen“ bzw. Gefühle des frustrierenden Computerspiels sind jedoch meist nicht von langer Dauer und der emotionale Transfer von Misserfolg im Spiel und affektiver Handlung beschränkt sich in der Regel auf Objekte.10
4. Gewalt in Computerspielen - Gefährdung oder nützliches Ventil? Die Thesen der Medienwirkungsforschung.
4.1 Die theoretischen Modelle (übernommen aus der Fernsehwirkungsforschung):
a.) „In der Stimulationstheorie wird davon ausgegangen, daß durch Imitationslernen die aggressiven Handlungen erlernt und imitiert werden.
b.) Der Inhibitionstheorie liegt die Annahme einer abschreckenden Wirkung zugrunde. Der Konsum von Gewalt wirkt abschreckend, weil die negative Sanktionierung von Gewalt verinnerlicht wird.
c.) Die Habitualisierungstheorie geht von einem Effekt der Abstumpfung aus. Je mehr Gewalt konsumiert wird, desto weniger wird man davon berührt. Die Erregungsschwelle verschiebt sich nach oben.
d.) Die Katharsisthese schließlich vermutet einen läuternden Wirkungsmechanismus. Die Beobachtung von Gewalt und Aggressionen beinhaltet die Möglichkeit des Spannungsabbaus und somit die Minderung des eigenen aggressiven Potentials.“11
Nach Fritz unterscheiden sich die Richtungen in 1.) die „utilitaristisch-pragmatische“ (Nutzung von Computerspielen = Möglichkeit zum Kompetenzerwerb, und 2.) „moralisch- ethische“ (negative Effekte auf die Persönlichkeitsstruktur, Aggressivität und Abstumpfung)
Die Thesen der utilitaristisch-pragmatischen Richtung, besagen das die Computerspiele die Phantasie wecken, die Spieler neue Handlungsmuster erdenken und umsetzten können und der Alltag in den virtuellen Welten erprobt werden kann. Durch die Computerspiele würden kognitive Leistungsanforderungen, wie Problemlösefähigkeiten, Reaktionsvermögen, Konfliktlösestrategien, Konzentration und Wahrnehmung geübt. (siehe 3.1) Die Spiele böten auch Möglichkeiten, Ängste und Phantasien auszuleben und abzureagieren so das sie die Aggressionsbereitschaft hemmen.
Die Thesen der moralisch-ethischen Richtung befürchten das Computerspiele die Spieler in Isolation führen und die Aggressionsbereitschaft fördert oder stimuliert. Langfristiger Konsum gewalttätiger Bilder münde in eine Gewöhnung und Tolerierung von Gewalt, in einer Herabsetzung der Hemmschwelle.
Die Mehrheit der Medienforschung sieht keinen Zusammenhang zwischen Medienerfahrung und selbst ausgeübter Gewalt. In konkreten Fällen gab es Hinweise auf Probleme im Verhalten von Jugendlichen Gewalttätern, die zwar nicht unmittelbar aus dem Medienkonsum herrührten, aber dennoch Impulsgebend waren. Christian Büttner vertritt jedoch die Meinung, der Schritt von geschauter zu ausgeübter Gewalt hänge nicht von den Medien selbst, sondern von vielen anderen Faktoren ab, denn „reale Gewalt ist nämlich immer der Ausdruck eines Widerstandes gegen Verhältnisse... Es ist vorstellbar, daß dann Gewaltphantasien in Realitäten umgesetzt werden, wenn der Raum für Wünsche und Bedürfnisse weder im Hier- und Jetzt ausreicht, noch durch die Phantasie erweitert werden kann.“12 Wie Fritz in seinen Untersuchungen feststellt, haben Computerspiele eher eine sozialintegrative Funktion, indem Gleichaltrige miteinander Computer spielen (Fritz, 1995, S. 14). Nicht das Spielen isoliert die Jugendlichen, sondern ihre soziale Isolation hat sie zu Spielern gemacht. So führen die Lebensumstände zum ausüben von Gewalt. So besteht bei vielen Medienforschern Übereinstimmung in der Annahme, „daß eine Wirkung von Medien nicht unabhängig von der Stituation des einzelnen Kindes oder Jugendlichen zu sehen ist.“13 (Geschlecht, Alter, Medienerfahrung, Erziehungsstil der Eltern, Freunde und Peer-Group (Wertvorstellungen), Freizeitinteressen, Phantasien und Ängste etc.)
5. Befragung zur Nutzung Computerspielen
Ich habe im Jugendzentrum Klecks in Sarstedt 9 Kinder und Jugendliche hinsichtlich Ihrer Nutzung von Computerspielen befragt. Alle Befragten waren männlichen Geschlechts.
Darunter drei 10jährige, zwei 11jährige, ein 12jährige, ein 13jähriger und zwei 14jährige. Den Ergebnissen meiner Befragung habe ich immer die immer die Ergebnisse des Projekts „Evaluation der Computerspielekultur bei Heranwachsenden“ Bielefeld (ca. 1000 Kinder im Alter von 8-14 wurden befragt) vergleichend gegenübergestellt.
Alle der Befragten haben zu Hause einen eigenen PC (oder PC des Bruders/Eltern) den sie nutzen können. 4 Kinder gaben an zusätzlich auch eine Playstation zu besitzen .
Vgl.: 63,6% spielen am eigenen Gerät, 11% Gerät v. Geschwistern, 27,1% Gerät v. Freund, 7,8% in Freizeiteinrichtungen
Wie oft spielst Du Computer?
2 Stunden täglich (aber auch mal 7 Stunden)
2-3 Stunden täglich wurde 2mal genannt
3-4 Stunden („so lange wie ich Lust habe“)
4-6 Stunden täglich
5-6 Stunden täglich; fühlt sich „erleichtert“
7 Stunden täglich; fühlt sich „befriedigt“ bis zu 8 Stunden täglich
ca. 4x wöchentlich unterschiedlich lange
Es handelt sich also bei allen um Viel-Spieler.
Vgl.: N=596 (Jungen): 14,9% öfter am Tag, 23,8% einmal am Tag, 16,4% einmal in der Woche, 38,7% unregelmäßig, 6,2% spiele nicht
Nach Alter: (N=578 Jungen): 7-8 Jahre spiele regelmäßig 63,6%, 9-10 J. 68,9% spiele regelmäßig, 11-12J. 49,2, 13-14J. 49,5%
Die Lieblingsspiele und was den Spielern besonders daran gefällt (mit Begründung)
3x Age of Emipre 1+2: man muß schlau sein, nachdenken, Gebäude bauen, in ein neues Zeitalter (10); Strategie, nachdenken, Häuser bauen
2x Command & Conquer Alarmstufe Rot: Strategie, man muß vorausdenken und alles planen, es geht nicht nur um ballern, man muß auch z.B. Häuser bauen, coole Grafik, viele Möglichkeiten (Boote, Autos) (12), ist so schön brutal, Häuser bauen (10)
2x Resident Evil 1-3: die Gewalteinflüsse, einfach aus Spaß (14), macht spaß ist nicht nur brutal man muß auch nachdenken (10) (Horror-Action Adventure)
2x Commandos 1+2: real, manche scheinen nicht so wirklich, man muß von hinten anschleichen und angreifen (10)
2x WWF Smack Down 1+2 & WCW Nitro: (Wrestling) man muß kämpfen, Tricks sehen gut aus, man kann den Charakter selber erstellen, Videos drehen, Interviews machen (11)
Action- und Strategiespiele: das sie realistisch sind, die Waffen
Half-Life - Counter Strike: das sie realistisch sind, die Waffen (14) (3d-Shooter)
Rollenspiele: Fallout 1+2, die Story, die Grafik, die Frauen; weil es männlich ist (13) Heroes of Might and Magic (Rollenspiel)
Unreal Tournament: die Story, die Grafik, die Frauen, das Blut; weil es männlich ist (13) (3d- Shooter)
Hitman: die Story, die Grafik, die Frauen, das Blut; weil es männlich ist (13) (Ballerspiel) NBA: findet Basketball gut (12)
Bleifuss Fun: Rennspiel, die Explosionen (10)
Diabolo 2: Charakter aussuchen (Totenbeschwörer können Diener machen
(Lieblingscharakter)), Barbar, Magierin, Paladin, Amazone, Krieger), man muß gegen Orks, Zombies etc. und den Endgegner Diabolo kämpfen, Schwierigkeitsstufen lassen sich einstellen (normal, Alptraum, Höllenmodus), es gibt verschieden Welten, magische Waffen; wegen der Kämpfe, weil ich immer gewinne (11)
Quake3 Arena
Tekken: viel Kämpfen (10)
Grand Theft Auto: das man viele Menschen abballern kann, weil die Grafik gut und realistisch ist (10)
Final Fantasy8: macht Spaß ist nicht nur brutal man muß auch nachdenken (10)
Dino Crisis: macht Spaß, ist nicht nur brutal man muß auch nachdenken (10)
Ich möchte diese Aussagen an dieser Stelle nicht weiter hermeneutisch auseinanderklamüsern, ich denke teilweise ist die Faszinationskraft der gewalttätigen Inhalte gut zu erkennen. Auf Nachfragen, was denn an den gewalttätigen Szenen so toll sei, wußten die meisten der Kinder nicht so recht zu antworten, es ist halt irgendwie interessant. Es ist dem weiter nachzugehen, dass Gewalt- und Brutalospiele so faszinierend auf die Kinder wirken, sie aber nicht erklären können, was speziell daran so interessant ist. Mehr als Vermutungen kann man aus solchen Aussagen leider nicht schlußfolgern.
Fast alle genannten Lieblingsspiele sind mit gewalthaltigen Inhalten, ob nun Kampfspiele, Rollenspiele oder Simulationsspiele. Allen Spielen liegt der Kampf als entweder wesentlicher oder nebensächlicher Spielinhalt zu Grunde. Auffallend war, das die Mehrfachnennungen oft von Kindern oder Geschwisterpaaren genannt wurden die auch in ihrer Freizeit zusammen spielen.
Vgl.: Konsolen: Kampfspiele 50,8%, Sportspiele 54,0%, Jump&Run 48,4, Adventures 29,2%, Systemsimulationen 8,0%.
Computer: Kampfspiele 35,9%, Sportspiele 38,1%, Jump&Run 16,5%, Adventures 56,2%, Systemsimulationen 92,0%
Spielst Du öfter alleine am Computer oder eher mit anderen zusammen?
2x mit anderen zusammen
3x alleine
4x sowohl alleine als, auch mit anderen zusammen (Cousin, Bruder, Freunde)
Vgl.: Zusammenspiel mit anderen (oft): mit Freunden 50,6%, 28,2% mit Bruder, 13,4% mit Schwester, 10,3% mit Vater, 3,2% mit Mutter
Du spielst auch im Jugendzentrum mit dem Computer. Was findest Du dort gut und was findest Du schlecht, was würdest Du anders machen?
Gut: viele gute Spiele, manche Spiele, viele Spiele verschiedene Spiele die man auch ausleihen kann gute Technik die Computer, das es drei Computer gibt, gute Computer Adrian hat gezeigt wie ein Spiel zu laufen gebracht wird gucken ob’s neue Spiele gibt das man kostenlos spielen kann
schlecht: 3x das man immer abwechslnd spielen muß (nervt, kann nicht lange genug spielen) zu wenig Computer, zu wenig Rechner zu viel Lärm, kann sich nicht konzentrieren zu viele Leute zu pingelig mit der USK, die Sicherheit der Spiele (USK) kein Internet 2x Spiele sind kaputt oder geklaut
6. Interview mit einem Jugendarbeiter aus dem Jugendtreff Harsum
Die Fragen die ich mir zunächst überlegt hatte sahen so aus:
1. Wie sieht euer Computerangebot hier im Jugendtreff in Harsum aus? Was bietet Ihr an und wie wird das Angebot angenommen?
2. Um auf die Computerspiele zu sprechen zu kommen, welche Spiele werden von den Kindern bzw. Jugendlichen gerne gespielt und bevorzugt? (Spiele mit gewalttätigen Inhalten?) Wie alt sind die Kids, die hier spielen?
3. Weißt Du was die Spieler gerade an diesen Spielen gut finden und worin die Faszinationskraft von gerade den Spielen mit gewaltätigen Inhalten liegt? Warum fahren die Kids überwiegend auf die Spiele ab in denen das Blut fließt und Körperteile durch die Gegend fliegen?
4. Wie sehen die gesetzlichen Bestimmungen aus? Ich meine es gibt z.B. die USK, indizierte Spiele etc., werden bei euch diese Spiele die eigentlich für Erwachsene bestimmt sind, auch bei euch gespielt? (Wenn ja, wie geht Ihr damit um, wie begründet Ihr das?)
5. Konntest Du beobachten, ob solche Spiele einen Einfluss auf das Verhalten der Kinder haben?
6. Wäre eine Medienpädagogik die darauf abzielt Gewaltspiele weniger attraktiv erscheinen zu lassen nicht vielleicht besser? Oder glaubst Du, daß wäre nicht praktizierbar?
Die Antworten meines Interviewpartners sind kursiv gedruckt.
Welche Spiele werden bei euch gespielt? (Wer spielt? Was wird gespielt?)
Das ist unterschiedlich, also wir trennen da zwischen Kindern und Jugendlichen, d.h Kinder brauchen Spiele die, wo sie schnell einsteigen können, wo relativ schnell zu begreifen ist was zu tun ist, wo sie auch vergleichsweise fix die Sache lernen können. (...) Für Kinder haben wir jetzt Lenkräder angeschafft für Rennspiele, weil die halt relativ intuitiv zu bewegen und bedienen sind und weil das auf die Kids einen ziemlich hohen Reiz ausübt. Da sind also Rennspiele (Grand Prix 3), wobei das eher im Arcade-Modus ist, so Simulation is also nichts für die Kinder, ähm das spielen sie am meisten, dann haben wir noch so’n paar Sachen die so Comic artigen Charakter haben, aber bisher haben wir immer den Schwerpunkt auf Netzwerkspiele gelegt.
Und für die Jugendlichen was sind das für Spiele?
Das ist unterschiedlich, also das mit dem Rennen habe ich auch versucht, aber das kommt nicht so an, also was zur Zeit hier tierisch der Renner ist, ist das was hier gerade läuft, so’n Uraltspiel, Bomberman. Ähm natürlich 3D-Action Shooter im Netzwerk. Dann gibt’s ein paar Leute die ganz gerne Strategiespiele spielen, das aber weniger (...) weil bei Command & Conquer oder so da brauchst Du ja schon ne halbe dreiviertel Stunde bevor es zur Sache geht, bist die ganze Zeit am aufbauen. Ansonsten Unreal Tournament schwerpunktmäßig... Sachen die halt nicht indiziert sein sollten, also wir haben auch welche die indiziert sind, die sind aber nicht drauf, die wurden eigentlich nicht so angefasst. (...) Und das hier (Bomberman) da hab ich’se zu verführt, weil ich das aus Studiezeiten noch kannte, damit haben wir Nächte auf dem Amiga durchgezockt und dann dachte ich wenn uns das so gefallen hat, vielleicht gefällts ihnen auch (...) hat sich eine Spielergemeinde entwickelt, die das ganze im Netzwerk gleichzeitig spielen.
Was für mich jetzt interessant ist sind z.B. diese 3D-Action Shooter, da gibt es ja von der USK diese Einstufungen, die 3D-Action Shooter sind ja erst ab 18 Jahren, obwohl das sind ja nur Empfehlungen, aber die werden hier aber auch gespielt?
Ja, ja mit diesen Usk - Sachen da setzen wir uns mit dem Arsch drauf, sofern es sich um Jugendliche handelt. Also bei Kindern achten wir schon drauf. Also bei Filmen würde ich schon drauf achten... (weiter leider nicht zu verstehen, es werden keine Spiele gespielt die indiziert sind, die Jugendlichen wollen, das wohl auch gar nicht unbedingt) wenn die Leute unbedingt Quake3 spielen wollen würden, dann würde ich das verhindern. (...) Unreal Tournament was die Kids ganz gerne spielen, oder viel spielen, da würden wir uns wahrscheinlich mit dem Arsch drauf setzen wenn die das indizieren würden. Ähm, bei Kindern, (...) so sachen wie Turok auf den Nintendo, was eigentlich aus meiner Sicht harmlos ist, gebe ich Ihnen nicht. Muß auch nicht sein.
Warum wäre euch, oder dir das egal wenn...
Weil es ist völlig verfehlt, weil das also, an den Lebenswelten der Kids total vorbeigeht. Also das Ding ist halt, daß Du dich, Du kannst dich einfach nicht zurückziehen, so wie es mit Alkohol und Rauchen ist, (erzählt wie er über rauchen denkt) Rauchen ist gesetzlich verboten bei den spielen ist das etwas anders.
Das Ding is halt das die ganz andere Sachen spielen, also ich versuche eher, bei der Auswahl, mit den Kids bei den Spielen Qualitätskriterien anzulegen, also so’n weltbekanntes Spiel, wo so Leichen durch die Gegend wandeln, mensch wie heißt den dass jetzt...
Resident Evil?
Ja genau. Ja den 3. Teil hier, den müßt ihr unbedingt besorgen und so und ich halte das einfach für ein schwachsinniges Spiel, das ist einfach reiner, es is vom spielen her einfach richtig blöde, ich glaube es gibt auch gar keinen Multi-Player Mode, vermute ich mal, sowas würde ich einfach nicht besorgen, aus dem Grund halt, weil es ein schlechtes Spiel ist. Ich habe immer wieder gesehen wie Jugendliche auf Dinge in Quake z.B. reagiern, die zu Irritierung führen, also ich weiß warum die indiziert werden, das ist es halt wenn Leichen noch zerschossen werden können, das mögen die gar nicht.
Und das is, wie die Leute darauf reagieren Nicht-Spieler sagen „Ieh“ und Spieler amüsieren sich und zwar nicht etwa „haha“ zerschossen, sondern die freuen sich über diesen grafischen Effekt einfach, was die Leute sich für Mühe gemacht haben mit dem Spiel und ähm daher halte ich die Theorie das das verrohend wirke, ob das zugrundegelegt wird bei der USK weiß ich nicht, ...ich habe deren Webseite und die Einstufungen wie auch immer, zumindest was die Indizierungspraxis angeht halte ich das für Unsinn, womit ich nicht sagen will, das alles für alle Alterstufen prinzipiell geeignet ist. Also Resident Evil ist schon ne Sache die man unter 12jährigen nicht antun sollte. Wobei einfach die Kids das einfach schon gesehen haben und dann hast Du halt ein Problem, wenn Du dich einfach aus dieser defakto Realität rausziehst und sagst damit haben wir nichts zu tun. Es sei den es wäre vorgeschrieben dann müßte man...
Also gibt es für die Jugendarbeit keine speziell keine gesetzlichen Bestimmungen wie damit umzugehen ist mit dieser Software? Oder mit diesen Spielen?
Keine spezifischen. Also es gibt meinen Wissens keine spezifischen. (...) Also wenn du dich auf einen Position zurückziehst die Jugendliche nicht mehr verstehen können, dann machst Du dich unglaubwürdig. Jugendliche müssen nicht alles nachvollziehen können, aber ich muß ihnen erklären können warum ich bestimmte Sachen wie und wie mache, mit rauchen ist das relativ leicht, das Jugendschutzgesetz kennt jeder, das hängt in den Kneipen, das haben die alle schon mal gesehen. Das verstehen die halt, da gibt es keinen Spielraum. Ähm bei Spielen ist das halt anders, weil die Kids haben das Zeug, also ich denke, wenn Du irgenwas haben willst, was indiziert ist, dann frag irgendwelche Kids. Und vor allem diese Indizierungspraxis is Grund sich das zu besorgen. Nicht die Qualität des Spiels, sondern boah ey das is besonders krass, das mußt du dir unbedingt angucken...und so. Oder genauso diese Sachen die so vor 10-15 Jahren geschockt haben so wie Anti-Türken Test und solche Sachen so Nazispiele, sind natürlich vom Spielprinzip natürlich super-öde, niemand würde freiwillig sowas spielen, wenn nicht dieser Schock-Faktor oder dieses potential andere damit zu ärgern oder zu schockieren drin wäre. (...) ich weiß nicht genau warum sich manche Spiele bei den Jugendlichen durchsetzen, warum die welche Sachen auf Dauer spielen und andere nicht, weil ich den Unterschied zwischen Unreal Tournament und Quake3 nicht sehen kann, außer in Nuancen...
Also diese Faszinationskraft von gewalttätigen Spielen überhaupt kannst Du dir auch nicht erklären?
Doch natürlich kann ich mir das erklären, doch zunächst muß man erstmal den Begriff „gewalttätig“ überlegen. Ich denke nicht, dass die Jugendlichen oder Spieler prinzipiell in dem Augenblick nicht das Gefühl haben gewalttätig zu sein, genauso wahrscheinlich wie ein Schachspieler nicht das Gefühl hat gewalttätig zu sein, der Geräuschkulisse nach ist das ein gewatlttätiges Spiel, man schmeißt Bomben und versucht die anderen in die Luft zu sprengen, ähem trotzdem is ja der Ton, der dabei zu hören ist, also die Äußerungen der Spieler sind ja eindeutig immer nur freundliche, freundschaftliche, fröhliche und amüsierte so. Das heißt, dass is also keine gewaltförmige Tätigkeit die da ausgeübt wird.
Um seine Aussagen nocheinmal abschließend auf einen Nenner zu bringen:
Er hält die Medienwirkungstheorien für Quatsch, er verweist auf die Studie „Computer Games and Australians Today“ die bei http://www.usk.de zum Download zur Verfügung steht. Er begründet dies damit, das sich in den Studien zur Wirkungsforschung keine eindeutige Tendenz zur Aggression bei Kindern ausmachen, die gewalthaltige Computerspiele spielen. In der Games and Australien Today - Studie wurde eine gesteigerte Aggression gegen Objekte ausfindig gemacht. Es ist eine Frage von Ursache und Wirkung. Sind Computerspiele wirklich die Ursache wenn Kinder zu Gewalt neigen? Desweiteren hält er den Bewahrpädagogischen Aspekt für nicht sinnvoll, da seiner Meinung nach ein Bewahren wollen vor gewalthaltigen Computerspielen an den Lebenswelten der Kinder und Jugendliche vorbei geht. Hierzu habe ich im USK-Forum im Internet noch die Aussage eines Heranwachsenden gefunden:
6.1 Die Meinung eines Jugendlichen
„Hallo,
Ich weiß ja nicht ob das einer von der USK, BPJS usw. liest, aber eins kann ich euch sagen, Ihr wist nicht was Ihr für einen Quatsch macht. Spiele wie Half - Life, Quake 3 Arena, Ureal Tournament und No one Lives Forever sind keine brutalen Spiele !!!
Eine Frage möchte ich von Ihnen beantwortet haben. Was ist der Unterschied wenn das Blut grün ist, oder wenn man auf Roboter schießt statt auf Menschen? Der Effekt ist derselbe, man schießt !!! Klar für Geisteskranke ist so etwas brutal, aber genau so brutal wie mit rotem Blut.
Die Brutalität kommt von den Elternhäusern und von dem Umgang in dem sie aufwachsen. Wenn die Eltern sich nicht um Ihre Kinder kümmern, was soll man da machen?
Ich war mal mit solchen Kerlen in einer Klasse. Diese Kerle sind bekannte Verbrecher und Alkoholiker. In den Sommerferien mussten 2 von den ins Jugendgefängnis (dort waren sie schon einmal). Nun einige hatten Schwierigkeiten in eine weiterführende Schule zu kommen oder eine Lehre zu machen. Auch wer mit solchen Kerlen befreundet ist, wird mit der Zeit so wie die anderen sein.
Außerdem, wenn die Jugend ein indiziertes Video oder PC - Spiel will, dann bekommt sie es !!! Entweder in der Bibliothek, Internet (Bestellung) oder vom Erwachsenen. Notfalls wenden manche Jugendliche die ganz illegale Seite. Sie versuchen an einer Raubkopie ran zu kommen.
Ich persönlich bin jetzt auf der 2jährigen Wirtschaftsschule und habe Half - Life, Half - Life Oppsosing Force, Deus Ex, Quake 3 Arena (Demo), Ureal Tournament und No on Lives Forever (Demo) gespielt. Alle Vollversionen sind Importspiele ausser Deus Ex!!! Die deutsche Deus Ex Version ist ab 18 und ich konnte sie allein im Karlstatt kaufen. Karlstatt hat sogar das Preisschild auf die Altersangaben geklebt. Ich bin weder Brutal noch im Gefängnis gewesen und ein guter Schüler bin ich auch. Befreundet war ich nicht mit diesen Kerlen.
Gruß, Gruß Stephan“14
7. Herausforderungen für die offene Jugendarbeit - Weitergehende Überlegungen zur Nutzung von Computerspielen in der Jugendarbeit
Die Indizierungspraxis und Altersfreigaben sind für die Jugendarbeit wenig nützlich, Kinder besitzen indizierte Spiele und können sich mühelos alles besorgen. Für den Einsatz von Computerspielen in der offenen Jugendarbeit können sie als Richtschnur dienen, welche Spiele für Kinder geeignet sind und welche für ältere Jugendliche.
Die offene Jugendarbeit kann sich nicht aus der Verantwortung stehlen indem sie, in der Praxis bestimmte Spiele verbietet, nur weil diese z.B. erst ab 18 Jahren freigegeben sind. Die Kinder und Jugendlichen spielen diese Spiele, wenn nicht im Jugendzentrum dann eben zu Hause oder bei Freunden. Wenn der Bedarf bei den Kinder nach diesen Spielen da ist, dann hat das auch seinen Grund und sollte ernst genommen werden und nicht durch ein Verbot aus dem Sichtfeld des Pädagogen geschoben werden. Es nützt auch wenig den Kindern „Altersgerechte“ Spiele anzubieten, da sie diese dann auch nicht wollen. Vielmehr wäre es sinnvoll auch die „verbotenen“ Spiele mit den Kindern zu spielen und die Inhalte und das Gespielte zu thematisieren. Das Spielen dieser Spiele sollte natürlich keine Dauereinrichtung oder zum gewohnten Spiel werden, sondern sich deutlich als einzelne Aktion mit gezieltem einwirken auf die Kinder und dem Hinterfragen des gespielten ausdrücken. Vorher wäre natürlich zu klären ob die Eltern damit einverstanden sind und ob es denn überhaupt stimmt, das „diese“ gewalttätigen Spiele auch zu Hause oder bei Freunden bereits gespielt werden.
„Wenn beispielsweise mein Kind oder ein Jugendlicher in einer Einrichtung offener Jugendarbeit ein Computerspiel mit gewaltverherrlichenden Inhalten spielt, dann mischt man sich pädagogisch professionell nicht damit ein, daß man dieses Spiel verbietet, sondern daß man sich mit dem Spielenden über die inhaltlich gegebenen Wertvorstellungen (der Gewaltverherrlichungen) auseinandersetzt. Das heißt, daß man ihm die für unsere Kultur geltenden Wertvorstellungen entgegensetzt. Man wird in aller Regel dann erfahren, daß es für den Spaß am Spiel gar nicht darum geht, sondern um die strukturell-mediale Qualität des Spiels. Man hat dann schon erreicht, was man erreichen kann, daß sich der Spielende bewußt ist, daß er im Inhaltsaspekt ein Spiel spielt, das abzulehnen ist. Er mag es jetzt ruhig weiterspielen, denn er hat die Differenz von dem, was am Spiel Lust macht, und dem, was am Spiel normativ zu verwerfen ist, vollzogen und damit den geltenden Werthorizont akzeptiert.“15 Im Bereich Medienpädagogik nennt Fromme dieses pädagogische Verhalten eine „partikulare Einmischung“.
7.1 Aktzeptierende Medienpädagogik
Fromme und Meder verweisen auf eine aktzeptierende Medienpädagogik, wonach der Ausgangspunkt bei Computerspielen mit Kindern und Jugendlichen, die Spiele sind, die sie selber mitbringen bzw. die sie spielen wollen. Dies entspräche einer Lebensweltorientierung an der vorhandenen Computerspielkultur.
„Gerade jene Spiele, die aufgrund ihrer (z.B. gewalthaltigen) Inhalte zum moralischen oder ethischen Streit provozieren, sollten nicht tabuisiert werden, denn das Spielen solcher Spiele wird damit nicht verhindert. Allenfalls wird durch deren Ausschluß bewirkt, daß diese Spiele und ihre Tabuthemen ohne jegliche pädagogische Beteiligung in der Peergroup verhandelt werden.“16
Ich denke die Annahme, dass ein Kind mit Computererfahrung sehr wohl den Unterschied zwischen der virtuellen Welt des Computers und der realen Welt erkennt, und dass diese Behauptung zweifelsohne bei Kindern mit geringer oder keiner Computererfahrung nicht zutrifft, ist nachvollziehbar. „(...) dass die Spieler von Bildschirmspielen in der Regel sehr genau wissen, dass sie sich in einer virtuellen Welt aufhalten und dass die dort angwendeten Schemata auch nur dort Gültigkeit besitzen. Einen Schuss in der virtuellen Welt abzufeuern, bedeutet etwas ganz anderes und ist mit anderen Konsequenzen verbunden, als in der realen Welt.“17
Es gibt verschieden Gründe warum es in der offenen Jugendarbeit oft nur selten oder kein Computerspiel-Angebot gibt. Einerseits fehlt es vielleicht an der technischen Ausrüstung und finanziellen Mitteln andererseits gibt es aber auch oft noch einen Hang zur Bewahrpädagogik (oder mangelnde Kompetenz, oder fehlende Zeit...). Viele Jugendarbeiter/innen sehen ihre Aufgabe darin Alternativen zur Computerspiel und Unterhaltungswelt anzubieten. Dies entspricht allerdings nicht einer lebensweltorientierten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Um einen Einblick in das Faszinierende des Computerspiels zu erhalten, sollten Pädagogen sich auf die Spiele einlassen und sie selbst spielen. (Kompetenz, Bewertung der Spiele, als Kommunikations- und Interaktionsgrundlage); (Beobachten, Zuhören, Kennenlernen und Mitspielen)
Wie könnte in der Jugendarbeit künftig mit Computerspielen und den Spielern umgegangen werden?
- „das Spektrum der Spiele zu vergrößern, also dazu anzuregen, auch mal andere Spiele und Spielgenres auszuprobieren;
- unterschiedliche Spielvorlieben als Anlaß für diskursive Auseinandersetzungen, spielerische Wettbewerbe und andere pädagogische Akionen statt als Anlaß für Verbote oder Ausgrenzungen zu nutzen;
- Computerspiele durch die Heranwachsenden wie durch pädagogische Mitarbeiter zu beurteilen, wobei man z.B. die von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene interaktive Datenbank Search&Play benutzen kann, um solche Beurteilungen auch in einer größeren Öffentlichkeit bekann zu machen;
- Computerspielideen in gegenständliches Spiel zu übertragen, vom Geländespiel nach dem Vorbild von Pac Man (...) über die reale Konstruktion einer Incredible Machine bis hin zu thematischen Spielaktionen, in denen Computerspiele neben anderen Elementen eingebaut werden (z.B. das Spiel Sim City im Kontext eines Projekts zur Zukunft der Stadt); solche freizeit- bzw. erlebnispädagogische Projekte und Inszenierungen können als Brücken zwischen virtuellen und realen Erlebnisräumen betrachtet werden; (z.B. Breaking-the- rules Ansatz)
- pädagogische Einrichtungen zu vernetzen, womit nicht nur ein Zugang zum Internet und den dort abrufbaren Spielen, Spiellösungen, MUD’s, Datenbanken usw. möglich wäre, sondern auch eine einfache Kommunikation mit anderen Einrichtungen etwa mit Hilfe von e-Mail oder im Rahmen eigener Diskussionsforen.“18
8. Zusammenfassung und eigene Meinung
Meiner Meinung nach ist eine Praxis der Jugendarbeit, die zwar Computerspiele anbietet, sich dabei aber an Bewahrpädagogischen Vorstellungen ausrichtet, also Spiele einer bestimmten Alterseinstufung kategorisch ausklammert, für nicht angemessen und altmodisch. Würde ich mich z.B. in meiner Arbeit im Jugendzentrum in Sarstedt fest an die Empfehlungen der USK halten, hätten wir wenige Spiele zur Verfügung, die von den Kindern und Jugendlichen gerne gespielt werden. Natürlich sollte durch ein Angebot bestimmter Spiele nicht eine Nachfrage geweckt werden, die sonst nicht aufgekommen wäre, aber Spiele die z.B. mit „nicht geeignet unter 16 Jahren“ eingestuft werden, aber durchaus gerne von jüngeren gespielt werden, sollten meiner Meinung nach in der offenen Jugendarbeit thematisiert und auch gespielt werden. Nicht einfach aus dem Grund, weil die Kinder es wollen und man sie also z.B. im Hinblick auf die Konkurrenz der kommerziellen Unterhaltungsangebote einfach gewähren läßt, sondern aus dem Grunde, die pädagogischen Augen nicht vor den Lebenswelten und Realitäten der Kinder zu verschließen, sondern mit ihnen zu erleben und diskutieren. Nur durch den Erwerb einer eigenen Spielekompetenz, einem feinfühligen Riecher für den Entwicklungsstand der Kinder, also einer Überprüfung, ob ein Kind die Reife für bestimmte Spiele besitzt oder nicht und der Fähigkeit die scheinbar pädagogische Unmöglichkeit und Unverantwortlichkeit auszuhalten, Kindern im Rahmen von Spielen Dinge zuzugestehen die unter Umständen ethisch oder moralisch zu verwerfen sind, darin liegt meiner Meinung nach eine Möglichkeit ein Computerspieleangebot praktikabel anzubieten. Denn, wer den Kindern immer nur mit dem Verweis auf das Verbot bestimmter Spiele kommt, ist nicht glaubwürdig, die Spiele sind ja vorhanden und werden auch gespielt. Man kann z.B. ein Rauchverbot für Jugendliche unter 16 Jahren nicht gleichsetzen mit einem Computerspielverbot. Schutz ja, aber bitte vor den wahrhaftigen Gefahren. Ein Kind oder einen Jugendlichen vor einem Spiel zu schützen, welches ihm Spaß und Freude bereitet erscheint mir ein wenig wirklichkeitsfern, denn Spiele die einen Spieler abstossen oder ängstigen werden in der Regel auch nicht weiter gespielt. Das besondere Interesse für gewalthaltige Spiele bei Kindern und Jugendlichen ist Folge einer Lebenswelt in der es kaum noch Geheimnissse für Heranwachsende gibt.
Allerorten, in der Tageszeitung oder der Bravo, in der Lieblings TV-Sendung, oder in der Schule, in der Familie und auch in Computerspielen ist Gewalt ein viel präsentes und oft auch unhinterfragtes Thema. Die Gesellschaft präsentiert sich den Kindern als eine, in der Gewalt mal probates Mittel, mal als Symbol von Männlichkeit, und mal als unmenschliche Handlungsweise dargestellt wird. Vielleicht liegt auch darin ein Grund warum die gewalthaltigen Computerspiele solch eine Faszinationskraft auf einen Teil der Heranwachsenden ausübt. Wer darauf hofft ausschließlich durch Regelungen oder Gesetze, die Computerspielpraxis von Kindern und Jugendlichen zu bestimmen, ist für mich nur schwer nachvollziehbar, denn ein Spiel, so brutal es auch sein mag, bleibt ein Spiel und wird, wie ich meine, auch nur von denen gespielt, die das Spielgeschehen angemessen verarbeiten und bewerten können. Das vermeintliche Gefährdungspotential wird lediglich in für Sozialpädagogen nicht mehr zugängliche Bereiche, in die Privatspähre der Peer-Groups und Kinderzimmer, verlagert. Es ist natürlich auch Aufgabe der Eltern sich mit Ihren Kindern und den gespielten Spielen auseinanderzusetzen, doch mangelt es da auf Seiten der Eltern noch an Computerkompetenz, welche die jetzt heranwachsende Computer-Kid-Generation vielleicht später wett macht. Außerdem bin ich der Meinung, dass an den Schulen, die zwar gerade durch die Aktion „Schulen ans Netz“ medientechnisch ein bißchen wiederbelebt werden, mehr geschehen muß. Es müßte ein Medienunterricht eingeführt werden, in welchem die Nutzungsmöglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien, Medienethik und auch der Bereich der Computerspiele eingehend diskutiert wird. Schaut man sich z.B. mal auf einer LAN-Party (Local-Area-Network, also eine Netzwerkparty) um, auf der hauptsächlich Ego-Shooter-Spiele gespielt werden, so ist schnell zu erkennen, das es sich bei den Spielern keinesfalls um zu Gewalt neigenden Computerspiel-Freaks handelt, sondern um Jugendliche, die sich vor allem auch durch eine computertechnische Kompetenz ausweisen und das ein hohes Maß an Spielfreude, Hilfsbereitschaft und Kontaktfreude gegeben ist. Computerspiele haben ganz bestimmt ein Wirkung auf Kinder und Jugendlich, aber ich glaube nicht das diese in überwiegendem Maße negativ, sondern eher positiv ist.
9. Literaturverzeichnis:
Laudowicz, Edith: Computerspiele - Herausforderung für Eltern und Lehrer, Köln, 1998
Fromme, Johannes; Meder, Norbert; Vollmer, Nikolaus: Computerspiele in der Kinderkultur, Opladen, 2000
Fritz, Jürgen ; Fehr, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch Medien: Computerspiele, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 1997
Schwab, Jürgen; Stegmann, Michael: Die Windows-Generation - Profile, Chancen und Grenzen jugendlicher Computeraneignung, München, 1999
BpjS Aktuell - Amtliches Mitteilungsblatt 4/2000
Fehr, Wolfgang/Fritz, Jürgen; Videospiele und ihre Typisierung, in: Bundeszentrale für politische Bildung; Computerspiele; 1993
Fehr, Wolfgang/Fritz, Jürgen; Videospiele als medienpädagogische Herausforderung, in: Bundeszentrale für politische Bildung; Computerspiele; 1993
Fritz, J. (Hrsg.):Warum Computerspiele faszinieren. Empirische Annäherung an Nutzung und Wirkung von Bildschirmspielen. Weinheim u.a.: Juventa, 1995
Anhang A. Anregungen zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Thama
Die folgenden Fragestellungen die insbesondere auch in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit im Hinblick auf die Nutzung von Computerspielen mit gewalthaltigen Inhalten interessant sind und im Austausch über die Spiele von Nutzen sein könnten sind mir während der Arbeit am dem Referat durch den Kopf gegangen. Zum Teil wurden die Fragen auch im Referat behandelt. Ich habe sie in diesen Anhang mit aufgenommen, weil es sich teilweise auch um Fragen handelt die man den Kindern und Jugendlichen direkt stellen kann, wenn man über die Spiele diskutiert.
- Wird die Gewalt im Spiel offen oder versteckt, symbolisch oder real ausgeübt?
- Welche Gefühle lösen die Gewalthandlungen und Darstellungen aus? Was wird beim spielen empfunden? (Angstlust, Schadenfreude, Machtgefühle, Wut, Destruktionslust, Rachegelüste, Überlegenheit, Ohnmachtsgefühle können ausgelebt werden, man darf böse sein ohne eine Strafe befürchten zu müssen, man „(...) wird zeitlich begrenzt zum Herrscher über ganze Völker und Kontinente, über Raumstationen und Schlösser.“19 Und werden die Gefühle von der virtuellen in die reale Welt übernommen?
- Ist der Spieler in der Lage die gespielte Gewalt im Anschluß an das Spiel zu reflektieren und die gespielte Gewalt anders einzuordnen als die reale Gewalt?
- Welches Weltbild vermitteln gewalttätige Spiele? Suchen die Spieler in den Heldenfiguren z.B. Vorbilder oder umsetzbare Verhaltensweisen für die Realität?
- Wie kann der Faszination von „Gewaltspielen“ entgegengewirkt werden? Welche Argumentate hat die Medienpädagogik um Gewaltspiele weniger attraktiv erscheinen zu lassen?
- Haben die gewalttätigen Spiele einen gesellschaftlichen Kontext? (z.B. Kriegssimulationen, Verbrechersimulationen) Welche Rolle spielen diese Handlungen im Alltag der Jugendlichen?
- Werden die „Gewaltakte“ thematisiert? (zu Hause, Freunde, Jugendzentrum...)
- Was fordern die Spiele den Kindern und Jugendlichen ab? Welche Denkschemen unterstützen die Spiele? (z.B. Kriegsspiele: aggressive statt friedliche Konfliktlösung, Strategie und Taktik (Berechnung des vermeindlichen Kontrahenten), High-Tech Mentalität, keine Gnade (Härte), Ausblendung der Folgen kriegerischer/gewalttätiger Akte (abstrahieren von wirklichen Kriegssituationen), nichtzuletzt die Relativierung bzw. das Umschreiben von Geschichte (wenn auch nur virtuell) in historisch orientierten Kriegsspielen)
Anhang B.: Folie 1 & Folie 2
[...]
1 Wegener-Spöhring, Gisela: Spiel und Aggressivität, in Handbuch Medien: Computerspiele, S. 264
2 Laudowicz, Edith: Computerspiele, S. 65
3 Fromme, Johannes; Meder, Norbert: Computerspiele in der Kinderkultur, S. 231
4 vgl. Fritz, 1995, S. 25/26; Fehr/Fritz, 1993, S. 73
5 Fromme, Johannes; Meder, Norbert: Computerspiele in der Kinderkultur, S. 11
6 Fritz, Jügen: Macht, Herrschaft und Kontrolle im Computerpiel, S. 193 in: Handbuch Medien: Computerspiele
7 zitiert nach: Ludowicz, Edith, S. 72, 1998
8 Schindler, F. & Wiemken, J: „Doom is invading my dreams“, in Handbuch Medien: Computerspiele: S.291
9 Fritz, Jürgen (1999): Zum Problem des Print-Transfers. Unveröffentlichtes Manuskript an der FH Köln, S.5; zitiert nach: Esser, Heike; Witting, Tanja: „Beeinflussen Computerspiele unser Denken und Handeln in der realen Welt?“, in: BpjS Aktuell - Amtliches Mitteilungsblatt 4/2000, S. 10
10 vgl. Esser, Heike; Witting, Tanja: „Beeinflussen Computerspiele unser Denken und Handeln in der realen Welt?“, in: BpjS Aktuell - Amtliches Mitteilungsblatt 4/2000, S. 10
11 Schwab, Jürgen; Stegmann, Michael: Die Windows-Generation, S. 140-141
12 Büttner, Christian: Gewalt im Spiel, Zum Verhältnis von phantasierter zur realen Gewalt, Seach & Play plus, Bundeszentrale für politische Bildung; zitiert nach: Ludowicz, Edith, S. 66, 1998
13 Ludowicz, Edith: S. 67, 1998
14 http://www.usk.de/Forum00-3/ ; 2.1.2001
15 Fromme, Johannes; Meder, Norbert: Computerspiele in der Kinderkultur, S. 234
16 Fromme, Johannes; Meder, Norbert: Computerspiele in der Kinderkultur, S. 238
17 Esser, Heike; Witting, Tanja: „Beeinflussen Computerspiele unser Denken und Handeln in der realen Welt?“, in: BpjS Aktuell - Amtliches Mitteilungsblatt 4/2000, S. 9
18 Fromme, Johannes; Meder, Norbert: Computerspiele in der Kinderkultur, S. 240
Häufig gestellte Fragen zu "Computerspiele, Gewalt und Jugendarbeit"
Was ist das Thema des Referats "Computerspiele, Gewalt und Jugendarbeit"?
Das Referat behandelt den Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt im Leben von Kindern und Jugendlichen, sowie die Rolle der Jugendarbeit im Umgang mit Computerspielen, insbesondere solchen mit gewalthaltigen Inhalten, in Jugendzentren.
Was sind die Hauptursachen für Gewalt bei Kindern und Jugendlichen, die im Text genannt werden?
Der Text nennt wachsende Orientierungslosigkeit, Verunsicherung, Perspektivlosigkeit, Konsumorientiertheit, Armut, Isolierung, Ausgrenzung und Gewalt in den Medien als Ursachen für Gewalt bei Kindern und Jugendlichen.
Welche Grundmuster werden in Computerspielen unterschieden?
Die Grundmuster der Computerspiele umfassen Kampf, Erledigung bestimmter Aufgaben, Bereicherung und Steigerung des Profits, Verstärkung (personale Ausdehnung), Verbreitung (räumliche Ausdehnung), Ziellauf, Prüfung (der eigenen Taktik oder Strategie), Bewährung und Ordnung.
Warum werden gewalthaltige Computerspiele so gerne gespielt?
Gewalthaltige Computerspiele werden vorwiegend von Jungen gespielt, da sie im Spiel die "Initiationsriten einer männlich geprägten Gesellschaft" durchleben können. Sie bieten eine Fluchtmöglichkeit aus dem erlebnisarmen Alltag und sprechen die Angstlust an. Das Gefühl von Kontrolle, Spielbeherrschung und Erfolg trägt ebenfalls zur Faszination bei.
Welche theoretischen Modelle der Medienwirkungsforschung werden im Text erwähnt?
Die Stimulationstheorie, die Inhibitionstheorie, die Habitualisierungstheorie und die Katharsisthese werden im Text erwähnt. Diese Theorien versuchen, die Auswirkungen des Konsums von Gewalt in Medien auf das Verhalten zu erklären.
Was wurde bei der Befragung zur Nutzung von Computerspielen im Jugendzentrum Klecks in Sarstedt herausgefunden?
Es wurde festgestellt, dass die befragten Jungen (Alter 10-14 Jahre) Vielspieler sind, die oft mehrere Stunden täglich Computer spielen. Lieblingsspiele sind oft Kampf-, Strategie- und Rollenspiele mit gewalthaltigen Inhalten. Viele spielen sowohl alleine als auch mit anderen zusammen.
Welche Meinung vertritt der interviewte Jugendarbeiter aus Harsum bezüglich USK-Einstufungen und indizierten Spielen?
Der Jugendarbeiter betrachtet USK-Einstufungen für Jugendliche oft als irrelevant, da sie an den Lebenswelten der Jugendlichen vorbeigehen. Er achtet jedoch auf die Qualität der Spiele und vermeidet solche, die er für unsinnig oder schädlich hält, unabhängig von der Indizierung. Er hält es für wichtig, mit den Jugendlichen im Gespräch zu bleiben und ihnen zu erklären, warum er bestimmte Entscheidungen trifft.
Was ist "akzeptierende Medienpädagogik" im Kontext des Referats?
Akzeptierende Medienpädagogik bedeutet, dass der Ausgangspunkt bei Computerspielen mit Kindern und Jugendlichen die Spiele sind, die sie selbst mitbringen bzw. spielen wollen. Es wird empfohlen, jene Spiele, die aufgrund ihrer (z.B. gewalthaltigen) Inhalte zum moralischen Streit provozieren, nicht zu tabuisieren, sondern zum Anlass für pädagogische Auseinandersetzungen zu nehmen.
Welche Herausforderungen für die Jugendarbeit werden im Zusammenhang mit Computerspielen genannt?
Die Jugendarbeit sollte sich nicht vor der Realität verschließen, dass Kinder und Jugendliche auch Spiele spielen, die nicht altersgerecht sind. Es wird empfohlen, die Spiele gemeinsam zu spielen, die Inhalte zu thematisieren und die Kinder zur Reflexion anzuregen. Eine reine Verbotsstrategie wird als wenig zielführend betrachtet.
Was ist die persönliche Meinung des Autors des Referats zur Thematik?
Der Autor hält eine Jugendarbeit, die Computerspiele anbietet, sich aber an Bewahrpädagogischen Vorstellungen ausrichtet und Spiele einer bestimmten Alterseinstufung kategorisch ausklammert, für nicht angemessen und altmodisch. Eine eigene Spielekompetenz, ein feinfühliger Riecher für den Entwicklungsstand der Kinder und die Fähigkeit die scheinbar pädagogische Unmöglichkeit auszuhalten, Kindern im Rahmen von Spielen Dinge zuzugestehen die unter Umständen ethisch oder moralisch zu verwerfen sind, ist für den Autor eine Möglichkeit ein Computerspieleangebot praktikabel anzubieten.
- Arbeit zitieren
- Sascha Jankowski (Autor:in), 2000, Computerspiele, Gewalt und Jugenarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104367