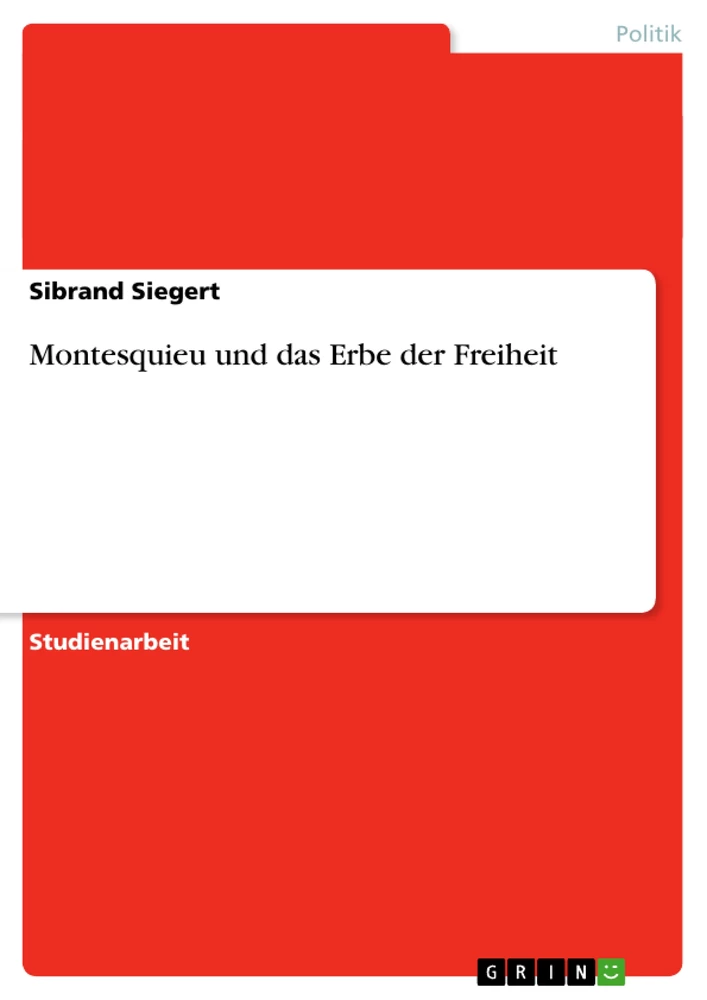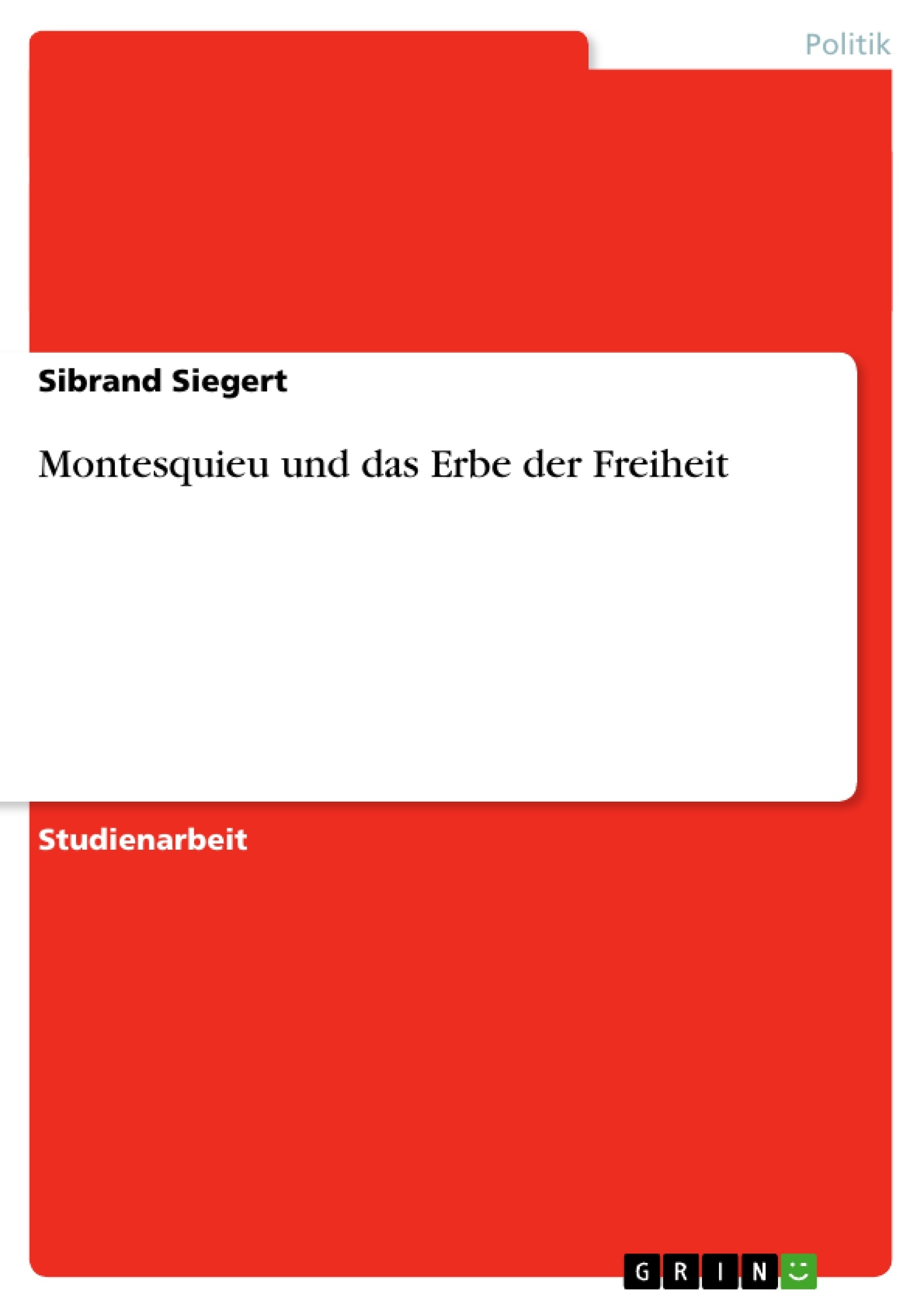Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Montesquieus Leben und Werk im Hintergrund der Aufklärung
3. Montesquieus Gedanke der Gewaltenteilung
4. Der Einfluss Montesquieus auf die amerikanische Verfassung
5. Der schwere Umgang der Menschen mit der Freiheit
5.1. Das Wahlrecht als Indiz freiheitlicher Demokratien
5.2. Die Furcht vor der Freiheit
6. Schlussbetrachtung
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Leben und Werk des französischen Schriftstellers und Staatsphilosophen Charles de Montesquieu. Selbstverständlich geht diese Niederschrift in kurzer Form auf die Biographie Montesquieus ein, und versucht sein Leben im historischen Kontext der Zeit zu betrachten. Der Hauptteil der Arbeit gestaltet sich quasi in zwei Unter- punkte. Natürlich werden Montesquieus Gedanken über das Modell der Gewaltenteilung be- handelt sowie sein Einfluss auf die Väter der ersten demokratischen Verfassung der Ver- einigten Staaten von Amerika. An diesem Beispiel soll auch kurz der Versuch unternommen werden, die Bedeutung Montesquieus für die modernen Demokratien darzustellen. Den die Verfassungsgeschichte der USA antizipiert nicht nur eindeutig die Namen Alexander Hamil- ton, James Madison sowie den ersten Präsidenten George Washington - auch der Name Charles de Montesquieu gehört eindeutig in das Anfangsgeflecht des ersten praktischen Ver- suchs der Gewaltentrennung oder Gewaltenverschränkung. Als zweiten großen Schwerpunkt hat sich diese Arbeit zum Ziel gesetzt, einen kleinen Ansatz auf die Frage zu finden, warum die Kinder der Freiheit Anfang des 20. Jahrhunderts unfähig waren, diese zu nutzen, da doch ihre Eltern das Bäumchen der Freiheit mit so viel Blut begossen hatten. Das heißt, es soll versucht werden eine Antwort darauf zu geben, warum die Menschen - vor allem der mitt- leren und unteren Schichten - nicht in der Lage waren, mit dieser politischen Freiheit umzu- gehen. Die Frage, die sich quer durch die Arbeit zieht ist, warum nach den Erfolgen der französischen Revolution und des funktionierenden Projekts der ersten modernen Demokratie in den USA die neu gewonnenen Mitbestimmung am politischen und sozialem Leben kaum genutzt wurde, und statt dessen die Völker mit offenen Armen in den Totalitarismus Europas des 20. Jahrhunderts und damit in die Katastrophen von zwei Weltkriegen gelaufen sind.
2. Montesquieus Leben und Werk im Hintergrund der Aufklärung
Charles de Secondat, Baron de La Bréde et de Montesquieu wurde am 18. Januar des Jahres 1689 auf dem Schloss La Bréde nahe der Südfranzösischen Stadt Bordeaux geboren. Frank- reich wurde zu der Zeit schon im 47-sten Jahr vom Sonnenkönig Ludwig XIV. und seinem Absolutismus, sowie vom wirtschaftlichen Presssystem des Merkantilismus des Wirtschafts- ministers Colbert regiert. Ludwig XIV. sollte noch weitere 26 Jahre am Leben bleibe, doch das Ende seiner Ära und der drohende Staatsbankrott warfen schon ihre Schatten voraus.
Was war passiert? Seit Ende des 17. Jahrhunderts verschafften sich von England ausgehend die Aufklärer Gehör. Das vom fernöstlichen Handeln zu Wohlstand gekommene Bürgertum verschärfte die Kritik am Absolutismus und dem uneingeschränkten Wahrheitsanspruch der Kirche. Der mittelalterliche Herrschaftsanspruch der Könige, von Gott zum herrschen be- stimmt zu sein, fand seinen endgültigen Bruch in der Lehre vom Gesellschaftsvertrag des Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778). Gotthold Epharim Lessings 1779 erschienenes Buch „Nathan der Weise“ wurde zum Vordenker von Toleranz, religiöser Freiheit und des Huma- nismus. Kopernikus, Kepler, Newton und Galilei brachten mit ihren Entdeckungen das traditi- onelle Weltbild ins wanken. Den Höhepunkt der Aufklärung bildete die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 1787 und die französische Revolution von 1789.1 Von alledem wusste Montesquieu noch nicht viel, beziehungsweise hat es auch in seiner Lebenszeit nicht mehr erlebt. Zum Taufpaten Montesquieus ernennen seine Eltern einen Bett- ler, damit der in wohlhabende Verhältnisse Hineingeborene immer an die Armut erinnert wird. Im Alter von sieben Jahren wurde Montesquieu der Mutter beraubt, die bei der Geburt seiner Schwester Marie-Anne im Kindbett verstarb. Seine Erziehung begann auf dem elter- lichen Schloss und endete mit dem Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Bordeaux. Seine ersten praktischen Erfahrungen sammelte Montesquieu als Rechtsanwalt in Paris, doch es zog in zurück in den Süden. Bereits im Alter von 25 Jahren wurde Montesquieu Mitglied des Parlamentsrat seiner Heimatstadt. Aus diesem einfachen Jurastudenten, der seine öffentlichen Ämter gewissenhaft, aber ohne großen Elan ausübte, wurde im Verlauf seines Schaffens, der bedeutendste Entwickler der Gewaltenteilung und damit des Ordnungsprinzips, auf dem die modernen Staaten ihre Demokratie, insbesondere die Anfänge der amerikanischen Verfassung, begründen. Nachdem Montesquieu im Jahre 1715 Jeanne de Lartigue ehelichte, mit der er im Verlauf ihrer Ehe drei Kinder zeugte, wurde der Baron ein Jahr später bereits zum Präsidenten des Parlaments von Bordeaux ernannt. Diese Amt verkaufte er im Juli 1726, um sich zwei Jahre später auf eine lange und bewusstseinserweiternde Reise zu begeben. Auf seiner dreijährigen Reise von 1728-31 durch Europa, die den Baron unter anderem nach Österreich, Ungarn und England führten, kam Montesquieu in Kontakt mit den modernen Ideen der Aufklärer. In Preußen und Österreich bemerkte er den Reformwillen Friedrich des Großen beziehungsweise Franz Josef II. England spielte bei den Aufklärern wie schon kurz beschrieben eine Vorreiterrolle, so dass sich Montesquieu bei seinem Aufenthalt im Königreich von den humanistischen Idealen der Frei- maurer infizieren ließ, und am 16. Mai 1730 der Bewegung beitrat. Schon sein 1721 erschie- nener Briefroman „Persische Briefe“ setzt sich kritisch-sarkastisch mit dem Frankreich seiner Lebenszeit auseinander. In England kam Montesquieu mit den Ideen eines John Locke (1632 - 1704) verstärkt in Berührung. In den zwei Jahren, in denen sich Montesquieu auf der Insel aufhielt, widmete er sich dem Studium des englischen Staatswesens. Unter diesem Einfluss erschien am 29. November 1751 sein wichtigstes Werk „Vom Geist der Gesetzte“, in dem er seinen Gedanken zur politischen Ordnung eines Staates festhält. 20 Jahre hatte Montesquieu an diesem Buch gearbeitet, dessen großen Ruhm der Baron noch persönlich erlebte. Am 10. Februar 1755 stirbt Montesquieu vollkommen erblindet nach kurzer Krankheit in Paris. In den wirren der französischen Revolution werden seine Gebeine in die Katakomben Paris geworfen. Als der Ältestenrat der Revolution 1796 beschließt, die Gebeine in das Pan- théon - der bedeutendste Begräbnisstätte Frankreichs - zu bringen, sind diese nicht mehr auf- zufinden.2
3. Montesquieus Gedanke der Gewaltenteilung
Ernst Forsthoff weist in der Einführung seiner Übersetzung von Montesquieus Buch „Vom Geist der Gesetze“ darauf hin, dass sich der Ruhm des Buches in Bezug auf die Gewaltentei- lung erst nach den Errungenschaften der französischen Revolution einstellte und zum Kern- stück einer beginnenden Verfassungsepochen wurde.3 Grundlage der Überlegungen von Montesquieus Verfassungsgedanken ist sein Menschenbild, welches geprägte ist von der An- nahme, dass Menschen in verantwortungsvollen Positionen zu Machtmissbrauch neigen. Des- wegen, so Forsthoff muss: „die Staatsverfassung der Natur des Menschen entsprechen und sie muß so gestaltet sein, daß die gegen diese ewige Krankheit der Menschen wirksame Garan- tien enthält“.4 In der Tat macht Montesquieu den Menschen für die Entartung der Regierungs- formen verantwortlich. Nicht die Staatsform ist schlecht, sondern das, was der Mensch daraus macht. Anders als bei Hobbes ist der Mensch bei Montesquieu als Kreatur an sich ein fried- volles Wesen im Naturzustand.5 Doch im Zuge der Vergesellschaftung drängt es den einzel- nen nach Machtakkumulation. Bestätigung findet diese These durch das Stanford-Gefängnis- Experiment aus dem Jahre 1971. Der Sozialpsychologe Philip Zimbardo teilte einige Stu- denten in zwei Kategorien - Wärtern und Gefangene - ein und sperrte sie in den Universitäts- keller. Zimbardo wollte die Auswirkungen vom Macht von Menschen über Menschen unter- suchen. Bereits nach drei Tagen haben sich Verhältnisse wie in einem Terrorregime einge-stellt, in dessen oberste Instanz des Gefängnispriors sich der Testleiter ohne eigenes zutun selbst katapultierte hatte.6 Montesquieu bleibt also weiterhin aktuell.
Nach seinem Englandaufenthalt nannte Montesquieu nicht umsonst sein wichtiges Kapitel über seine Gedanken zur Organisation eines Staates „Von der Verfassung Englands“. Folge- richtig befürwortet der Franzose das Modell der konstitutionellen Monarchie. Die drei ent- scheidenden Kräfte seiner Staatsvision bezeichnet Montesquieu als: „die gesetzgebende Ge- walt, die vollziehende Gewalt in Ansehung der Angelegenheiten, die vom Völkerrechte ab- hängen, und die vollziehende Gewalt hinsichtlich der Angelegenheiten, die vom bürgerlichen Recht abhängen“.7 Jene Begriffe also, die heute unter den Schlagwörtern Legislative, Exeku- tive und Judikative allgemein bekannt sind. Damit ist eigentlich klar, was die wichtigsten Eckpunkte und ihre Funktion in Montesquieus Modell sind. Die mögliche totale Abhängigkeit eines gesamten Landes und seinen Volkes von der Willkür einer einzelnen Person soll unter- bunden werden. Durch die Aufteilung der Macht soll nach Montesquieu die Freiheit der Bürger erreicht werden, indem „die Regierungen so eingerichtet sein, daß ein Bürger den anderen nicht zu fürchten braucht“.8 Die Freiheit ist schon dann hinfällig, wenn zwei der Ge- walten durch eine gesellschaftliche Kraft (Monarch, Adel oder Volk) miteinander verzahnt sind. Montesquieu schaffte mit seinem Modell kein striktes System der absoluten Gewaltentrennung. Vielmehr versuchte er durch die Aufsplitterung von Befugnissen die Gewalten zur Zusammenarbeit aufzufordern, mit einem gewissen Grad von gegenseitigen Abhängigkeiten.
Einen guten Überblick zu Montesquieus Lehre bietet Alois Riklin, der Montesquieus freiheit- liches Staatsmodell als: “eine Synthese von Legalität, Grundrechten, Machtteilung und Mischverfassung“9 definiert. Dieses Staatsmodell beruht auf dem Repräsentationsprinzip, denn Montesquieu hatte erkannt, dass eine direkte Demokratie ála athischer Demokratie unter Perikles (um 500 - 429 v. Chr.) aufgrund der Vielzahl an Einwohnern nicht mehr zu reali- sieren ist. Außerdem sieht Montesquieu in der Beteiligung des Volkes an der Gesetzgebung eines der Übel die zum Untergang von antiken Reichen beigetragen haben.10 Demzufolge gibt es bei Montesquieu sieben Staatsorgane, wovon jede gesellschaftliche Kraft bestimmte Auf- gaben und Funktionen an einer der drei Gewalten inne hat. Die Ausnahme bildet der Mon-arch, der als unfehlbar gilt und deswegen der richterlichen Gewalt nicht untergeordnet ist, gleichzeitig aber auch keine judikativen Einfluss hat.
1. Das Wahlvolk - ein jeder feien Willens - wählt periodisch seine Repräsentanten.
2. Die Volkskammer ist das einzige Organ im legislativen Sektor, die kraft ihres Amtes Steuergesetze erlassen darf. Des weiteren ist sie für den Erlass von Gesetzten zuständig, kontrolliert die Armee und kann auf die Strafverfolgung einwirken. Im Bereich der Exekutive wirkt sie kontrollierend auf die Einhaltung der Gesetzte und Arbeit der Minister ein. Im Fall politischer Vergehen steht ihr die Anklage in der Sphäre der Judikative zu.
3. Der Adel verfügt über die zweite Kammer im Parlament. Diese hat mit Ausnahme der Steuergesetzgebung die gleichen Rechte wie ihr Pendant des Volkes im legislativen wie im exekutiven Ressort. Allerdings besitzt die Adelskammer einzig das Recht auf Rechtsprechung im Fall politischer Verbrechen.
4. Das Volksgericht spricht Recht über die Angehörigen seines Standes.
5. Aufgrund seiner privilegierten Herkunft verfügt das Adelsgericht über die Befugnis der mäßigenden Auslegung des Gesetztes, sowie der gesetzeskonformen Rechtsprechung.
6. Der Monarch steht an der Spitze der Exekutive, um schnell Entscheidungen fällen zu können, ja Montesquieu sieht es sogar als Aufhebung der Freiheit an, würden ein oder mehrere Personen die Exekutive unter sich aufteilen. Eine Sonderstellung erhält der unan- tastbare Monarch durch sein Recht der Einberufung und Absetzung der Parlamentszeit. Größte Einschränkung erhält seine Person in der Ausübung seiner Macht, dass auch der Monarch die Steuergesetze nur aufschieben, aber nicht aufheben kann. Als oberster Ver- teidiger des Landes ist der König für die Außen- und Sicherheitspolitik verantwortlich.
7. Die Minister haben nicht die eigentliche Qualität eines Staatsorgans, sie wirken beratend auf den Monarchen ein.11
Montesquieu erkannte richtig, dass durch die unterschiedliche Verteilung der Macht auf ver- schiedene Institutionen, das Volk noch nicht vor Missbrauch geschützt war. „Um den Miss- brauch der Macht zu verhindern, muss vermöge einer Ordnung der Dinge die Macht der Macht Schranken setzten.“12 Deswegen ersann der Denker vier Regeln für sein Machttei- lungskonzept, die hier nur zusammenfassend vorgelegt werden sollen. So darf eine Gewalt nicht ausschließlich einem Staatsorgan zugeordnet sein und umgekehrt darf auch nicht eine soziale Kraft in der absoluten Abhängigkeit einer Gewalt sein. Auch soll jedes politische Organ an den drei Gewalten beteiligt sein. Hier spiegeln sich die konstitutionellen Elemente des montesquieuschen Modells wieder, da der Monarch der Judikative nicht untergeordnet ist. Bei der Zusammenarbeit zwischen den Kräften gilt das Gleichheitsprinzip, egal aus wie vielen Personen und aus welchem Stand sich die Kraft sich zusammensetzt.13
4. Der Einfluss von Montesquieu auf die amerikanische Verfassung
Nur 32 Jahre nach dem Tod von Baron de Montesquieu stoßen dessen Ideen auf den ersten fruchtbaren Boden. Nach den Anstrengungen des Unabhängigkeitskrieges (1776 - 1881) ge- lang es den ehemaligen Kolonien in Amerika sich nur langsam auf einen Nenner zu einigen, um das riesige Territorium zu verwalten. Unter diesen Voraussetzungen, gekoppelt an die engen finanziellen Lage, ist die Leistungen derjenigen um so höher einzuschätzen, die zwi- schen dem 25. Mai und 17. September des Jahres 1787 am Verfassungskonvent in Phila- delphia unter Führung George Washingtons den Verfassungstext der Vereinigten Staaten aus- arbeiteten. Die einzige Basis der Anwesenden, über den im Endeffekt mit nur knapp 6 000 Worte formulierten Verfassungstext, war einzig die Übereinstimmung, eine Union mit zen- traler Regierungsgewalt zu schaffen. Bei genauerer Betrachtung des Kompromisses von Philadelphia wird klar, dass es sich hier um ein System der Gewaltenverschränkung und Ge- waltenteilung handelt, dessen Ziel die gegenseitigen Hemmungen in der Machtausübung der Staatsinstitutionen war. Gekoppelt an die starke Stellung des Präsidenten, zum Beispiel als oberster Militär, handelt es sich hierbei unter anderem um einen Versuch, der Anwendung der theoretischen Überlegungen von Montesquieu. Die einflussreiche Position des Präsidenten leitete der Verfassungskonvent aus der Überlegung ab, einen Weg frei für eine Exekutive zu machen: „die über einen einheitlichen Willen und über genügend Energie und Effektivität verfügen würde, um das Wohl der Nation zu verfolgen.“14 Der Präsident als erste Mann im Staat ist sowohl gleichzeitig Regierungschef als auch Staatsoberhaupt. Um dieser Omnipotenz Einhalt zu gebieten, überschneiden sich einige Befugnisse des Präsidentenamts mit dem des Kongresses. So ist der Präsident zwar der oberste Heerführer, die Entscheidung über Krieg und Frieden liegt aber beim Kongress. Ganz nach den Auffassungen von Montesquieu werden die beiden Kammern dieses Kongresses vom Volk gewählt. Die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses werden auf zwei Jahre und die mittlerweile auf 100 Abgeordneten an- gewachsene Zahl der Senatoren auf sechs Jahre berufen. In Zusammenarbeit können Legis-lative und Judikative den Präsidenten unter bestimmten Umständen des Amtes entheben.
Auch wenn hier ein wesentlicher Unterschied zu Montesquieu auszumachen ist - er interpre- tierte seinen Monarchen als unantastbar - obliegt doch dem Repräsentantenhaus, genau wie der Volkskammer die Anklageerhebung, beziehungsweise dem Senat die Beurteilung der Ver- gehen des Präsidenten. Mit einer zwei-drittel Mehrheit kann der Senat mit dem sogenannten „Impeachment-Verfahren" den Präsidenten aus dem Amt katapultieren. Die Luftblase des Prozesses der Gewaltenverschränkung wird dadurch aber nicht aus der Wasserwaage ge- bracht, den der Präsident verfügt über ein aufschiebendes Vetorecht gegenüber der Gesetz- gebung. Auch wenn dieses Modell in dieser groben Umrandung unübersichtlich anmutet, die Verfassungsväter hatten nicht die Lähmung der Staatsorgane im Ziel. Vielmehr versuchten sie durch diese Machtaufteilung eine Art Wettbewerb zwischen den Gewalten anzuzetteln, die alle Institutionen zu mehr Leistung anstacheln sollten. Die Geschichte der Verfassung gibt ihren Vätern recht. Im Verlauf der nun über 200-jährigen Verfassungsgeschichte haben es bis- her nur verschwindend wenig Verfassungsänderungen geschafft, sich auch zu ratifizieren. Ge- stützt auf jede Menge Patriotismus und die Errungenschaften der amerikanischen Revolution und eines zwölf Artikel umfassenden Grundrechtekatalogs, hat sich vor allem der Mittelstand für die Verfassung in den anfänglichen Krisenzeiten zwischen den Befürwortern und Födera- listen unter Hamilton und Madison und den Antiföderalisten, eingesetzt. Die Einbeziehung des Volkes in die Politik - wie es Montesquieu vorgesehen hatte - war Realität geworden.15
5. Der schwere Umgang der Menschen mit der Freiheit
Zugegeben: Die Latte des Sprungs den diese Arbeit jetzt versucht zu überwinden, liegt hoch. Dennoch soll der Sprung gewagt werden, ohne den Zusammenhang zwischen den beiden Themenkomplexen zu verlieren. Dieser Teil möchte versuchen einen Antwortansatz darauf zu finden, warum die Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich als so unfähig er- wiesen haben, von ihrer politischen Beteiligung, hier unter anderem am Beispiel der wach- senden Zahl an Wahlberechtigten erklärt, Gebrauch zu machten. Sprich: Wie hatten Men- schen wie Hitler nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges überhaupt die Chance auf Ohren zu treffen, die ihnen bereitwillige zuhörten, so dass deren Hassreden Eingang in die Köpfe der Menschen fanden. Wie gesagt, diese Arbeit versucht nur einen kleinen Ansatz zu finden und erhebt wahrlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür wäre allein die Frage: „Was bedeutet überhaupt Freiheit“ viel zu abstrakt, um von einer Validität zu sprechen. Der Freiheitsbegriff, auf den diese Arbeit Bezug nehmen wird, beschränkt sich deshalb auf den folgenden Wortlaut. „Menschen sind im liberalen Verständnis frei, soweit sie sich innerhalb möglichst weit gezogener Grenzen frei bewegen können, durch die die Freiheit andere Individuen geschützt werden.“16
Beginnen möchte ich mit einer kurzen Beschreibung der Hoffnungen die Anfang des 20. Jahr- hunderts vor allem das wohlsituierte Bürgertum Europas hegten. Stefan Zweig beschreibt im ersten Kapitel seiner beeindruckenden Autobiographie „Die Welt von Gestern“ die Situation so unheimlich treffend. „Niemand glaubte an Kriege, an Revolutionen und Umstürze. Alles Radikale, alles Gewaltsame schien bereits unmöglich in einem Zeitalter der Vernunft.“17 Doch Europa sollte sich nach den Schrecken des ersten Weltkrieges noch ein zweites mal bitter täuschen, sah man doch im Abschluss der Kampfhandlungen des ersten Weltkrieges den endgültigen Sieg der Freiheit an.18 Und in der Tat deutete vieles darauf hin, dass die europä- ischen Demokratien von Dauer sein könnten. Wissenschaft, Kunst und Literatur kamen trotz der Wirren der 20er Jahre zu hohem Ansehen und ungeahnten Entdeckungen.
Die steigenden Zahl der Wahlberechtigten - als Indiz für eine freiheitlich Demokratie - soll dabei die Grundannahme des folgenden Abschnitts sein. Dafür ist ein kleiner Blick in die Geschichte des Wahlrechtes von Nöten.
5.1. Das Wahlrecht als Indiz der freiheitlichen Demokratien
„Demokratisch Freiheit besteht in dem Recht jedes Staatsbürgers (gleich jeden Geschlechts), am Zustandekommen der Gesetzte und der Einsetzung und Kontrolle der Regierung durch geeignete Mittel zu partizipieren.“19
Schon auf dem Weg Athens zum Demokratieverständins von Perikles ist eine Tendenz zu er- kennen, die 2000 Jahre später ihre Renaissance feiern wird. Die unteren Volksschichten machten sich unentbehrlicher für das Funktionieren des athischen Staatswesen. Die Bauern kämpften in der Hoplitenphalanx und die Theten wurden als Ruderer auf den Kriegsschiffen eingesetzt. Aus dieser Funktion leiteten die Männer ihre Beteiligung am politischen Gesche- hen des Staates ab. Auf dem Höhepunkt der athischen Demokratie durften nicht nur wohlsitu- ierte Adlige an der Gesetzgebung teilnehmen, sondern alle männlich Bürger eines bestimmten Alters. Nach dem Ende des ersten Weltkrieges hatte sich bis 1920 das allgemeine Männer- wahlrecht in den westlichen Demokratien durchgesetzt und auch die Frauen durften ab 1918 in Deutschland an die Urnen. Presse-, Meinungs-, oder Versammlungsfreiheit sind wichtige Stufen auf dem Weg zur freiheitlichen Demokratie. Der wichtigste Schritt bleibt aber die Be- teiligung der größtmöglichen Zahl von Bürgern an der Gesetzgebung durch die Nominierung ihrer Repräsentanten per Wahl.20 Dieser Fakt war in der Weimarer Republik gegeben. Wieso verzichteten das Deutsche Volk also so freizügig auf dieses hart erkämpfte Privileg?
5.2. Die Furcht vor der Freiheit
Mit diesem Thema beschäftigte sich der Sozialphilosoph Erich Fromm in seinem gleichnami- gen 1941 erschienen Buch. Im Verlauf dieses Werkes versucht Fromm eine Antwort auf seinen in der Einleitung gestellte Frage: „Gibt es vielleicht außer dem angeborenem Wunsch nach Freiheit auch eine instinktive Sehnsucht nach Unterwerfung?“ zu finden.21 Fromm geht dabei in seiner Ursachenforschung tief in die Geschichte und findet erste Hinweise auf Schwierigkeiten im Umgang mit neuen Denkweisen bereits nach der Reformation am Ende des 17. Jahrhunderts. Revolutionen zielen auf die Beseitigung bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse in einem möglichst knappen Zeitraum. Dabei treten zwangsläufig auch immer neue Zwänge auf, die sich nach Fromm vor allem auf die Blockade der Persönlichkeit aus- wirken. Fromm argumentiert, es bestehe ein Missverhältnis in der Ausnutzung der Errungen- schaft durch die Kinder der Revolutionäre. Das heißt, dass die meistens mit Blut getränkten Erfolge einer Revolution, als Selbstverständlichkeiten angesehen werden und keine weiteren Kontrolle und Würdigung mehr erhalten. Deswegen zielt die Analyse Fromms auf einen Ver- such der Erklärung des Systems Adolf Hitlers. Eine endgültige Antwort auf die Frage, warum sich der Einzelne der Diktatur und damit der Unmündigkeit unterworfen hat, findet auch Fromm nicht. Aber es ist ihm gelungen, Tendenzen eines Erklärungsmusters aufzustellen.
Ein quasi-militärisches System, welches nur auf der Einhaltung der Kette von Befehl und Ge- horsam beruht, ist für ein Individuum, das erst einmal gefügig gemacht wurde, eine einfache Sache. Preußische Tugenden wie gehorchen, ausführen und nicht hinterfragen zählen, zumal sich der König selbst als erster Diener des Staates versteht.22 Aber nicht umsonst findet Sebas- tian Haffner in seiner sehr rational geführten Analyse über Adolf Hitler, keine befriedigende Antwort darauf, wie es Hitler nach 1933 gelingen konnte, ein ganzes Volk sich untertan zu machen, obwohl ihm bei der Wahl 1933 nicht einmal 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme gaben. Der Widerstand der gut organisierten Arbeiterbewegung war erloschen. Die Republik zu Grabe getragen und die intellektuelle Elite so gut wie ausschließlich emigriert.
So schizophren wie das auf den ersten Blick klingen mag. Haffner spricht nicht umsonst von einer Leistung Hitlers.23
Fromm begibt sich auf Ursachenforschung warum die Deutschen so freiwillig ihr Stimmrecht bei Wahlen zugunsten eines totalitären Systems aufgaben, und schlägt dabei zwei Wege ein. Als Sozialphilosoph versteht es sich von selbst, dass Fromm in der Psychologie auf Spurensuche geht, aber auch auf dem politischen, sozialen und ökonomischen Feld findet der Autor in fruchtbarer Erde viele Körner für die aufgehende Nazisaat.
Noch in der Einleitung beschreibt Fromm eine bemerkenswerte, da einfach Antwort auf das Gelingen des Phänomens Hitler. Für die Deutschen war es nicht vorstellbar, dass sich der Fa- schismus zu dieser Bestie entwickeln konnte.24 Auch in der Aufarbeitung des Faschismus bleibt es unbegreiflich, wie Menschen guten Gewissens sich zu solchen menschenverach- tenden Grausamkeiten hinreißen lassen konnten. Das im Voraus zu ahnen, war geradezu un- möglich, zumal sich auch Hitlers Buch „Mein Kampf“ keiner großen Lesebeliebtheit erfreute. Fromm gibt sich damit aber nicht zufrieden und wirft einen Blick zurück. Seiner Auffassung nach, taten sich die Menschen schon schwer, im Umgang mit den Errungenschaften der durch Martin Luther und Johannes Calvin ausgelösten Reformation. Die Philosophie der katholische Kirche, so Fromm, war es, sich als einziges Bindeglied zwischen den Menschen und Gott zu verkaufen. Die Reformatoren brachen mit diesem Bild und stellten den Menschen in den Mittelpunkt. Das beinhaltet, dass sich jeder einzelne Bittsteller persönlich an Gott wenden kann. Für Fromm sind hier die Ursprünge, des Rückzuges des Individuums zu sich selber zu finden. Auf der einen Seite wird der Mensch freier, da er seinen eigenen Weg zu Gott be- schreiten kann. Auf der anderen Seite zieht der Mensch sich in die Einsamkeit und Isolation zurück. Die Individuen stehen mehr und mehr auf eigenen Füßen, werden für sich selbst ver- antwortlich und müssen auf ihr eigenes Ich vertrauen und eigenen Entscheidungen treffen. Dieser langsame Prozess des Rückzugs aus dem gesellschaftlichen Leben ist für den Analytiker sehr wichtig, der sich im Verlauf der Industrialisierung und des Lassie-faire-Kapi- talismus noch weiter verschärft. Fromm bezeichnet das als das: „Prinzip der individuellen Initiative“, nachdem der Mensch für sein Handel und damit für seinen persönlichen Erfolg oder Misserfolg, verantwortlich ist. Wirtschaftlich gesehen ist das nach Fromm ein positives Faktum.25 Gesellschaftlich setzt der Mensch seinen Rückzug in die Isolation fort, die ihn sehr anfällig für starke Kräfte macht, die ihm als Werkzeug außerhalb seines eigenen Ichs miss-brauchen wollen. Fromm glaubt an den Menschen als Gruppentier, als gesellschaftliches Wesen, welches nicht immun ist gegen den Virus des Alleinsein. Deswegen kommt Fromm zu der Feststellung: „Er (das Individuum) muss versuchen der Freiheit ganz zu entfliehen, wenn es ihm nicht gelingt, von der negativen zur positiven zu gelangen.“26 Daraus ergeben sich nur zwei Fluchtwege. Erstens ein Hang zur Konformität der Menschen in den modernen Staaten, dem sich auch die Staaten nicht entziehen können, die zur Zeit der Erscheinung des Buches nicht vom Faschismus befallen waren. Diese Fluchtweg ist für diese Arbeit nicht weiter von Belang. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem zweischneidigen Rettungsweg Totali- tarismus. Nach Fromm neigen Menschen, die nicht an einen positive Freiheit glauben zu Autoritäten.27
Die Analyse findet eine Bestätigung, wenn man auf die Weimarer Republik schaut. In der Tat handelt es sich hier nicht gerade um eine Republik voller Republikaner. Versailles Vertrag, Inflation und Dolchstoßlegende haben nicht dazu beigetragen, die Monarchie vergessen zu machen und den Menschen ein Demokratieverständnis zu injizieren. Dazu die Rückschläge durch das Ableben der beiden Führungspersönlichkeiten Walther Rathenau (1922) und Gustav Stresemann (1919) und die Furcht vor einer neuen Wirtschaftsrezession nach dem Börsenkrach in New York im Oktober 1929, die sich ja dann auch mit mehreren Millionen Arbeitslosen in Deutschland niederschlug. Die noch in der Endphase der Weimarer Republik so schlagkräftige Arbeiterbewegung kam ab 1930 zusehends in Defensive, vergaß ihre Ideal und unterwarfen sich ab 1933 aus Resignation und Müdigkeit dem aufkommenden Terror.28 Fromm glaubt, dass in den Menschen ein Prozess eingesetzt hat, der die Menschen davon ab- hielt aktiven Widerstand zu leisten. Hitler wurde zum Synonym des Deutschen Reiches. Ein Angriff auf Hitler suggerierte gleichzeitig einen Angriff auf das Deutsche Reich.29
Erich Maria Remarque beschreibt in seinen Büchern „Der Weg zurück“ und „Drei Kame- raden“ einen Verfall der moralischen Tugenden, die kennzeichnend waren für das Deutsche Reich bis zum Ende des ersten Weltkrieges. Der Vater als unumstößliches Familienoberhaupt hatte seine Primärstellung eingebüßt. Vor allem das Kleinbürgertum tat sich mit dem Verlust dieser Werte schwer. Die Jugend setzte sich über Traditionen hinweg und in den Städten blühte das Nachtleben auf. Nach Fromm sehnt sich vor allem der Mensch aus dem Klein- bürgertum, nach dem Verlust seiner primären gesellschaftlichen Bindung, nach einer neuen Form einer Beziehung. Hitler als Teil diese Standes verstand es beispielhaft, den Hass dieser biederen Gesellschaftsschicht auf die Inflation, den Lassive-faire-Kapitalismus, die Republik, auf alles Schwache für sich auszunutzen. Wirtschaftlich gesehen setzte Hitler mit seinen Expansionsstreben exakt an dem Punkt an, an dem die Deutsche Rüstungsindustrie am Vorabend des Ersten Weltkrieges stand. Es entstand ein Teufelskreis gegenseitiger Abhängigkeiten. Die halb bankrotte Rüstungsindustrie war durch die Auflagen des Versailles Vertrages auf Staatsaufträge angewiesen. Mit dem Ausblick auf satte Gewinnen ließen sich die Thyssens und Krupps natürlich bereitwillig das Geld für Hitlers finanzaufwendigen Wahlkampf und paramilitärische Parteiorganisation aus der Tasche ziehen.
Hitler tröstete die Menschen über den Verlust der familiären Bindungen hinweg und stellte sich als neues Bindeglied vor. Diese sekundäre Bindung beruht auf einem Abhängigkeitsver- hältnis zwischen einem sadistisch angehauchten Herrn und seinem Untertan. Ein idealer Nährboden für Hitlers Propaganda, wie aus einer von ihm gehaltenen Rede vom 28. April 1939 zu erkennen ist. „Ich habe das Chaos in Deutschland überwunden, die Ordnung wieder- hergestellt ... Ich habe dies ... als ein noch vor 21 Jahren unbekannter Arbeiter und Soldat meines Volkes, aus meiner eigenen Kraft geschaffen...“30 Als ideales Mittel erwies sich da die Theorie Gusatv Le Bons über die Wirkung und Charakter einer Masse, so: „... daß der ein- zelne in der Masse schon durch die Tatsache der Menge ein Gefühl unüberwindlicher Macht erlangt, welches ihm gestattet, Trieben zu frönen, die er für sich allein notwendig gezügelt hätte.“31 Massenveranstaltungen sollen dem Einzelnen verdeutlichen, Teil einer Bewegung zu sein, welcher das gesamte Volk angehörte.
Auf diesen Vorüberlegungen beruht Fromms Theorie, warum es dem Nationalsozialismus ge- lang, den Menschen die Freiheit zu rauben. „Der Nazimus ist ein psychologisches Problem, aber man muss die psychologischen Faktoren aus den sozio-ökonomischen Faktoren heraus verstehen; der Nazimus ist ein ökonomisches und politisches Problem, aber daß er ein ganzes Volk erfasst hat, ist mit psychologischen Gründen zu erklären.“32 Oder anders gesagt. Die wirtschaftliche und sozialen Problem ermöglichten den Aufstieg des Nationalsozialismus. „Die psychologischen Bedingungen waren nur die menschliche Basis, ohne die er sich nicht hätte entwickeln können.“33
6. Schlußbetrachtung
Auch wenn diese Arbeit einen starken Bruch zwischen den beiden Themen Montesquieu und dem Problemkomplex Freiheit zieht, so denke ich, dass ein Zusammenhang erkennbar ist. Montesquieu versuchte durch sein Denken mit einem System zu brechen, welches der Willkür eines Alleinherrschers unterworfen war. Dass, solch einem Prozess nicht innerhalb weniger Jahre eine blühende Demokratie mit Partizipation breiter Bevölkerungsschichten folgen kann, ist klar. Revolutionen mussten sich immer gegen Attacken verteidigen. Der Französischen folgten die Schreckensherrschaften der Jacobiner und Napoleon und im Schatten der Russi- schen Revolution fing bereits Stalin an, seine Despotie aufzubauen. Deshalb zeigt nicht nur Weimar, dass es für Menschen schwer ist, mit Traditionen zu brechen. Ein neues politisches System anzuerkennen, welches quasi über Nacht über die Köpfe der Menschen hereinbricht, verlangt von den Mächtigen ein Toleranzdenken gegenüber den Regierten. Die Wiederver- einigung Deutschlands dient da als Exempel. Der Freude machte einer Depression über Arbeitslosigkeit und Politikverdrossenheit Platz. Aber nicht nur die Deutschen tun sich schwer mit ihrer Vergangenheit. In allen postsozialistischen Länder Osteuropas stößt die Demokratie auf Barrikaden. Für zu viele Leute spiegelt sich politische Freiheit nur in Form von wirtschaftlichem Wohlstand wieder. Demokratien brauchen Zeit. Sie sind keine Ersatz- lösung. Weimar, und damit somit auch der Rest der Welt, hat/haben das grauenhaft zu spüren bekommen. Die Demokratie der Weimarer Republik hatte mit ihren Monarchisten kaum eine echte Überlebenschance. Die politische Lager spaltete sich in Rechts und Links, so dass für eine liberale Mitte kein Raum blieb. Es gab einfach keinen Montesquieu, der der breiten Masse bekannt war. In Deutschland wurden Tradition aus dem Andenken an Friedrich dem Großen und Kaiser Wilhelm II gezogen. Selbst nach Ende des Zweiten Weltkrieges taten sich die Deutschen schwer, die Niederlage als Befreiung anzusehen und die Demokratie aufzubauen. Ich denke, Montesquieu hat richtig erkannt, als er seine Definition von Freiheit wie folgt beschrieb. „Freiheit ist das Recht, alles zu tun, was die Gesetzte erlauben.“34 Doch diese Definition wurde von der Zeit ein- und überholt. Deswegen stimme ich mit Fromm überein, wenn er behauptete: „dass wir nicht nur die traditionelle Freiheit zu bewahren und zu erweitern haben, sondern dass wir uns auch eine neue Art von Freiheit erringen müssen, die uns in die Lage versetzt, unsere individuelles Selbst zu verwirklichen und zu diesem Selbst und zum Leben Vertrauen zu haben.“35
Literaturverzeichnis
1. Fatouros, Georgios: Montesquieu, in: Biographisch - Bibliographisches Kirchenlexi- kon, 15. Bd., Herzberg 1998.
2. Forsthoff, Ernst (Hrsg.): Vom Geist der Gesetzte. Leipzig 1951.
3. Fromm, Erich: Die Furcht vor der Freiheit, 8. Aufl., München 2000.
4. Grolle, Johann u.a. 2001: Im Rausch der Macht, in: Der Spiegel 11, 96 - 106.
5. Grunenberg, Antonia: Der Schlaf der Freiheit, Politik und Gemeinsinn im 21 Jahrhun- dert. Reinbek 1997.
6. Haffner, Sebastian: Anmerkungen zu Hitler, 20. Aufl., Frankfurt am Main 1999.
7. Heidekind Jürgen: Geschichte der USA, 2. Aufl., Tübingen und Basel 1999.
8. Münkler, Herfreid (Hrsg.): Lust an der Erkenntnis: Politisches Denken im 20. Jahrhun-dert. München 1990.
9. Meyers Lexikonredaktion (Hrsg.): Meyers Taschenlexikon, 2. Bd., 7. Aufl., Mann- heim 1999.
10. Nohlen, Dieter (Hrsg.): Wörterbuch Staat und Politik, 5. Aufl., München 1998.
11. Oberndörfer, Dieter; Rosenzweig, Beate (Hrsg.): Klassische Staatsphilosophie: Texte und Einführung von Platon bis Rousseau, München 2000.
12. Rilklin, Alois 1989: Montesquieus freiheitliches Staatsmodell. Die Identität von Machtteilung und Mischverfassung, in: Politische Vierteljahresschrift 3, 420 - 442.
13. Zweig, Stefan: Die Welt von Gestern, 31. Aufl., Frankfurt am Main 1999.
[...]
1 Meyers Lexikonredaktion: Meyers großes Taschenlexikon, 2 Bd., 7. Aufl., Mannheim u.a. 2000 3
2 Georgios, Fatouros: Montesquieu, in: Biographisch - Bibliographisches Kirchenlexikon, 15 Bd., Herzberg 1998
3 Ernst, Forsthoff (Hrsg.): Vom Geist der Gesetzte, Leipzig 1951, S. 27
4 Vgl. ebenda
5 Dieter, Oberndörfer, Beate Rosenzweig (Hrsg.): Klassische Staatsphilosophie: Texte und Einführung von Platon bis Rousseau, München 2000, S. 205 - 238
6 Johann Grolle, Im Rausch der Macht, in: Der Spiegel, 2001, Nr. 11, S. 96 - 106
7 Vgl. Ernst, Forsthoff (Hrsg.): Vom Geist der Gesetzte, Leipzig 1951, S. 214
8 Ebenda, S. 215
9 Vgl. Alois, Riklin, Montesquieus freiheitliches Staatsmodell. Die Identität von Machtteilung und Mischverfassung, in: PVS, 30. Jg. (1989), S. 420
10 Ernst, Forsthoff (Hrsg.): Vom Geist der Gesetzte, Leipzig 1951, S. 219
11 Alois, Riklin, Montesquieus freiheitliches Staatsmodell. Die Identität von Machtteilung und Mischverfassung, in: PVS, 30. Jg. (1989), S. 426 - 428
12 Ernst, Forsthoff (Hrsg.): Vom Geist der Gesetzte, Leipzig 1951, S. 213
13 Alois, Riklin, Montesquieus freiheitliches Staatsmodell. Die Identität von Machtteilung und Mischverfassung, in: PVS, 30. Jg. (1989), S. 429
14 Vgl. Jürgen, Heideking: Geschichte der USA, 2. Aufl., Tübingen und Basel 1999, S. 69
15 Jürgen, Heidekind: Geschichte der USA, Tübingen und Basel 1999, S. 65 - 77
16 Vgl. Dieter, Nohlen (Hrsg.): Wörterbuch Staat und Politik, 5.Aufl., München 1998, S. 171
17 Stefan, Zweig: Die Welt von Gestern, 31. Aufl., Frankfurt am Main 1999, S.16
18 Erich, Fromm: Die Furcht vor der Freiheit, München 2000, S.9
19 Vgl. Dieter, Nohlen (Hrsg.): Wörterbuch Staat und Politik, München 1999, S. 171
20 Dieter, Nohlen (Hrsg.): Wörterbuch Staat und Politik, München 1998, S. 845- 851
21 Vgl. Erich, Fromm: Die Furcht vor der Freiheit, München 2000, S. 11
22 Antonia, Grunenberg: Der Schlaf der Freiheit, Reinbeck 1997, S. 127 - 128
23 Sebastian, Haffner: Anmerkungen zu Hitler, 20. Aufl., Frankfurt am Main 1999, S. 31- 56
24 Erich, Fromm: Die Furcht vor der Freiheit, München 2000, S. 12
25 Erich, Fromm: Die Furcht vor der Freiheit, München 2000, S. 92
26 Vgl. ebenda, S. 101
27 Vgl. ebenda, S. 107 - 133
28 Antonia, Grunenberg: Der Schlaf der Freiheit, München 2000, S.119 - 184
29 Erich, Fromm: Die Furcht vor der Freiheit, München 2000, S. 154
30 Vgl. Sebastian, Haffner: Anmerkungen zu Hitler, Frankfurt am Main, 1999, S. 40 - 41
31 Vgl. Herfried, Münkler (Hrsg.): Lust an der Erkenntnis. Politisches Denken im 20. Jahrhundert, München Zürich 1987, S. 95
32 Vgl. Erich, Fromm: Die Furcht vor der Freiheit, München 2000, S. 152
33 Vgl. ebenda S. 159
34 Vgl. Ernst, Forsthoff (Hrsg.): Vom Geist der Gesetzte, Leipzig 1951, S. 213
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Montesquieu?
Die Arbeit befasst sich mit dem Leben und Werk des französischen Schriftstellers und Staatsphilosophen Charles de Montesquieu. Sie behandelt seine Biographie, seine Gedanken zur Gewaltenteilung und seinen Einfluss auf die amerikanische Verfassung sowie die Schwierigkeiten der Menschen im Umgang mit der Freiheit.
Was sind die Hauptpunkte von Montesquieus Gedanken zur Gewaltenteilung?
Montesquieu befürwortete eine konstitutionelle Monarchie mit drei entscheidenden Kräften: die gesetzgebende Gewalt (Legislative), die vollziehende Gewalt (Exekutive) und die richterliche Gewalt (Judikative). Er argumentierte, dass die Aufteilung der Macht die Freiheit der Bürger schützt, indem sie verhindert, dass eine einzelne Person oder Gruppe zu viel Macht akkumuliert.
Welchen Einfluss hatte Montesquieu auf die amerikanische Verfassung?
Montesquieus Ideen zur Gewaltenteilung beeinflussten die Väter der amerikanischen Verfassung bei der Gestaltung eines Systems der Gewaltenverschränkung und Gewaltenteilung, um die Machtausübung der Staatsinstitutionen gegenseitig zu hemmen. Dies zeigt sich in der starken Stellung des Präsidenten, der jedoch durch den Kongress kontrolliert wird.
Was ist das Stanford-Gefängnis-Experiment und wie passt es zu Montesquieus Theorie?
Das Stanford-Gefängnis-Experiment, bei dem Studenten in Wärter und Gefangene eingeteilt wurden, demonstrierte die Tendenz von Menschen in Machtpositionen zum Machtmissbrauch. Dies bestätigt Montesquieus Annahme, dass eine Staatsverfassung Garantien gegen diese menschliche Neigung enthalten muss.
Warum hatten die Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts Schwierigkeiten mit der Freiheit?
Die Arbeit untersucht, warum die Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, trotz wachsender Wahlbeteiligung, unfähig waren, ihre politische Beteiligung zu nutzen. Sie argumentiert, dass Faktoren wie der Verlust traditioneller Werte, wirtschaftliche Probleme und die Furcht vor der Freiheit zum Aufstieg totalitärer Regime beitrugen.
Was ist Erich Fromms Theorie zur "Furcht vor der Freiheit"?
Erich Fromm argumentiert, dass Menschen, denen es nicht gelingt, eine positive Freiheit zu erlangen, zu Autoritäten neigen. Sie suchen nach einem System, das ihnen Sicherheit und Ordnung bietet, auch wenn dies ihre Freiheit einschränkt. Dies erklärt, warum viele Menschen in der Weimarer Republik ihr Stimmrecht zugunsten eines totalitären Systems aufgaben.
Welche Rolle spielte Hitler bei der Aufgabe der Freiheit?
Die Analyse deutet darauf hin, dass Hitler, durch seine Propaganda und die Ausnutzung von Ängsten und Unsicherheiten, das neue Bindeglied für die Menschen war. Dies führte dazu, dass die Menschen aktiv der Politik und dem Widerstand absagten, was sich in der Aufgabe der Freiheit äußerte.
Was ist die Schlussfolgerung der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Montesquieus Gedanken zur Gewaltenteilung wichtig sind, aber dass es für Menschen schwer ist, mit Traditionen zu brechen und ein neues politisches System anzuerkennen. Demokratien brauchen Zeit und Toleranz. Freiheit erfordert nicht nur das Recht, alles zu tun, was die Gesetze erlauben, sondern auch die Fähigkeit, das eigene Selbst zu verwirklichen und Vertrauen zum Leben zu haben.
Was ist die Definition des Freiheitsbegriff, auf den diese Arbeit Bezug nimmt?
Menschen sind im liberalen Verständnis frei, soweit sie sich innerhalb möglichst weit gezogener Grenzen frei bewegen können, durch die die Freiheit andere Individuen geschützt werden.
- Quote paper
- Sibrand Siegert (Author), 2000, Montesquieu und das Erbe der Freiheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104256