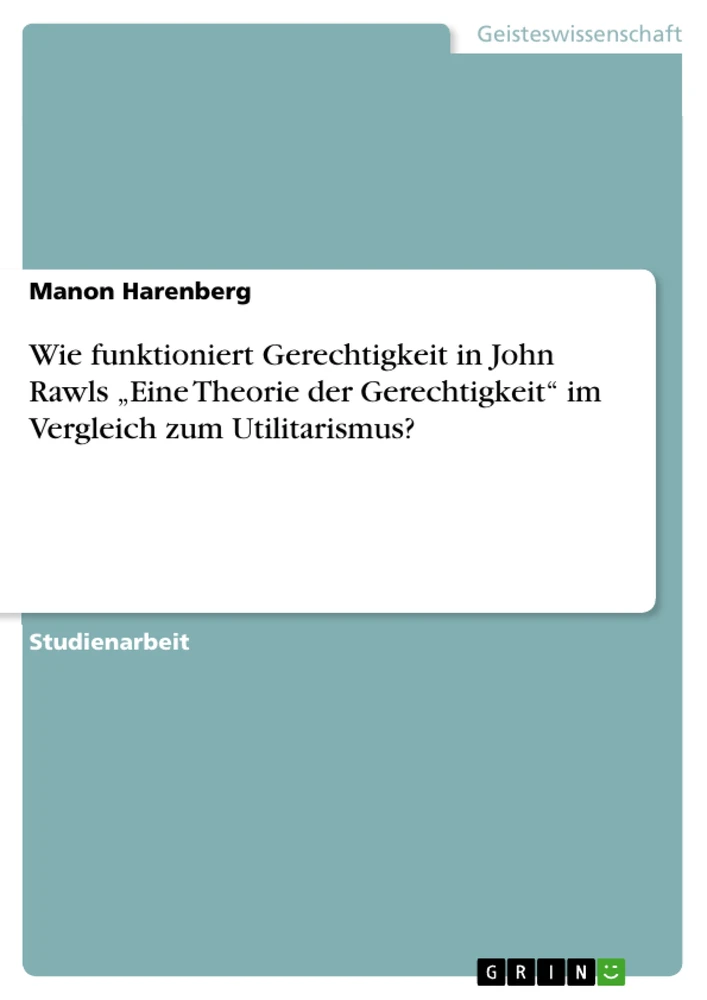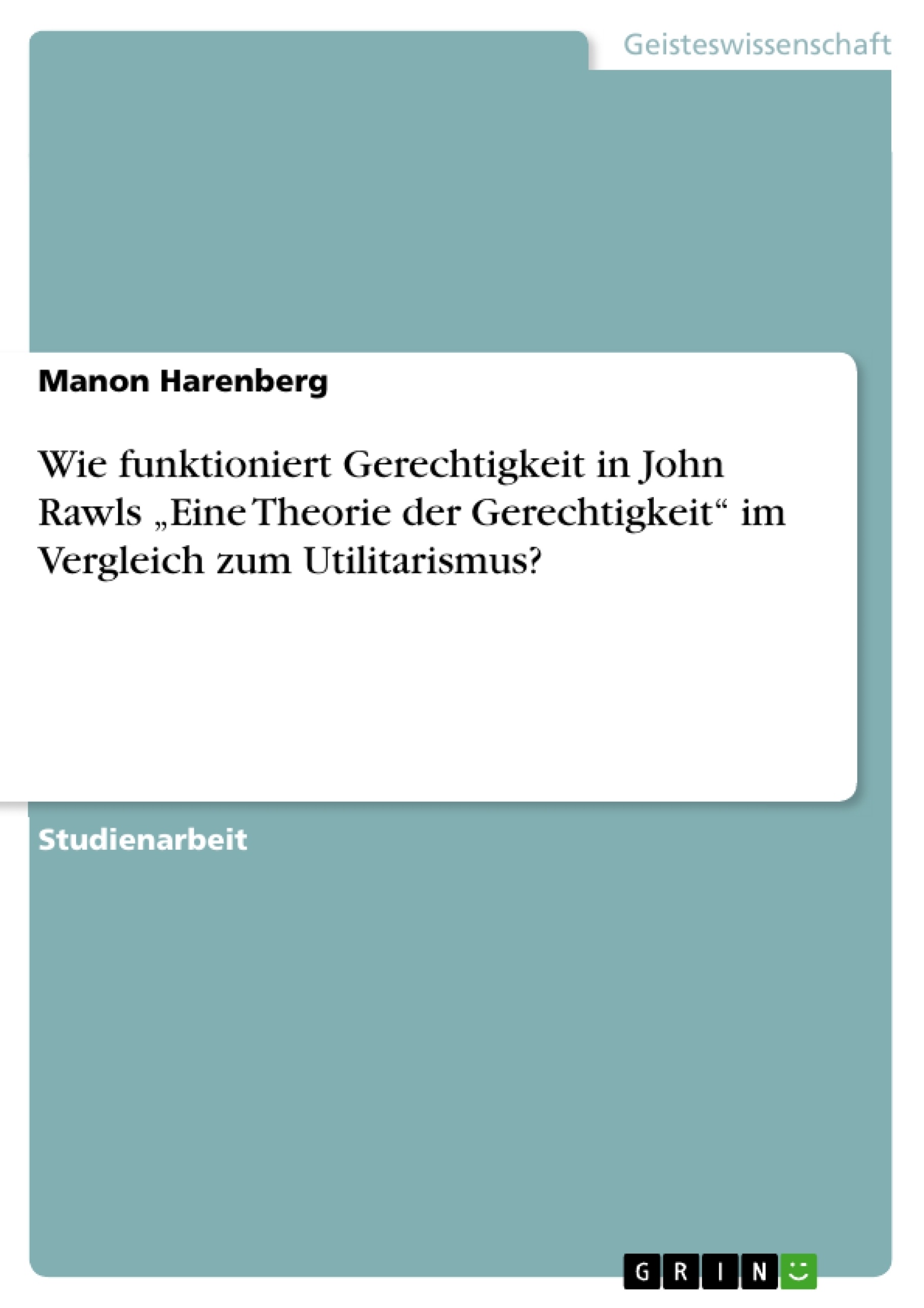Die Arbeit behandelt die Frage, wie eine gerechte Gesellschaft in „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ definiert wird. Für einen kritischen Ansatz wird vergleichend die Auffassung des Gerechtigkeitsbegriffs des Utilitarismus hinzugezogen, sowie die damit verbundenen Ansichten und Herangehensweisen. Rawls definiert seine Gerechtigkeitstheorie offenkundig als eine „utilitarismuskritische, dem Utilitarismus überlegene ethische Konzeption“.
Als primäre Grundlage für die Herausarbeitung dient John Rawls „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ (2019). Zunächst gibt die Arbeit einen Überblick über die „Theorie der Gerechtigkeit“ und den „Utilitarismus“, um ein einheitliches Verständnis zu gewährleisten. Die anschließende vergleichende Rekonstruktion umfasst die jeweiligen Ausprägungen des Urzustandes: Rawls Schleier des Nichtwissens und den unparteiischen Beobachter des Utilitarismus. Aufbauend auf Rawls Auffassung des Urzustandes thematisiert das nachfolgende Kapitel die Gerechtigkeitsprinzipien, auf die sich die Vertragspartner hinter dem Schleier des Nichtwissens einigen würden.
Der anschließende Theorieteil behandelt vergleichend die deontologische Ethik Rawls und die teleologische Ethik des Utilitarismus. Kernfrage ist dabei, ob die beiden Ethiken sich zwingend widersprechen oder sie sich womöglich gegenseitig ergänzen können. Die darauffolgende Betrachtung der jeweiligen Auffassungen einer gerechten Verteilung schließt mit der Frage ab, ob Rawls Maximin-Regel ebenso utilitaristische Züge aufzeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die „Theorie der Gerechtigkeit“ von John Rawls
- Der klassische Utilitarismus
- Der Urzustand
- Rawls: Der Schleier des Nichtwissens
- Utilitarismus: Der unparteiische Beobachter
- Die zwei Grundsätze der Gerechtigkeit nach Rawls
- Das erste Gerechtigkeitsprinzip
- Das zweite Gerechtigkeitsprinzip
- Theorieteil: Deontologische gegen teleologische Ethik
- Die gerechte Verteilung
- Rawls: Gerechte Verteilung von Grundgütern
- Utilitarismus: das Nutzensummenprinzip
- Trägt die Maximin-Regel Rawls' utilitaristische Züge?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie eine gerechte Gesellschaft in John Rawls' "Eine Theorie der Gerechtigkeit" definiert wird. Im Mittelpunkt steht dabei ein Vergleich der Gerechtigkeitskonzeption von Rawls mit der des klassischen Utilitarismus. Besonderes Augenmerk liegt auf den Urzustands-Konzepten beider Ansätze, den jeweiligen Gerechtigkeitsprinzipien sowie der deontologischen und teleologischen Ethik. Die Arbeit untersucht außerdem, wie beide Theorien eine gerechte Verteilung von Grundgütern in der Gesellschaft konzipieren.
- Rawls' "Theorie der Gerechtigkeit" als Gegenentwurf zum klassischen Utilitarismus
- Definition und Vergleich der Urzustands-Konzepte von Rawls und dem Utilitarismus
- Analyse der Gerechtigkeitsprinzipien nach Rawls und ihre Unterscheidung zur utilitaristischen Sichtweise
- Gegenüberstellung von deontologischer und teleologischer Ethik
- Untersuchung der unterschiedlichen Ansätze zur gerechten Verteilung von Grundgütern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die "Theorie der Gerechtigkeit" von John Rawls und den klassischen Utilitarismus, um ein gemeinsames Verständnis zu gewährleisten. Das zweite Kapitel stellt die "Theorie der Gerechtigkeit" vor, mit einem Schwerpunkt auf Rawls' Konzeption einer "vollkommen gerechten Gesellschaft" und den Gerechtigkeitsbegriff als Verteilungsgerechtigkeit. Das dritte Kapitel widmet sich dem klassischen Utilitarismus, erläutert das Prinzip der Nutzenmaximierung und die Definition von "Nutzen" als Glück und Wohlgefühl. Kapitel 4 erörtert das Konzept des Urzustands und den "Schleier des Nichtwissens" bei Rawls sowie den unparteiischen Beobachter beim Utilitarismus. Der Fokus von Kapitel 5 liegt auf den beiden Gerechtigkeitsprinzipien, die Rawls als Grundlage einer gerechten Gesellschaft sieht. Der Theorieteil in Kapitel 6 vergleicht die deontologische Ethik von Rawls mit der teleologischen Ethik des Utilitarismus. Kapitel 7 behandelt die unterschiedlichen Ansätze zur gerechten Verteilung von Grundgütern und analysiert, ob die Maximin-Regel von Rawls utilitaristische Züge aufweist.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind Gerechtigkeitstheorie, John Rawls, Utilitarismus, Urzustand, Schleier des Nichtwissens, unparteiischer Beobachter, Gerechtigkeitsprinzipien, deontologische Ethik, teleologische Ethik, gerechte Verteilung, Maximin-Regel, Grundgüter.
- Quote paper
- Manon Harenberg (Author), 2020, Wie funktioniert Gerechtigkeit in John Rawls „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ im Vergleich zum Utilitarismus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1040531