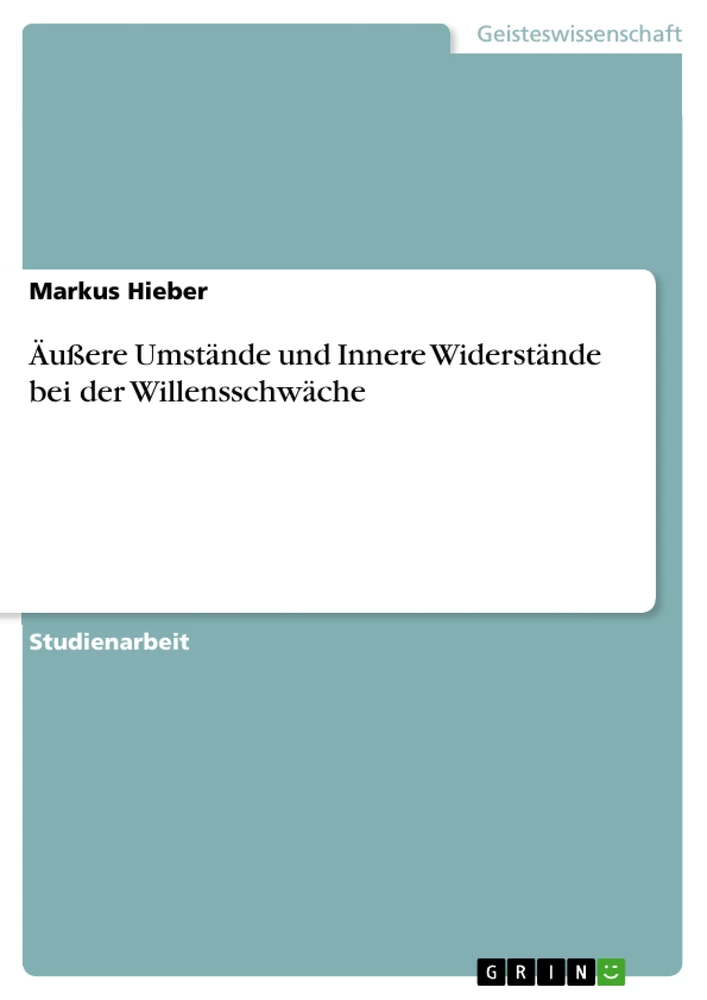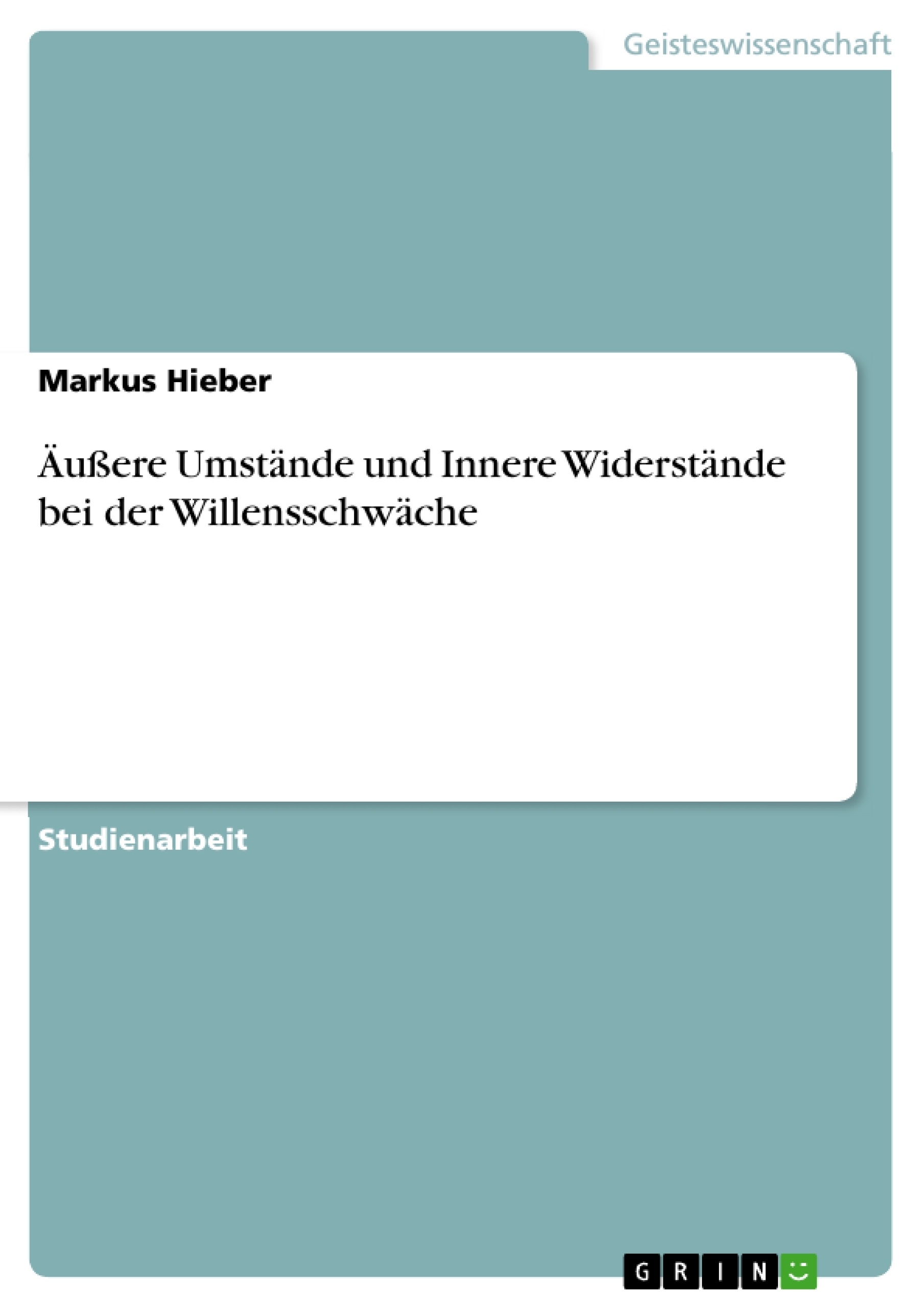Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie manchmal Dinge tun, von denen Sie genau wissen, dass sie schlecht für Sie sind? Oder warum Ihre guten Vorsätze so oft im Sande verlaufen? Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine philosophische Reise in die verwirrende Welt der Willensschwäche. Es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit einem Phänomen, das uns alle betrifft. Anstatt sich mit oberflächlichen Erklärungen zufriedenzugeben, analysiert der Autor die komplexen Mechanismen unseres Willens und deckt die subtilen Fallen auf, die uns immer wieder in die Irre führen. Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage, ob Willensschwäche tatsächlich existiert oder ob es sich lediglich um eine Frage der Definition handelt. Dabei werden die Positionen von Philosophen wie Platon, Aristoteles und zeitgenössischen Denkern kritisch beleuchtet. Der Autor argumentiert überzeugend gegen die Vorstellung, dass Willensschwäche ein rein sprachliches Problem sei und plädiert stattdessen für eine differenzierte Betrachtung der inneren und äußeren Faktoren, die unser Handeln beeinflussen. Er zeigt, wie diese Faktoren untrennbar miteinander verwoben sind und wie der Determinismus unsere Vorstellung von freiem Willen in Frage stellt. Dieses Buch bietet keine einfachen Antworten, sondern regt zum Nachdenken über die grundlegenden Fragen der menschlichen Existenz an. Es ist eine Einladung, sich den eigenen Schwächen zu stellen und ein tieferes Verständnis für die Kräfte zu entwickeln, die uns lenken. Eine faszinierende Lektüre für alle, die sich für Philosophie, Psychologie und die Rätsel des menschlichen Verhaltens interessieren. Tauchen Sie ein in die Debatte um Willensfreiheit, Motivation und Selbstbeherrschung. Entdecken Sie die Ursachen für das Scheitern unserer Vorsätze und lernen Sie, wie Sie Ihre Ziele effektiver erreichen können. Lassen Sie sich von den Erkenntnissen dieses Buches inspirieren und finden Sie Ihren eigenen Weg zu einem erfüllteren Leben. Dieses Werk ist ein Muss für jeden, der die menschliche Natur wirklich verstehen will, und bietet wertvolle Einsichten für ein besseres Selbstmanagement und ein tieferes Verständnis der menschlichen Psyche, insbesondere im Kontext von Handlungsplanung, Motivationstheorie und den Grenzen der Selbstkontrolle. Es wirft ein neues Licht auf die oft unterschätzte Komplexität unserer Entscheidungen und Handlungen und bietet Denkanstöße für ein reflektiertes Leben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Definition des Willens
3. Das Problem der Willensschwäche
4. Die Ceteris-Paribus-Klausel
5. Das Problem bei der isolierten Betrachtung von inneren Wider- ständen und äußeren Umständen
6. Die Trennung von inneren und äußeren Bedingungen als ein Trick
7. Ist das Problem der Willensschwäche ein sprachliches Problem?
8. Die Alternative: Willensschwäche als ein Fall von bloßem Wollen
9. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Zu dieser Hausarbeit wurde ich durch die Lektüre der Aufsätze "Ist der Me- chanismus vorstellbar?" von Norman Malcolm und "Zum Problem der Wil- lensschwäche" von Ursula Wolf angeregt. Malcolm und Wolf behaupten, dass das Wort "Wille" so definiert sei, dass der Wille notwendig zu einer dement- sprechenden Handlung führt. Wolf führt weiter aus, dass jemand, der nicht das tut, was er vermeintlich will, sich nur eingebildet hat, dieses zu wollen. Er hat sich in sich selbst getäuscht.
Diese Definition des Willens enthält einen Zusatz, der mich irritiert hat, denn nach dieser Definition führt der Wille zu einer Handlung, wenn die Person, die diesen Willen hat, an der Ausübung der diesem Willen gemäßen Handlung nicht durch äußere Umstände gehindert wird.
Nun scheint es Fälle zu geben, in denen eine Person sich entschuldigt und ver- sichert, dass sie eine bestimmte Handlung durchführen wollte, aber durch die äußeren Umständen gehindert wurde. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Wenn Person X gegenüber Person Y versichert, sie habe zur Post gehen wo l- len, um das Paket von Y an einen Dritten dort aufzugeben, habe es aber nicht mehr rechtzeitig geschafft, die Post während der Öffnungszeiten zu erreichen, weil der Bus, mit dem er zur Post fuhr, durch eine Demonstration aufgehalten wurde, dann ist das nur auf den ersten Blick eine wirkliche Entschuldigung. Hätte X nicht zur Hauptpost mit längeren Öffnungszeiten fahren können, die nur 4 Busstationen von der Post, vor deren verschlossenen Pforten er gestanden hat, entfernt ist? Manchmal könnte man meinen, daß sich auf den ersten Blick tadellose Entschuld igungen später als faule Ausreden entlarven. Oder man könnte die Sache wenden und einräumen, daß sich dieser Fall nicht von jenen Fällen unterscheidet, in denen man den Handelnden jegliche Verantwortung abspricht, weil sie durch äußere Umstände zu dieser Handlung genötigt wur- den. Denn konnte X wirklich anders handeln? Vielleicht wußte X nichts von der Hauptpost mit den längeren Öffnungszeiten. Möglicherweise hat X aber auch so einen Charakter, dass ihn selbst das Wissen über eine Post mit längeren Öffnungszeiten nicht dazu bewogen hätte, zu dieser Post zu fahren. Diese Cha- raktereigenschaft läßt sich auf die Umstände seiner Lebensgeschichte zurück- führen.
Dieses Beispiel führt mich zur folgenden Fragestellung: Kann man äußere Hindernisse einer Handlung von inneren Prozessen isoliert betrachten? Kann man also bestimmen, wieviel Überwindung von äußeren Hindernissen einer Person zumutbar sind, bevor man wirklich von äußeren Umständen als einem ernsthaften Hindernis sprechen kann?
2. Die Definition des Willens
Ich möchte zunächst einmal klären, was ganz allgemein unter einem Willen zu verstehen ist und dann näher auf die Definition des Willens von Wolf und Mal- colm eingehen.
Das Wort Wille wird meist in ähnlicher Weise benutzt wie die Wörter "Intenti- on" oder "Absicht". Der Wille ist zum großen Teil ein mentaler Akt, das heißt, dass der Wille ein Vorgang ist, der sich vornehmlich im Geiste abspielt.
Der Wille ist intentional, das heißt, er ist auf einen Gegenstand bezogen, wobei hier Gegenstand eine bestimmte Handlung oder einen Zustand meint. Der Wil- le wird also als auf etwas ausgerichtet erlebt. Der Wille hat einen propositiona- len Gehalt, dass heißt, der Inhalt des Willens läßt sich in einem Satz fo rmulie- ren.
Der Wille hat eine phänomenale Qualität, das heißt, er wird in einer bestimm- ten Weise emotional erlebt. Diese besondere Qualität kann nur introspektiv erfaßt werden. Sie wird von Person zu Person und von Wille zu Wille variie- ren, aber wesentlich sind den Wollungen1solche Gefühlsanteile wie Zuve r- sichtlichkeit, Aufbruchstimmung, Bestimmtheit, Gefühl von wachsender Kraft, vielleicht auch Anteile von dem Gefühl, gezwungen zu sein. Dabei ist es egal, ob man von außen gezwungen wird oder einfach nur meint, dass etwas getan werden muß.
Wahrscheinlich hat der Wille auch eine irgendwie geartete Verbindung zu physischen Prozessen, zum Beispiel eine Korrelation oder Identität mit sogenannten "Aktionspotentialen". Hier soll nicht weiter darauf eingegangen werden, weil ich sonst zur detaillierteren Erklärung das Gebiet der Philosophie verlassen müßte. Solche Phänomene wie die Entladung von Aktionspotentialen lassen sich nur empirisch nachweisen.
Was man aber mit der philosophischen Methode der Introspektion in jedem Fall feststellen kann, ist, dass der Wille, der einer Handlung vorausgeht, sich meist an der Schnittstelle zwischen Geist und Körper befindet. Die im Geiste durchgeführte Handlungsplanung mit der Erwägung verschiedener Alternati- ven und ihrer Vorzüge und Nachteile mündet in den Willen, der alsbald die Handlung, also einen absichtlichen körperlichen Akt, fo lgen läßt. In ma nchen Fällen kann der Wille allerdings auch zu einer nicht-körperlichen Handlung führen, zum Beispiel wenn sich jemand vornimmt, Vokabeln zu le rnen.
Nun heißt es bei Malcolm und Wolf definitiv, dass der Wille einer dementsprechenden Handlung vorausgeht, wenn nicht äußere Umstände die Person von der Handlung abhalten.
Malcolm übernimmt die Willensdefinition von Charles Taylor:
(...) denn dies ist ein Teil dessen, was wir mit `X intendieren´ meinen, dass es in Abwesenheit störender Einflüsse - vom X tun gefolgt wird. Man kann nicht sagen, daß ich X intendiere, wenn ich, obwohl keine Hindernisse o- der störende Einflüsse vorliegen, X dennoch nicht tue. (zit. in Malcolm 336)
Wenn also jemand behauptet, etwas zu wollen, es aber nicht tut, dann hat er es nach dieser Auffassung nicht wirklich gewollt. Solcherart vermeintliche Wol- lungen, die nicht zu einer Handlung führen, könnte man als Wünsche bezeic h- nen.
Der Wille ist also notwendig die Ursache für eine Handlung. Ist der Wille selbst verursacht oder entspringt er originär ohne kausalen Vorläufer in der Psyche des Handelnden? Da die Naturgesetze die Vo rgänge in der Natur bestimmen, der Mensch und seine Psyche auch ein Bestandteil der Natur sind, so ist auch der Wille determiniert. Der Wille ist ein Glied in einer Kausalkette. Auf diesen Punkt werde ich weiter unten eingehen.
3. Das Problem der Willens schwäche
Als Willensschwäche wird bezeichnet, wenn jemand X tut, obwohl er die Alternative Y für die Beste hält. Manchmal wird die Willensschwäche auch als Unbeherrschtheit bezeichnet.
Die Diskussion der Willensschwäche befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen der Idee eines inneren Kampfes, in dem die bessere Einsicht unter- liegt und der These, dass es nicht wirklich so etwas wie Willensschwäche gibt. Matthäus vertritt in seinem Evangelium die erste Position, Platon vertritt die zweite Ansicht.
Laut dem Evangelium nach Matthäus ist die Willensstärke mit geistiger An- strengung verbunden. Jesus ermahnte in Getsemani seine Jünger, nach dem sie, anstatt mit ihm zu beten, geschlafen hatten: "Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach!" (Matthäus 26,41)
Die Jünger scheinen in einen inneren Kampf verstrickt zu sein. Einerseits haben sie den Willen, wach zu bleiben und mit Jesus zu beten; andererseits scheint diese Handlung durch das körperliche Bedürfnis nach Schlaf gefährdet zu sein. Am Ende siegt der Körper.
Wenn ein Satz zu einer Redewendung wird und oft, auch scherzhaft und/oder in Variationen, verwendet wird, ist das ein Indiz für eine hohe Akzeptanz des durch diesen Satz ausgedrückten Gedankens bei den Menschen. Die Formulierung "Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach" wird oft benutzt. Sie entspricht unserer alltäglichen, präreflexiven Einstellung. Das belegt natürlich nicht die Wahrheit dieses Satzes.
Für Sokrates bzw. Platon war es unvorstellbar, dass es so etwas wie Unbe- herrschtheit gibt. Unser Handlungsweise hängt nach seiner Meinung von unse- rem Wissen ab. Der Handelnde berücksichtigt bei der Handlungsplanung nicht nur die spontane Lust oder Unlust, sondern die langfristigen Folgen einer Handlung hinsichtlich Lust und Unlust. Wenn zwar Sport im Moment Unlust hervorruft, so wird es langfristig zu Lust führen, weil man durch Sport einen gesunden Körper erhält. Wenn man aber spontan Lust empfindet, zum Beispiel beim Verzehr bestimmter Speisen, kann das trotzdem in der Folge zu Unlust führen, weil sie dem Körper nicht zuträglich sind. Der Handelnde legt Lust und Unlust, die eine Handlung hervorrufen, in eine Waagschale, und wenn die Lust, die eine optionale Handlung hervorruft, überwiegt, dann entscheidet sich der Mensch für diese Handlungsweise.
Sokrates lehnt daher die Meinung, dass der Mensch entgegen seinem besseren Wissen handeln würde, ab:
(...) ihr [macht] euch lächerlich mit euerer Behauptung, der Mensch ent- scheide sich, verführt und geblendet durch die Reize der Lust, in seinem Tun nicht selten für das Schlechte trotz der Erkenntnis, daß es schlecht sei, während es doch in seiner Macht stünde es zu unterlassen; und ebenso mit der anderen Behauptung, der Mensch wolle das Gute nicht tun trotz Er- kenntnis desselben, weil er sich der Lust des Augenblicks gefangen gebe. (Platon 109) Wer möchte schon absichtlich bei sich Unlust hervorrufen? Doch Sokrates im- pliziert hier, dass der Mensch immer nach dem Besten für sich strebt und auch sein eigener Herr ist. Fälle sind denkbar, in denen Menschen nach dem Schlechten streben, zum Be ispiel aus einer gewissen Lebensmüdigkeit heraus. Ich denke da zum Beispiel an den lebensunlustigen Protagonisten Ben Sanderson aus dem Film Leaving Las Vegas, der wegen seines Alkoholkonsums Frau und Arbeit verloren hat und der sich absichtlich in Las Vegas zu Tode trinkt. Überhaupt läßt die Suchtproblematik die Auffassung von Sokrates bzw. Platon realitätsfern erscheinen, weil viele Süchtige nicht nur wissen, was besser für sie wäre, sondern auch gerne etwas anderes tun würden, als ihren Süchten nachzugeben.
Doch nach Sokrates handelt man nur dann schlecht, wenn man nicht weiß, dass eine Handlungsweise schlecht ist.
Aristoteles hat eine Position zwischen diesen beiden umrissenen Positionen eingenommen. In der Nikomachischen Ethik schreibt Aristoteles:
Da aber die zweite Prämisse im praktischen Schlußverfahren eine Mei- nung über etwas Sinnfälliges und Herrin der Handlungen ist, so ist der le i- denschaftlich Erregte entweder nicht in ihrem Besitz oder doch nur so, daß dieser Besitz kein Wissen ist, sondern ein Reden in der Art, wie ein Be- trunkener den Empedokles zitiert. Und weil der letzte Begriff, der das Handeln bestimmt, nicht allgemein und nicht im selben Sinne wissen- schaftlich zu sein scheint wie ein allgemeiner, so gewinnt es auch das An- sehen, als ob das Philosophem des Sokrates zu Recht bestände. Denn nicht im Angesicht der eigentlich als solche erscheinenden Wissenschaft tritt die Leidenschaft auf, noch ist es Wissenschaft, die durch sie verkehrt wird, sondern nur der sinnlichen Erkenntnis gegenüber kommt sie auf. (Aristo- teles 1147 b 9-19)
Er gesteht immerhin zu, dass es Unbeherrschtheit geben kann, wenn es sich bei dem Wissen nur um unsicheren Glauben oder totes Wissen handelt. Oder das Bewußtsein ist vorübergehend derart beeinträchtigt, dass das Wissen über die beste Handlungsalternative nicht präsent ist.
Aristoteles war klug genug zu bemerken, dass so eine radikale Position, wie sie Sokrates bzw. Platon vertritt, völlig im Gegensatz zu unserem alltäglichen Erleben steht. Natürlich gibt es Phänomene von Wollungen, die eben nicht zu dementsprechenden Handlungen führen.
Um so erstaunlicher, dass in der Gegenwart die Position von Sokrates durch Charles Taylor, Norman Malcolm und Ursula Wolf wieder aufgenommen wurde und bestritten wird, dass es das Phänomen der Willensschwäche gibt. Jemand, der zwar meint, zu wollen, aber nicht das tut, was er für das Beste hält, hat sich in sich selbst getäuscht, so zum Beispiel Ursula Wolf in ihrem Aufsatz "Zum Problem der Willensschwäche".
4. Die Ceteris-Paribus -Klausel
Wenn bei einer wissenschaftlichen Analyse die Relevanz unterschiedlicher Bedingungen für ein Phänomen eruiert werden sollen, wird die CeterisParibus-Klausel angewandt. Das heißt, dass bestimmte Bedingungen isoliert werden und die Effekte ihrer Variation bei der Annahme sonst gleich bleibender restlicher Bedingungen beobachtet werden.
Malcolm benutzt den Begriff "Ceteris-Paribus-Klausel", um das Wegbleiben äußerer hinderlicher Umstände zu bezeichnen. Seine These ist, dass der Wille immer zu einer Handlung führen würde, wenn man die äußeren Bedingungen konstant hält. Wenn also eine Intention nicht zur Ausführung kommt, ist die Ursache in der Psyche des Handelnden zu suchen.
Ich möchte nun aber an drei ähnlichen Beispielen zeigen, wie schwer es ist, zwischen äußeren und inneren Bedingungen zu unterscheiden.
X arbeitet in einem großen Unternehmen als Angestellter. Er geht in die Cafe- teria, in der es eine Selbstbedienungstheke gibt. Hinter einer Scheibe befindet sich ein Stück Kuchen. X will diesen Kuchen essen. X hat gerade Frühstücks- pause, die aber nur eine viertel Stunde dauert. Er kann die Pause nicht ausdeh- nen oder verlegen, weil er in einem Arbeitsablauf steckt, der ihm nur jetzt und nur genau eine viertel Stunde Pause gönnt. Doch nun passiert plötzlich etwas, was X von der intendierten Handlung abhält. Stellen wir uns drei verschiedene Geschichten vor, was passieren könnte:
1. In dem Unternehmen, in dem X arbeitet, bricht gerade ein großes Feuer aus. Die Feuersirene geht los. X riecht den Geruch von verbranntem Material; der Rauch des Feuers gerät in die Cafeteria; es wird merklich wärmer; die Luft wird stickig. X weiß, dass er sich in diesem Fall sofort zum Ausgang bewegen muß, was er auch tut. Er gelangt ins Freie und ist gerettet.
2. X begegnet vor der Kuchenauslage zufälligerweise seinem Chef, der X etwas Wichtiges mitteilen muß, was die ganze Pausenzeit von X in Anspruch nimmt. X kommt nicht dazu, sich die Süßigkeit zu kaufen.
3. X hat seinen Geldbeutel vergessen. An der Kasse kann er nicht mit seiner Kreditkarte zahlen.
Diese drei Beispiele für äußere Umstände unterscheiden sich. Wenn ein Feuer ausbricht, dann gibt es wirklich keine andere Möglichkeit für X, als zu fliehen. Man würde nicht in Frage stellen, dass X jemals den Willen hatte, ein Stück Kuchen zu essen.
Das zweite Beispiel ist schon etwas komplizierter, weil X sich in einem Di- lemma befindet. Soll er das Verhältnis zu seinem Chef und damit seine Karrie- re gefährden, in dem er seiner Lust nachgibt oder soll er lieber im Dienste der Sache und seiner eigenen Karriere seine Begierden und Gelüste in Schach ha l- ten?
Wenn X aber kein Geld hat, dann könnte man nur oberflächlich behaupten, dass X an den äußeren Umständen gescheitert sei. Man könnte vermuten, dass X sein Geld unbewußt absichtlich nicht eingesteckt hat, um gesund zu bleiben. Aber man könnte auch fragen, warum er den Kassierer oder die Kassiererin nicht fragt, ob sie ihm Kredit gewährt; er könnte sich auch in der Cafeteria um- schauen, ob er nicht einen von ihm bekannten Kollegen trifft, der ihm Geld leihen könnte. Er könnte letztendlich auch den Kuchen entwenden. In diesem Beispiel scheint am deutlichsten hervorzutreten, dass das äußere Hindernis nicht unüberwindbar st und wenn X die Durchführung seiner Ziele aufgibt, würde man es eher auf innere Widerstände als auf äußere Hindernisse zurück- führen.
5. Das Problem bei der isolierten Betrachtung von inneren Widerständen und äußeren Umständen
Das genannte Beispiel verdeutlicht etwas, was ich die Verwobenheit von inneren Prozessen mit äußeren Umständen nennen möchte. Ich meine, dass es schwer, wenn nicht sogar unmöglich ist, zu definieren, wo die äußeren Hindernisse anfangen und die inneren Widerstände aufhören.
Als Novalis das Bonmot "Wenn man erst will, dann kann man auch" (http://www.cnl.salk.edu/~wiskott/Services/DeutscheAphorismen/keywordQuo tes/wollen.html) formulierte, bezog er eine Extremposition, nach dem es ganz generell keine äußere Hindernisse gibt, sondern es ganz alleine von einem selbst abhängt, ob ein Wille durchsetzbar ist.
Insofern könnte radikal behauptet werden, dass alle äußeren Hindernisse in Wirklichkeit innere Widerstände sind. Doch es scheint klar zu sein, dass zum Beispiel der Wille, unsterblich zu werden, nicht an inneren Widerständen scheitert, sondern an äußeren, naturgemäßen Hindernissen. Selbst wenn die Medizin derartige Fortschritte machen würde, und in der fernen Zukunft dazu in der Lage wäre, den Menschen unsterblich zu machen, vielleicht durch ein Ersatzteilsystem, bei dem verschlissene Organe mit Hilfe des genetischen Ma- terials neu erzeugt und dann ersetzt werden, dann wäre es doch heutzutage noch unmöglich, unsterblich zu werden. Die Person, die unsterblich werden will, kann ja nichts dafür, dass die Medizin in ihrer Entwicklung noch nicht so weit gediehen ist. Selbst wenn diese Person alle ihre Kraft, ihre Zeit und ihr Wissen darin investieren würde, zu erforschen, wie man den menschlichen Körper unsterblich macht, könnte ihn der Faktor Zeit an seinem Erfolg hindern und sein eigener Verfall tritt ein, bevor er die "Formel zur Unsterblichkeit" gefunden hat.
Wolf ist insoweit recht zu geben, dass es tatsächlich so etwas wie äußere Hin- dernisse gibt, die eine Handlung absolut verhindern, egal, was der Protagonist will.
Doch es scheint, dass nicht alle diejenigen Faktoren, die als äußeren Umstände bezeichnet werden, echte Hindernisse sind. Oder gilt es umgekehrt, daß alle inneren Widerstände in Wirklichkeit äußere hinderliche Umstände sind? Wie kann man hier genau die Grenze ziehen?
6. Die Trennung von inneren und äußeren Bedingungen als ein Trick
Ich meine entge gen Taylor, Malcolm und Wolf, dass es durchaus Wollungen geben kann, die nicht zu dementsprechenden Handlungen führen. Wollungen, die keine dementsprechenden Handlungen zur Folge haben, unterscheiden sich in ihrer qualia, also ihrer Gefühlsqualität nicht von Wollungen, die zu dement- sprechenden Handlungen führen. Das heißt, dass gescheiterte Wollungen sich im Moment des Wollens genauso anfühlen wie erfolgreiche Wollungen.
Die äußeren Umstände, von der in der Willensdefinition von Wolf die Rede ist, sind ein nebulöses Gebilde, dessen genaue Konturen man nicht umreißen kann.
Ich behaupte, dass die Ceteris-Paribus-Klausel ein Trick der Verfechter der Theorie, dass es keine Willensschwäche gibt, ist, weil sie spüren, dass es Wollungen gibt, die nicht zu einer Handlung führen.
Dieser Trick ist wie das Netz des Seiltänzers. Der Seiltänzer täuscht Mut vor, wenn er aufs Seil steigt, obwohl ihn ein Netz auffangen würde. Genauso be- haupten einige Philosophen sehr forsch, dass es keine Willensschwäche gebe und die zweifelhaften Fälle, bei denen man nicht sagen kann, dass der Han- delnde nicht wirklich wollte, fangen sich in einem Netz, in dem sich alle Fälle sammeln, bei denen die Durchsetzung von Wollungen angeblich durch äußere Umstände vereitelt wurde.
Es gibt eben durchaus Fälle, in denen eben eine Person ernsthaft etwas will, die intendierte Handlung aber nicht durchführt. Will man dieser Person es abspre- chen, nicht wirklich gewollt zu haben? Würde man die "willensschwachen" Person mit dieser Meinung konfrontieren, würde sie selbstverständlich protes- tieren. Sie würde sagen, dass sich ihr Wille, der nicht zu einer Handlung führte, in nichts sich von einem anderen Willen unterscheidet, der tatsächlich zu einer Handlung führte. Gestern wollte X Eis essen und hat es dann auch getan; heute hat X diese Absicht wieder aufgegeben, weil er zu faul ist, zum Supermarkt zu gehen. Aber im Moment des Wollens lag dessen Scheitern noch nicht fest. Auch die Gegner des Begriffs der Willensschwäche wissen das. Um nicht völ- lig unglaubwürdig zu wirken, müssen sie sich ein Hintertürchen offen lassen. Sie erfinden die "äußeren Umstände", die die Durchsetzung eines Willens ver- hindern. Wenn also immer jemand ein Gegenbeispiel gegen die These, es gebe keine Willensschwäche, anführt, würden ihre Verfechter behaupten können, dass es die äußeren Umstände waren, die die Durchführung dieses Willens ver- hinderten.
Diese Möglichkeit gibt es, weil niemals klar bestimmt wurde, wie sich äußere Umstände und innere Widerstände abgrenzen lassen.
Ich würde sogar behaupten, dass sich die inneren Widerstände von den äußeren Umständen gar nicht abgrenzen lassenkönnen. Wenn der Determinismus wahr ist und der Mensch den Naturgesetzen unterliegt, so ist sein Verhalten ein Ergebnis von Umständen. Seine inneren Widerstände sind dann Ergebnis der Einflüsse seiner Biologie und seiner Umwelt. Nichts ist wirklich ursprünglich in einer Person, sondern die Person ist ein Ort, an dem zahlreiche Kausalketten zusammentreffen, sich überschneiden und vermischen. Moralische Verantwortung wäre dann das Ergebnis einer Zuschreibung.
Man könnte nun einwenden, dass Willensschwäche im Determinismus nicht möglich ist, weil die Eigenschaft "Schwäche" des Willens scheinbar ursprüng- lich vom Handelnden abhängt, nach der Theorie des Determinismus aber alles bedingt ist.
Dem ist zu entgegnen, dass genauso wie in einem Automaten bestimmte Ein- zelteile stark oder schwach arbeiten können, so auch bestimmte Glieder einer Kausalkette, die durch einen Menschen hindurchläuft, stark oder schwach sein können. Die Schwäche des Willens wäre somit auch bedingt durch äußere Um- stände.
7. Ist das Problem der Willensschwäche ein sprachliches Problem?
Die Ausflucht, die Wolf sich bei der Verneinung der Willensschwäche läßt, dient zur Stabilisierung eines ohnehin schwachen Lösungsversuchs des Prob- lems der Willensschwäche, denn Wolf versucht durch eine vermeintliche sprachliche Klärung ein handlungstheoretisches Problem zu lösen, so als ob frei nach Wittgenstein die meisten philosophischen Probleme sprachlichen Ursprungs seien. Daher liefert Wolf nur eine Scheinlösung des Problems der Willensschwäche. Wenn man sagt, dass es Wollungen nicht gibt, die nicht zu dementsprechenden Handlungen führen, hat man damit das Problem nicht gelöst, dass Menschen Sätze sprechen wie "Ich möchte X tun", dass sie dies mit einer bestimmten Gefühlsqualität verbinden und dass sie dann trotzdem X nicht tun. Man kann eine philosophische Problemstellung, die einen ga nz realen Widerspruch beschreibt, nicht durch eine Neuordnung der Begriffe lösen. Das Problem der Willensschwäche ist nämlich kein sprachliches Problem.
Die Vorgehe nsweise von Wolf ist ähnlich der eines Arztes, der ein Symptom einer Krankheit erfolgreich bekämpft; diese Krankheit bricht aber an anderer Stelle des Körpers wieder aus, weil nichts gegen die Ursache dieser Krankheit getan wurde. Wenn zum Beispiel jemand stark unter Stress steht und deswegen ein Magengeschwür hat, kann man möglicherweise das Geschwür als Symptom erfolgreich bekämpfen; doch dann äußert sich der Stress in Zukunft vielleicht in Migräne. Genauso wird man den Widerspruch zwischen Absichten und Handlungen nicht los, wenn man sagt, dass der Wille notwendig zu einer Handlung führt; denn dann müßte man wenigstens ein Verb so definieren, dass es das Haben einer Absicht bezeichnet, die eben nicht zu einer dementsprechenden Handlung führt. Wenn es der Wille ist, der niemals nicht zur Handlung führen würde, dann wäre es eben die Absicht oder der Wunsch, der schwach sein kann. Damit hat man wieder das Problem, das ein Handlungsplan nicht umgesetzt wird. Das Problem ist also auf ein anderes Feld verlagert worden.
8. Die Alternative: Willensschwäche als ein Fall von bloßem Wollen
Der Begriff der Willensschwäche ist also nicht aufzuheben. Eine Alternative zu dieser These, das es keine Willensschwäche gebe, muß gefunden werden. In dem Kapitel "Bloßes Wollen?" aus dem BuchWollenvon Gottfried Seebass können wir fündig werden. Er führt zahlreiche Beispiele an, in denen Men- schen im Alltag sagen, dass sie etwas wollen, was sie dann aber nicht tun. Fäl- le, bei denen das Gewollte aber aufgrund von Willensschwäche nicht getan wird, sind nur ein Teil jener Wollungen, die nicht zur Handlung führen.
Seebass unterscheidet vier Formen von bloßem Wollen. Die erste Gruppe sind die erfolglosen Versuche; eine Person beginnt schon mit der Handlung, wird aber durch äußere oder innere Widerstände an der Vollendung gehindert. Die zweite Form sind die unausgeführten Vorsätze. Ein Beispiel ist der Vorsatz einer Person, in diesem Jahr seinem Freund pünktlich zum Geburtstag zu gratu- lieren, der dann nicht umgesetzt wird. Während Wolf Personen wie dieser sol- cherart Vorsätze absprechen würde, so meint Seebass, daß es außer Frage ste- he, dass "Absichtserklärungen aufrichtig sein können, obwohl entsprechende Handlungen oder Unterlassungen fehlen" (62). Die dritte Form sind die Wol- lungen, die im Ansatz vereitelt werden Es handelt sich dabei um spontan auf das Hier und Jetzt bezogene Wollungen, die aufgrund äußerer oder innerer Hindernisse nicht ausgeführt werden können. Der Übergang von der ersten zur dritten Form ist fließend. Die vierte Form des bloßen Wollens sind "nicht nur dadur ch gekennzeichnet, daß kein Versuch, sondern auch kein Ansatz zu einer Verwirklichung unternommen wird" (Seebass, 63). Das sind unter anderem Fälle, bei der die Umsetzung eines Willens gar nicht in der Macht des Han- delnden steht. Ein Beispiel dafür st, wenn jemand sagt: "Ich will, dass heute die Sonne scheint".
Man könnte nun an der Auffassung von Seebass kritisieren, dass er den Begriff des Wollens inflationär verwendet, weil er in Anlehung an den alltäglichen Sprachgebrauch unter die Kategorie der Wollungen so viele verschiedene Un- tergruppierungen subsumiert. Weiß man noch, wovon jemand spricht, der sagt, dass er etwas will, wenn man den Begriff des Willens soweit wie Seebass fasst?
Nach Austins Meinung spricht aber viel dafür, alltägliche Formulierungen in die Wissenschaft zu übernehmen, weil sie sich in der Praxis bewährt haben. Er stellt die Sprachentwicklung als eine Evolution dar, in der sich über die Zeit hinweg die tüchtigsten Formulierungen durchsetzen. Sicherlich gibt es Phäno- mene, die nicht durch die Alltagssprache adäquat dargestellt werden können. Doch im Falle von Willensschwäche ist dies nicht der Fall. Der alltägliche, weitumfassende Gebrauch des Wortes "Willen" stört nicht das Verständnis der Sätze, in denen Wollungen formuliert werden.
Denn wenn zum Beispiel ein Kind sagt, dass es Lokomotivführer werden will oder jemand singt, dass er lieber ein Huhn sein will, ist das auch ohne weiteres Nachfragen als eine Äußerung eines Willens zu verstehen, der sehr wahrscheinlich bzw. ganz bestimmt nicht umgesetzt wird. Die Lebenserfahrung und die Intelligenz der Sprecher machen es unnötig, hier zwischen verschiedenen intentionalen Begriffen zu untersche iden.
Unterschieden werden sollte aber zwischen Willensschwäche und anderen Fäl- len, bei denen auch Wollungen nicht in Handlungen münden. Bei der Willens- schwäche muß der Handelnde selbst das Gefühl haben, dass sein Wille nicht ausreicht, sich gegenüber anderen Impulsen durchzusetzen. Der Handelnde muß sich selbst als getrieben ansehen. Er hat zwar einen Willen, es besser zu tun, aber immer kommen ihm Zwänge und Prinzipien2dazwischen.
9. Zusammenfassung
Ich meine gezeigt zu haben, dass das Problem der Willensschwäche kein sprachliches Problem ist, sondern dass diesem Phänomen etwas Wirkliches in der Welt entspricht. Die äußeren Umstände und die inneren Widerstände sind derart ineinander verwoben, dass man sie nicht isoliert betrachten kann. Wenn der Determinismus wahr ist, dann sind alle inneren Widerstände das Ergebnis äußerer Umständ e. Dann ist der Wille ein Glied in einer Kausalkette und der Grad seiner Stärke bestimmt durch Umwelteinflüsse und das Erbmaterial. Als Willensschwäche wird eine bestimmte Sorte von Wollungen bezeichnet, die nicht zu einer Handlung führen. Vom Handelnden wird es so erlebt, dass ihn
die Prinzipien und Zwänge übermannen und er nicht mehr sein eigener Herr ist.
Literaturverzeichnis
Aristoteles. Nikomachische Ethik. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1985.
Austin, John Langshaw. "Ein Plädoyer für Entschuldigungen". Gesammeltephilosophische Aufsätze. Stuttgart: Reclam Verlag, 1986.
Davidson, Donald. "Wie ist Willensschwäche möglich?" Handlung und Ereignis. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985. S. 41 - 72.
Descartes, René. "Über die Leidenschaften der Seele." Ausgewählte Schriften.Leipzig: Verlag Philipp Reclam, 1980. S. 229 - 337.
Die Bibel. Freiburg im Breisgau: Herder, 1965.
Figgis, Mike. Leaving Las Vegas.USA/Frankreich: Initial Productions / Lumiere Pictures, 1995. (Spielfilm)
Hare, R. M. "Das Problem der Willensschwäche". Freiheit und Vernunft.Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1983. S. 84 - 102.
Kenny, Anthony. Will, Freedom and Power. Oxford: Basil Blackwell, 1975.
Malcolm, Norman. "Ist der Mechanismus vorstellbar?" Analytische Handlungstheorie. Band 2. Hg. von Ansgar Beckermann. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985. S. 332 - 363.
Platon. "Protagoras". Sämtliche Dialoge. Band 1. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1993.
Seebass, Gottfried. Wollen. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann GmbH, 1993.
Taylor, Charles. Explanation of Behaviour. London: 1964. Zit. in Malcolm, Norman. "Ist der Mechanismus vorstellbar?" Analytische Handlungstheorie. Band 2. Hg. von Ansgar Beckermann. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985. S. 332 - 363.
Wolf, Ursula. "Zum Problem der Willensschwäche". Zeitschrift für philoso- phische Forschung. Band 39. Meisenheim/Glan: Verlag Anton Hain, 1985. S. 21 - 33.
[...]
1 Ich benutze hier als Plural des Substantivs "Wille" das unbeliebte, weil altmodische Wort "Wollungen", weil es keine andere Möglichkeit gibt, von dem Wort "Wille" den Plural zu bilden.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht das Problem der Willensschwäche und die Definition des Willens, angeregt durch die Aufsätze von Norman Malcolm und Ursula Wolf.
Wie definieren Malcolm und Wolf den Willen?
Malcolm und Wolf definieren den Willen so, dass er notwendigerweise zu einer entsprechenden Handlung führt, es sei denn, äußere Umstände verhindern dies.
Was ist Willensschwäche?
Willensschwäche bezeichnet den Zustand, in dem jemand eine Handlung X ausführt, obwohl er die Alternative Y für die bessere hält. Es wird auch als Unbeherrschtheit bezeichnet.
Welche Positionen vertreten Matthäus und Platon zur Willensschwäche?
Matthäus (im Evangelium) sieht Willensstärke als Ergebnis geistiger Anstrengung, während Platon die Existenz von Willensschwäche ablehnt und argumentiert, dass unser Handeln von unserem Wissen abhängt.
Was ist die Ceteris-Paribus-Klausel und wie wird sie in Bezug auf den Willen verwendet?
Die Ceteris-Paribus-Klausel bezeichnet das Wegbleiben äußerer hinderlicher Umstände. Malcolm verwendet sie, um zu argumentieren, dass der Wille immer zu einer Handlung führen würde, wenn die äußeren Bedingungen konstant gehalten werden.
Was ist das Problem bei der Trennung von inneren und äußeren Bedingungen?
Es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, zu definieren, wo die äußeren Hindernisse anfangen und die inneren Widerstände aufhören, da sie stark miteinander verwoben sind.
Wird die Trennung von inneren und äußeren Bedingungen als ein Trick angesehen?
Ja, der Autor argumentiert, dass die Ceteris-Paribus-Klausel und die Betonung der "äußeren Umstände" ein Trick von Philosophen ist, die die Willensschwäche leugnen, um Fälle zu erklären, in denen eine Wollung nicht zu einer Handlung führt.
Ist das Problem der Willensschwäche ein sprachliches Problem?
Nein, der Autor argumentiert, dass es sich nicht um ein sprachliches Problem handelt, sondern um ein reales Phänomen, das nicht durch eine Neuordnung der Begriffe gelöst werden kann.
Welche Alternative zur Verneinung der Willensschwäche wird vorgeschlagen?
Als Alternative wird der Begriff des "bloßen Wollens" nach Gottfried Seebass vorgeschlagen, der verschiedene Formen von Wollungen umfasst, die nicht zu Handlungen führen.
Welche Formen des bloßen Wollens unterscheidet Seebass?
Seebass unterscheidet vier Formen des bloßen Wollens: erfolglose Versuche, unausgeführte Vorsätze, Wollungen, die im Ansatz vereitelt werden, und Wollungen, bei denen kein Versuch zur Verwirklichung unternommen wird.
Wie lautet die Zusammenfassung der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das Problem der Willensschwäche ein reales Phänomen ist, bei dem äußere Umstände und innere Widerstände derart ineinander verwoben sind, dass sie nicht isoliert betrachtet werden können. Der Handelnde erlebt, dass ihn Prinzipien und Zwänge übermannen und er nicht mehr sein eigener Herr ist.
- Quote paper
- Markus Hieber (Author), 2001, Äußere Umstände und Innere Widerstände bei der Willensschwäche, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103984