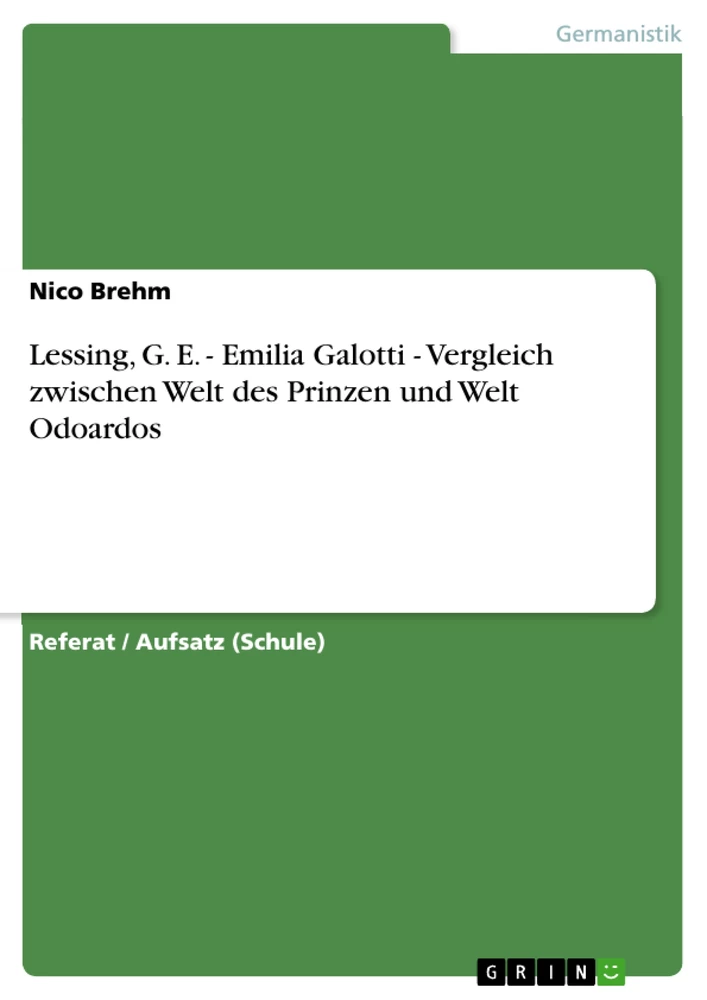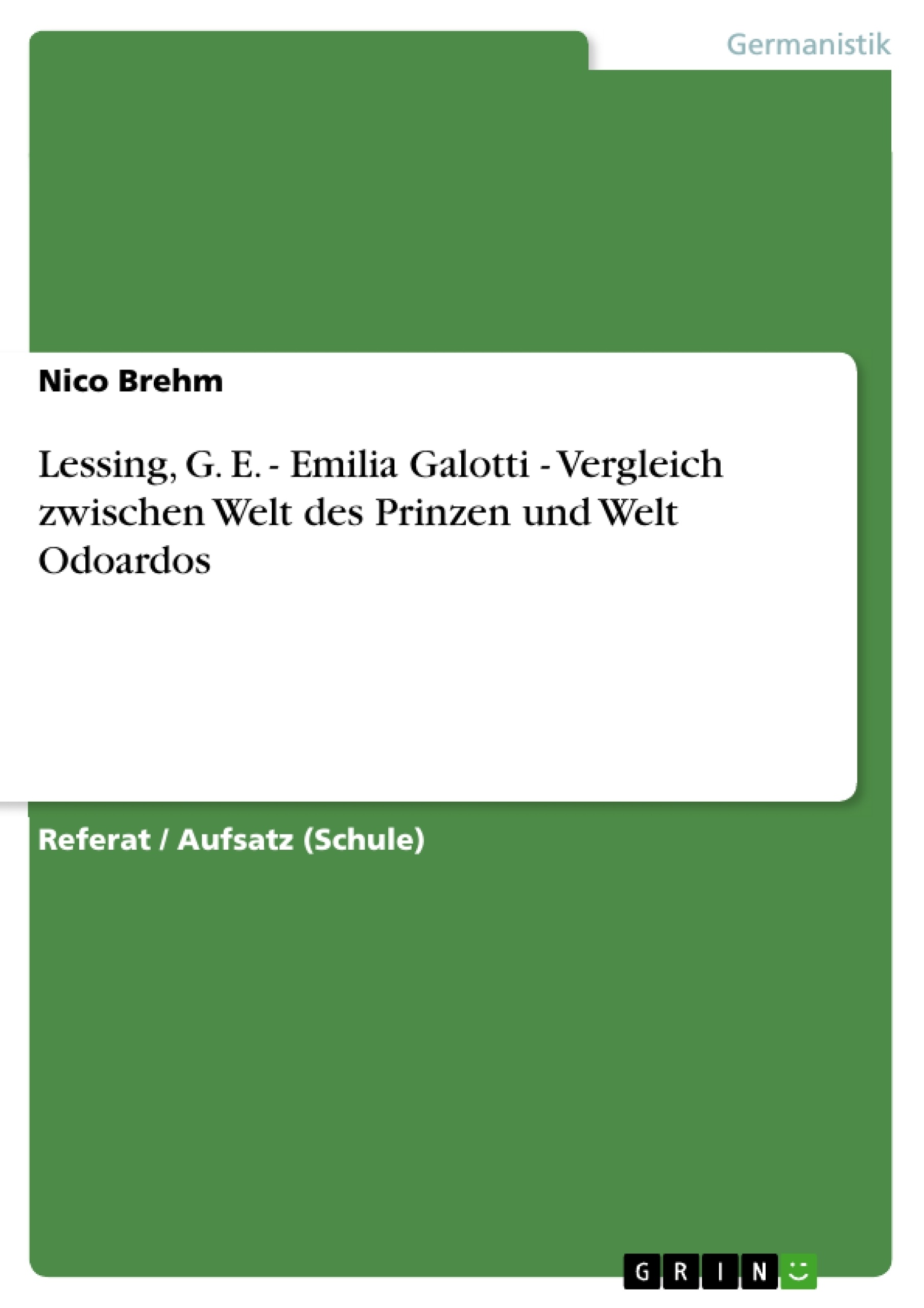In einer Welt des höfischen Prunks und bürgerlicher Tugend, wo Macht korrumpiert und Moral auf die Probe gestellt wird, entfaltet sich eine Tragödie um Liebe, Freiheit und den Preis der Unschuld. „Emilia Galotti“ von G.E. Lessing, ein Schlüsselwerk der Aufklärung, offenbart die brisante Konfrontation zweier Welten: Hier der Adel, gefangen in Intrigen, Sittenverfall und absolutistischer Willkür, verkörpert durch Prinz Hettore von Guastalla, der seine Macht missbraucht, um seine Begierden zu befriedigen; dort das aufstrebende Bürgertum, dessen Streben nach moralischer Vollkommenheit und individueller Freiheit in den Werten Odoardo Galottis und seiner Familie widergespiegelt wird. Doch inmitten dieses Spannungsfelds steht Emilia, ein Sinnbild aufklärerischer Ideale, hin- und hergerissen zwischen väterlicher Strenge und ihrem eigenen Begehren. Gefangen in einem Netz aus höfischen Ränkespielen, wird sie zum Spielball der Mächtigen, ihr Schicksal besiegelt durch eine Gesellschaft, die Tugend und Ehre über alles stellt. Lessings Drama seziert die Heuchelei des Adels, die starren Moralvorstellungen des Bürgertums und die Ohnmacht des Individuums gegenüber einer korrupten Ordnung. Es ist eine Geschichte von unterdrückter Weiblichkeit, verpassten Gelegenheiten und dem tragischen Scheitern einer Liebe, die von den Fesseln der Konvention erdrückt wird. Tauchen Sie ein in eine Epoche des Umbruchs, in der die Ideale der Aufklärung auf die harte Realität des 18. Jahrhunderts treffen. Entdecken Sie die zeitlose Relevanz von Lessings Meisterwerk, das die Frage nach der Vereinbarkeit von persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung aufwirft und bis heute nichts von seiner Sprengkraft verloren hat. Erleben Sie, wie die politischen Verpflichtungen und Konvenienzehen das Privatleben einschränken und wie die Auftragskunst zur Täuschung des Volkes missbraucht wird. Begleiten Sie Emilia auf ihrem Leidensweg und stellen Sie sich der Frage, wie weit man gehen darf, um die eigene Ehre und Unschuld zu bewahren. „Emilia Galotti“ ist mehr als nur ein Trauerspiel; es ist ein Spiegelbild einer Gesellschaft im Wandel und ein Appell an die Vernunft und das Gewissen des Einzelnen. Es ist ein Zeugnis der moralischen Verderbtheit, der Intrigen und des Strebens nach Unabhängigkeit, das die Welt bis heute prägt. Lassen Sie sich von der Sprachgewalt und der psychologischen Tiefe der Charaktere in den Bann ziehen und entdecken Sie die verborgenen Schichten dieses literarischen Juwels.
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Versuche desselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung“ (Kennwort 11, S. 15).
Diese Definition für den Begriff Aufklärung wurde 1784, nur 12 Jahre nach der Uraufführung des Trauerspiels „Emilia Galotti“, von J. Kant verfasst. In ihr spiegelt sich der Unmut des erwachenden Bürgertums gegenüber den Lehren und Zuständen der damaligen Zeit wieder. Erstmals in der Geschichte trafen zwei grundsätzlich verschiedene Weltanschauungen aufeinander. Die des Hofes und die des Bürgertums. Diese beiden gegensätzlichen Welten sollen hier am Beispiel des Trauerspiels „Emilia Galotti“ von G. E. Lessing dargestellt werden.
Als erstes soll die Welt des Prinzen und des höfischen Lebens betrachtet werden. Für die damalige Zeit ganz normal, und sich großer Beliebtheit an Herrscherhöfen der ganzen Welt erfreuend, war die Auftragskunst. Der Herrscher vergab Aufträge an Künstler, um seine Macht, Größe, Gnädigkeit und Schönheit nach außen zu repräsentieren (vgl. S. 6, Z. 28 ff). Dadurch wurde das Volk auch getäuscht, denn der Herrscher ließ sich gerne in einem anderen Licht darstellen, als er es eigentlich war.
„Alles was die Kunst aus den großen, hervorragenden, sturen, starren Medusenaugen der Gräfin Gütes machen kann, das haben Sie, Conti, redlich daraus gemacht“ (S.7, Z. 32-35).
Ebenso soll darauf hingewiesen werden, dass an den europäischen Herrscherhöfen moralische Verderbtheit und Sittenverfall an der Tagesordnung waren. Das Mätressenwesen, „neben so einer Gemahlin sieht die Geliebte noch immer ihren Platz“ (S. 12, Z. 17-18), wurde nicht als etwas Lasterhaftes angesehen, sondern wurde allgemein toleriert. Prinz Hettore von Guastalla hält sich die Gräfin Orsina weiterhin als Mätresse, obwohl seine Vermählung mit der Prinzessin von Massa kurz bevorsteht. Zu diesem Zweck werden Lustschlösser erbaut, um sich dort mit der Geliebten oder den Geliebten treffen und vergnügen zu können. Oftmals wurden diese Lustschlösser auch als Rückzugsort für den Herrscher genutzt. „Aber bleiben Sie nicht in der Stadt. Fahren Sie sogleich nach ihrem Luftschlosse, nach Dosalo“(S. 16, Z. 38-39). Zur moralischen Verderbtheit des Hofes gehören auch die gerne und häufig gesponnenen Intrigen, um sich seiner Widersacher zu entledigen. Um die geplante Hochzeit zwischen Emilia und Graf Appiani zu vereiteln, überträgt der Prinz seinem Vertrautem Marinelli sämtliche Vollmachten, die dieser nutzt um einen Überfall auf das Hochzeitsgeleit vorzutäuschen., bei dem der Graf um kommt.
“Wollen Sie alles genehmigen, was ich tue? Alles, Marinelli, alles, was diesen Streich abwenden kann(S. 16, Z. 33-36). Bei dem Handeln des Prinzen und Marinellis sind Parallelen zu einem antiken Ereignis erkennbar. Kaiser Nero ließ einen gewissen Plantus erst auf Grund falscher Anschuldigungen verbannen. Doch dann kamen Gerüchte von einem von Plantus geplanten Aufstand auf. Nero überträgt seinem Prätorianerkommandanten und engsten Vertrautem Tigellinus ebenfalls sämtliche Vollmachten, worauf hin ihm dieser Plantus Kopf liefert (vgl. PM-History, S. 27 ff).
Ebenfalls zur Welt des Prinzen und des höfischen Lebens gehört die Tatsache der Alleinherrschaft. Der Prinz ist der absolute, feudale Herrscher, der sich keinen Regeln und Gesetzen zu beugen braucht. Das Volk war der Willkür des Herrschers völlig ausgeliefert, da er das Gesetz und somit Herr über Leben und Tod war. Die Willkür und Nachlässigkeit des Prinzen wurde am Beispiel des zu unterschreibenden Todesurteils deutlich. “Ein Todesurteil wäre zu unterschreiben. Recht gern. - Nur her! geschwind“ (S. 18, Z. 23-24). Außerdem missbraucht der Prinz sein Amt um private Interessen durchzusetzen. Hettore nimmt sich auf Grund seines Gewaltmonopols das Recht heraus, über den Kopf von Odoardo Galotti hinweg zu entscheiden, was mit Emilia zu geschehen hat. Damit Emilia in seinem Einflussbereich bleibt, ordnet er für sie „besondere Verwahrung“ (S. 77, Z. 4) an und will sie von Vater und Mutter trennen. Bei der Durchsetzung dieser privaten Interessen schreckt der Prinz auch nicht vor Gewalt und Mord zurück. Der Mord an Appiani kommt ihm nicht ungelegen. Für ihn ist ein Verbrechen wie dieses nichts verabscheuungswürdiges. Ihm ist nur sehr daran gelegen, dass nichts von seiner Beteiligung, an diesem Komplott, an die Öffentlichkeit kommt (S 52, Z. 37 ff).
Auch sollte erwähnt werden, dass das höfische Leben nur ein sehr eingeschränktes Privatleben zuließ. Das Leben am Hofe und das eines Prinzen war durch eine strenge Etikette und politische Verpflichtung bestimmt. Zu den politischen Pflichten des Prinzen zählten unter anderem das Durcharbeiten von Bittschriften (vgl. S. 4, Z. 6 ff) und die Urteilssprechung in Rechtsfragen (vgl. S. 18, Z. 21 ff). Sogenannte Konvenienzehen, Ehen die aus politischen Gründen geschlossen werden, um die Macht zu vergrößern oder zu sichern, gehörten ebenfalls zu den politischen Verpflichtungen und schränkten das Privatleben ein.
Bei der bevorstehenden Hochzeit Hettores, mit der Prinzessin von Massa, handelt es sich auch um ein solches Bündnis. „Mein Herz wird das Opfer eines elenden Staatsinteresses“ (S. 12, Z. 10-11).
„Den traurigen höfischen Geschäften des Prinzen“(KE S. 80, Z. 8). steht die Welt Odoardos und seiner Familie gegenüber. Die moralische Grundeinstellung des Bürgertums der damaligen Zeit wird am Beispiel Odoardos und seiner Familie deutlich. Das bürgerlich Leben war von einem Streben nach moralischer Vollkommenheit geprägt. Der Familienvater Odoardo übt sich in bürgerlichen Tugenden und stellt dies über alles. Nichts ist ihm wichtiger als die Tugendhaftigkeit und Ehrbarkeit seiner Tochter und Frau zu wahren. „Odoardo vertritt die Tugend ländlicher Sittlichkeit mit militärischer Strenge“ (Königs-Erläuterungen S. 38, Z. 10-11) und weiß um die Verführbarkeit seiner Tochter, die er darum nur ungern ohne Aufsicht lässt (vgl. Königs-Erläuterung S. 87, Z. 29 ff). Doch in seinen festgefahrenen moralischen Vorstellungen ist Odoardo „noch weit von aufklärerischen Positionen entfernt“ (König Erläuterungen S. 88, Z. 3-4). Schließlich geht er sogar soweit, seine eigene Tochter Emilia zu erstechen, um sie vor den Nachstellungen des Prinzen zu schützen und somit den Verlust ihrer Unschuld und Ehre zu verhindern. „Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert“(S. 82, Z. 19-20).
Emilia Galotti stellt in Lessings Werk die Figur der aufklärerischen Person dar. Ihre Tugend, ihre Unschuld und ihr Witz sind Zentralbegriffe der bürgerlich, aufklärerischen
Gesellschaftsentwürfe und Menschenbilder (vgl. Königs-Erläuterungen S. 83, Z. 27 ff). Emilia gerät in einen Zwist der vom Vater vorgelebten Moralvorstellungen und ihrer Sinnlichkeit. Darum wünscht sie sich den Tod. Sie kann als moderne Frau bezeichnet werden, da sie jede Schuld von ihrem Vater nimmt. „Nicht Sie, mein Vater -Ich selbst - ich selbst“ (S. 82, Z. 32). Diese aufgeklärt selbständig handelnde Frau passte nicht in das Bild der bürgerlichen Normen (vgl. Königs-Erläuterungen S. 95, Z. 25 f).
(Vgl. K-E S. 78, Z 4 ff) Die tiefe religiöse Verbundenheit und Frömmigkeit des Bürgertums wird besonders am Beispiel Emilias deutlich. Emilia geht regelmäßig in die Kirche, „nie hätte meine Andacht inniger , brünstiger sein sollen“ (S. 25, Z. 31-32), um zu beten. Im 18. Jahrhundert wurde noch ein Großteil des alltäglichen Leben durch den Glauben geregelt. Odoardo, der fest an die Lehren der Kirche glaubt, prophezeit dem Prinzen, dass dieser sich im Jenseits vor dem Angesicht Gottes für seine Taten verantworten muss (vgl. S. 83, Z. 12- 14).
Doch die tugendlichen Vorstellungen Odoardos lassen sich nur durch Distanz vom Hof aufrechterhalten. Odoardo verabscheut das Leben in der Stadt, da sich der Hof in unmittelbarer Nähe befindet. Für ihn ist der Hof ein Ort des Lasters und der Unzucht und der Prinz ein Wollüstling (vgl. Königs-Erläuterungen S. 38, Z. 9). Die einzige Möglichkeit Emilia vor dem Einfluss des Vaters zu bewahren ist ein Leben in ländlicher Abgeschiedenheit oder im Kloster. Odoardo möchte Emilia auf sein Landgut „nach Guastalla“ (S. 72, Z. 21) bringen. Als das vom Prinzen nicht gestattet wird, beschließt er sie in „ein Kloster“ (S. 74, Z. 28) zu schicken. Auch Appiani, der sich nach der Hochzeit mit Emilia in einem Bergtal niederlassen will, sucht die ländliche Abgeschiedenheit und den Abstand zum Hof. Mit den „väterlichen Tälern“ und dem Hof treffen gegensätzliche Lebensprogramme aufeinander, „die genau dem Widerspruch entsprechen, der sich als aufklärerisches Denkmodell und als politische Gegebenheit im vorrevolutionären Frankreich entwickelt hatte“ (Königs-Erläuterungen S. 49, Z. 15-19).
Eine unbestrittene Tatsache war im 18. Jahrhundert die Herrschaft des „Pater Familias“ als Familienoberhaupt. Odoardo stellt genau diesen strengen und nach moralischen Vorstellungen handelnden Vater und Ehemann dar. Er besitzt die Verfügungsgewalt über Frau und Tochter und ist für eine strenge Rollentrennung innerhalb der Familie. Emilia und Claudia können zwar ihre Meinung äußern, doch Odoardo hat immer das letzte Wort. Die Mutteer hat so viel Respekt vor Odoardo, dass sie Emilia drängt, ihm nichts von den Annäherungsversuchen des Prinzen zu erzählen. „Gott! Gott! Wenn dein Vater das wüsste!“ (S. 28, Z. 6 f). Ebenso möchte er Emilia in ein Kloster schicken. Als Odoardo vom Tod Appianis erfährt, glaubt er, dass Emilia etwas damit zu tun haben könnte und will ihr seine Liebe entziehen, falls es sich als wahr herausstellen sollte (S. 76). Odoardo kann als absoluter Herrscher innerhalb der Familie bezeichnet werden, der seine Liebe vergibt wie ein Fürst seine Gunst an Untertanen.
Abschließend kann gesagt werden, dass Lessings Werk genau den Geist des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung beschreibt. Es gab praktisch zwei verschiedene Lebenssphären, die des Adels und die des nach Unabhängigkeit strebenden Bürgertums. Heutzutage gibt es fast keinen Unterschied zwischen Adel und Bürgertum mehr, doch hat genau dies bereits in Emilia Galotti ansatzweise beschrieben Streben des aufgeklärten Bürgertums und einiger aufgeklärter Adliger zu diesen Veränderungen geführt. Die Tugenden der Figur Emilias bildeten nur wenige Jahre später den Schlachtruf der Französischen Revolution.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Quellen:
1. G. E. Lessing; Emilia Galotti, München 1971
2. Bernhardt Rüdiger; Königs Erläuterungen Emilia Galotti, Hollfeld 1997
3. PM History - Magazin für Geschichte, Hamburg 2000
4. Schroedel, Kennwort 11 - Literaturgeschichtliches Arbeitsbuch, Hannover 1992
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptaussage der Analyse von "Emilia Galotti"?
Die Analyse von "Emilia Galotti" von G.E. Lessing untersucht den Konflikt zwischen dem Adel und dem aufstrebenden Bürgertum im Zeitalter der Aufklärung. Sie zeigt die Gegensätze in ihren Moralvorstellungen, Lebensweisen und politischen Idealen.
Welche Rolle spielt der Prinz in "Emilia Galotti"?
Der Prinz verkörpert die moralische Verderbtheit und Willkür des Adels. Er missbraucht seine Macht, um seine persönlichen Interessen durchzusetzen, plant Intrigen und schreckt vor Gewalt nicht zurück. Sein höfisches Leben ist von Etikette und politischen Verpflichtungen geprägt, schränkt aber sein Privatleben ein.
Wie wird das Bürgertum in "Emilia Galotti" dargestellt?
Das Bürgertum wird durch Odoardo Galotti und seine Familie repräsentiert. Sie streben nach moralischer Vollkommenheit, Tugendhaftigkeit und Ehrbarkeit. Odoardo hält an strengen moralischen Vorstellungen fest und versucht, seine Tochter vor den Einflüssen des Hofes zu schützen.
Wer ist Emilia Galotti und was symbolisiert sie?
Emilia Galotti stellt eine aufgeklärte Persönlichkeit dar, die zwischen den Moralvorstellungen ihres Vaters und ihrer eigenen Sinnlichkeit hin- und hergerissen ist. Sie symbolisiert Tugend, Unschuld und Witz, die Zentralbegriffe der bürgerlich-aufklärerischen Gesellschaftsentwürfe sind.
Was sind die zentralen Themen des Trauerspiels?
Zu den zentralen Themen gehören der Konflikt zwischen Adel und Bürgertum, die moralische Verderbtheit des Hofes, die Tugendhaftigkeit des Bürgertums, die Bedeutung von Ehre und Unschuld, die Willkür der Macht und die Rolle der Religion.
Wie spiegelt sich die Aufklärung in "Emilia Galotti" wider?
Das Trauerspiel spiegelt den Geist der Aufklärung wider, indem es die Gegensätze zwischen den Lebenssphären des Adels und des nach Unabhängigkeit strebenden Bürgertums aufzeigt. Es verdeutlicht das Streben nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die später zum Schlachtruf der Französischen Revolution wurden.
Welche Bedeutung hat die ländliche Abgeschiedenheit im Trauerspiel?
Die ländliche Abgeschiedenheit symbolisiert den Rückzugsort des Bürgertums vor den verderblichen Einflüssen des Hofes. Odoardo und Appiani suchen die Abgeschiedenheit, um ihre moralischen Werte zu bewahren und ein tugendhaftes Leben zu führen.
Welche Rolle spielt Odoardo Galotti als Familienoberhaupt?
Odoardo Galotti verkörpert den strengen "Pater Familias", der nach moralischen Vorstellungen handelt und die Verfügungsgewalt über seine Frau und Tochter besitzt. Er ist für die strenge Rollentrennung innerhalb der Familie verantwortlich und hat immer das letzte Wort.
Welche historischen Parallelen werden in der Analyse gezogen?
Die Analyse zieht Parallelen zwischen dem Handeln des Prinzen und Marinellis und dem Verhalten von Kaiser Nero und seinem Vertrauten Tigellinus, um die Willkür der Macht und die Intrigen am Hof zu verdeutlichen.
Was sind die Schlussfolgerungen der Analyse?
Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass "Emilia Galotti" den Geist des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung präzise beschreibt und dass das Streben des aufgeklärten Bürgertums zu den Veränderungen geführt hat, die heutzutage fast keinen Unterschied mehr zwischen Adel und Bürgertum zulassen.
- Quote paper
- Nico Brehm (Author), 2001, Lessing, G. E. - Emilia Galotti - Vergleich zwischen Welt des Prinzen und Welt Odoardos, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103865