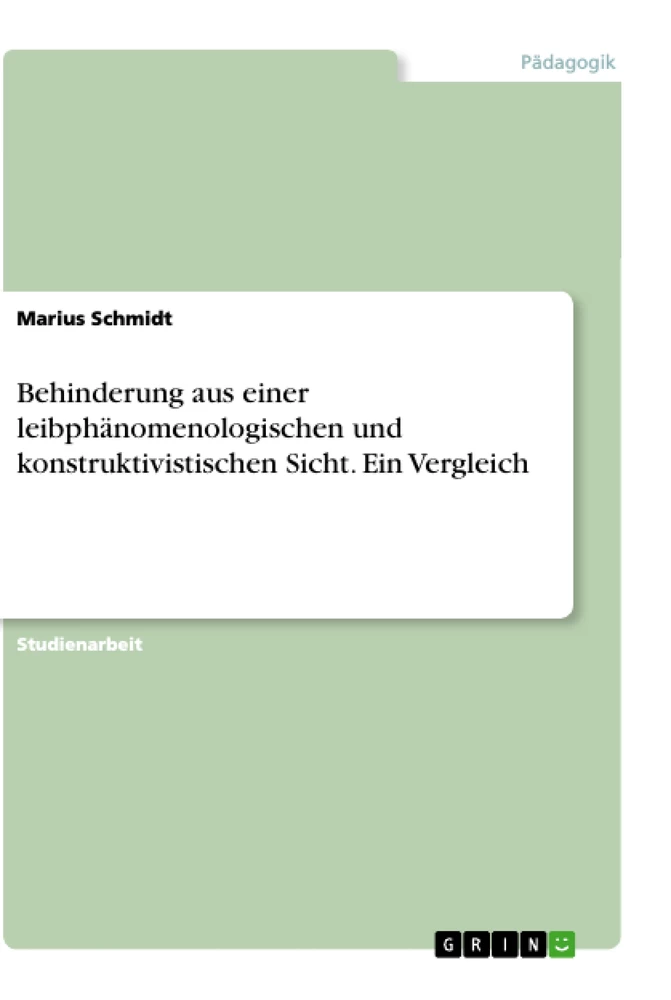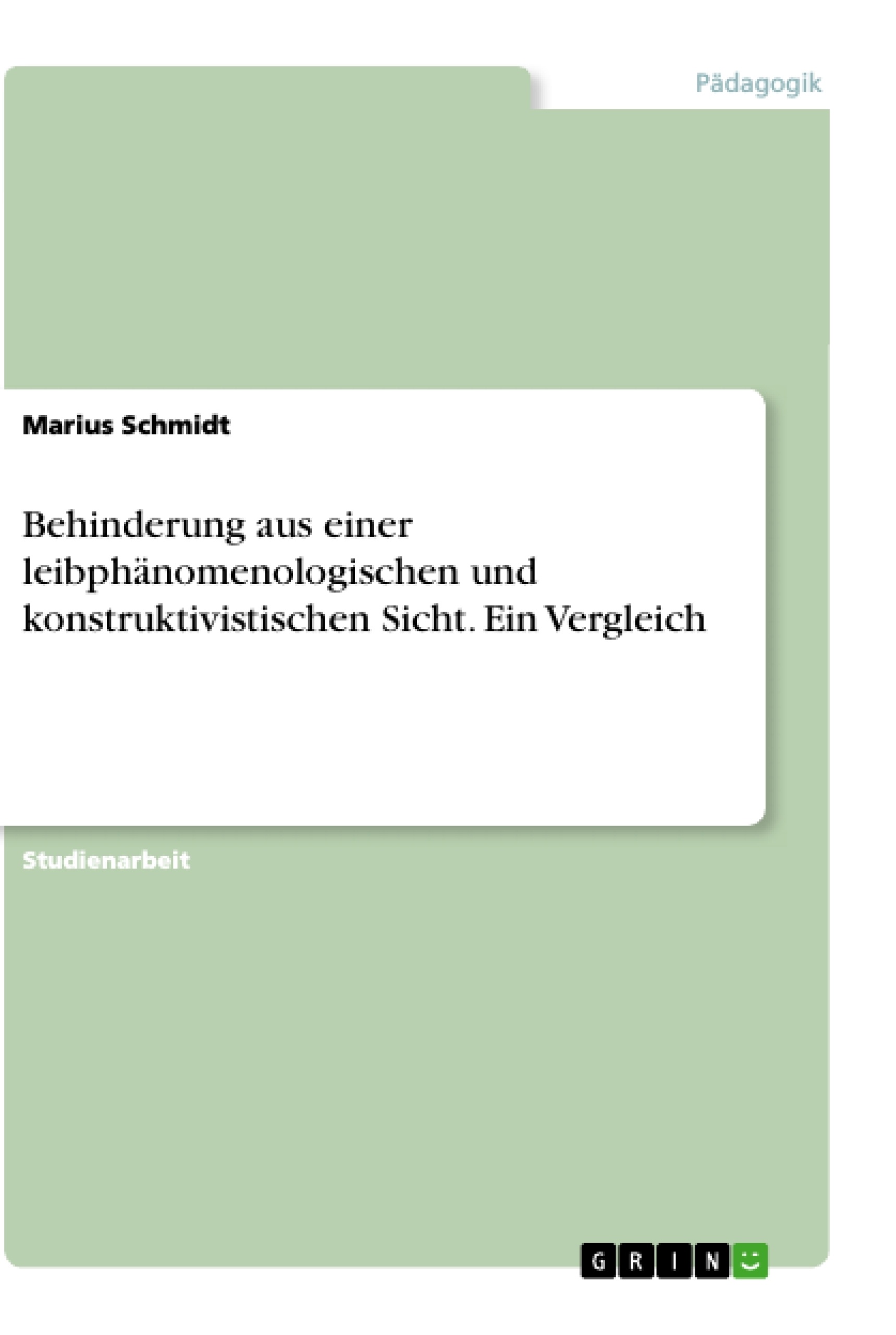In dieser Arbeit wird sich zunächst mit einer leibphänomenologischen Sicht auf Behinderung beschäftigt. In einem weiteren Schritt wird der Konstruktivismus als eine weitere Sichtweise vorgestellt und daraufhin mit der leibphänomenologischen Sicht verglichen. Am Ende soll dann in einem Fazit noch einmal auf die angesprochenen Sichtweisen eingegangen, diese kritisch reflektiert und die Meinung des Autors zum Ausdruck gebracht werden.
Bist du eigentlich behindert? Diese Frage könnten geneigte Rezipienten nun als Beleidigung auffassen. Schließlich ist eine Behinderung negativ konnotiert. Nicht selten wird eine Behinderung auch mit einer Krankheit verglichen. Ist jemand verärgert, wird der Begriff der Behinderung sogar wie oben beschrieben als eine Beleidigung eingesetzt.
Doch was steckt eigentlich hinter diesem Begriff der Behinderung? Wann kann man von einer Behinderung sprechen? Es gibt eine Vielzahl von Definitionen und doch gibt es nicht die eine Definition für Behinderung. Eine Sichtweise lautet wie folgt: „Der Mensch mit geistiger Behinderung wird als ein leiblich-soziales Wesen verstanden. Daher sind Behinderungen verstehbar als nicht-terminierbare, negative Abweichungen von generalisierten Wahrnehmungs- und Verhaltensanforderungen, die sich aus der Interaktion von körpergebundenen Relikten eines Schädigungsprozesses mit sozialen und außersozialen Lebensbedingungen ergeben.
Daher kann man sagen: auch wenn der Mensch durch äußere Bedingungen behindert ‚wird‘, so ist diese Sicht zu ergänzen durch ein ‚Behindertsein‘“. Diese Definition beschreibt den Begriff der Behinderung aus leibphänomenologischer Sicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 2. Hinführung: Probleme bei verschiedenen Definitionen in der Statistik
- 2.1 Der Mensch […] als ein leiblich-soziales Wesen
- 2.2. Behinderungen [sind] nicht-terminierbar
- 2.2.1 Exkurs: nicht-terminierbar als schwammiges Kriterium
- 2.3 Behinderungen [sind] negative Abweichungen
- 2.4 Abweichungen von generalisierten Wahrnehmungs- und Verhaltensanforderungen
- 2.5 Interaktion von körpergebundenen Relikten eines Schädigungsprozesses mit sozialen und außersozialen Lebensbedingungen
- 2.6 Der Mensch wird von außen behindert, ist aber auch selbst behindert.
- 3. Weitere Metatheorie: Der Konstruktivismus
- 4. Die Sichtweisen im Vergleich
- 4.1 Der Mensch […] als ein leiblich-soziales Wesen – ein Vergleich
- 4.2. Behinderungen [sind] nicht-terminierbar – ein Vergleich
- 4.3 Behinderungen [sind] negative Abweichungen – ein Vergleich
- 4.4 Abweichungen von generalisierten Wahrnehmungs- und Verhaltensanforderungen – ein Vergleich
- 4.5 Der Mensch wird von außen behindert, ist aber auch selbst behindert – ein Vergleich.
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem komplexen Begriff der Behinderung und analysiert zwei gegensätzliche Sichtweisen auf dieses Phänomen: die leibphänomenologische Perspektive und den Konstruktivismus. Ziel ist es, die beiden Ansätze darzustellen und in einem Vergleich ihrer zentralen Aussagen aufzuzeigen, wie sie den Begriff der Behinderung jeweils definieren und interpretieren. Dabei werden wichtige Aspekte wie die körperliche und soziale Dimension des Menschen, das Konzept der Nicht-Terminierbarkeit von Behinderungen, die Rolle von Abweichungen und die Interaktion von Schädigungen mit Lebensbedingungen beleuchtet.
- Die leibphänomenologische Sichtweise auf Behinderung
- Der Konstruktivismus als alternative Perspektive
- Vergleich der beiden Sichtweisen im Hinblick auf zentrale Definitionselemente
- Die Bedeutung des Körpers und der sozialen Umwelt für das Verständnis von Behinderung
- Kritische Reflexion und Meinung des Autors zur Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik der verschiedenen Definitionen von Behinderung und die Bedeutung eines einheitlichen Verständnisses heraus. Es wird eine leibphänomenologische Definition von Behinderung eingeführt, die im weiteren Verlauf detaillierter erläutert wird.
- 2. Hinführung: Probleme bei verschiedenen Definitionen in der Statistik: Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, die bei der statistischen Erfassung von Behinderung auftreten, da die Definitionen von Land zu Land stark variieren. Es wird die Notwendigkeit gemeinsamer Kriterien und einer einheitlicheren Sichtweise auf Behinderung betont.
- 2.1 Der Mensch […] als ein leiblich-soziales Wesen: Dieses Kapitel analysiert den Begriff des „leiblich-sozialen Wesens“ und die Bedeutung der Interaktion zwischen Körper, Geist und sozialer Umwelt für das Verständnis von Behinderung.
- 2.2. Behinderungen [sind] nicht-terminierbar: Der Abschnitt befasst sich mit dem Aspekt der Nicht-Terminierbarkeit von Behinderungen und betrachtet dessen Bedeutung im Kontext der leibphänomenologischen Definition.
- 2.3 Behinderungen [sind] negative Abweichungen: Das Kapitel untersucht die Rolle von negativen Abweichungen von generalisierten Wahrnehmungs- und Verhaltensanforderungen als ein weiteres Element der leibphänomenologischen Definition von Behinderung.
- 2.4 Abweichungen von generalisierten Wahrnehmungs- und Verhaltensanforderungen: Dieser Abschnitt analysiert die Beziehung zwischen generalisierten Wahrnehmungs- und Verhaltensanforderungen und dem Auftreten von Behinderungen im Rahmen der leibphänomenologischen Perspektive.
- 2.5 Interaktion von körpergebundenen Relikten eines Schädigungsprozesses mit sozialen und außersozialen Lebensbedingungen: Das Kapitel betrachtet die Interaktion von Schädigungsprozessen und sozialen und außersozialen Lebensbedingungen als einen wichtigen Faktor, der zur Entstehung von Behinderungen beiträgt.
- 2.6 Der Mensch wird von außen behindert, ist aber auch selbst behindert.: Dieser Abschnitt beleuchtet die komplexe Interaktion zwischen äußeren Einflüssen und dem „Selbst-Behindertsein“ als Teil der leibphänomenologischen Sichtweise.
- 3. Weitere Metatheorie: Der Konstruktivismus: Das Kapitel stellt den Konstruktivismus als eine alternative Perspektive auf Behinderung vor und skizziert seine wichtigsten Grundgedanken.
- 4. Die Sichtweisen im Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die leibphänomenologische Sichtweise mit dem Konstruktivismus und analysiert ihre unterschiedlichen Herangehensweisen an die Definition von Behinderung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Definition und Interpretation von Behinderung aus leibphänomenologischer und konstruktivistischer Perspektive. Schlüsselbegriffe sind daher „Leiblichkeit“, „soziales Wesen“, „Nicht-Terminierbarkeit“, „negative Abweichungen“, „generalisierte Wahrnehmungs- und Verhaltensanforderungen“, „Schädigungsprozesse“, „Interaktion“, „Lebensbedingungen“, „Konstruktivismus“, „Selbst-Behindertsein“ und „Vergleich“.
- Quote paper
- Marius Schmidt (Author), 2020, Behinderung aus einer leibphänomenologischen und konstruktivistischen Sicht. Ein Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1036745