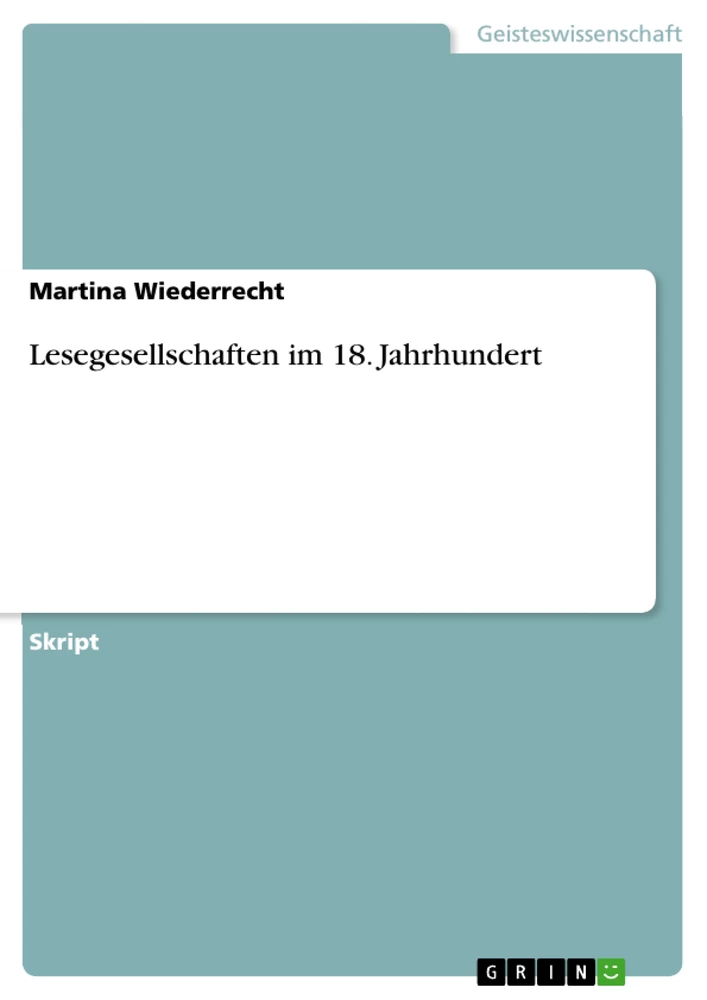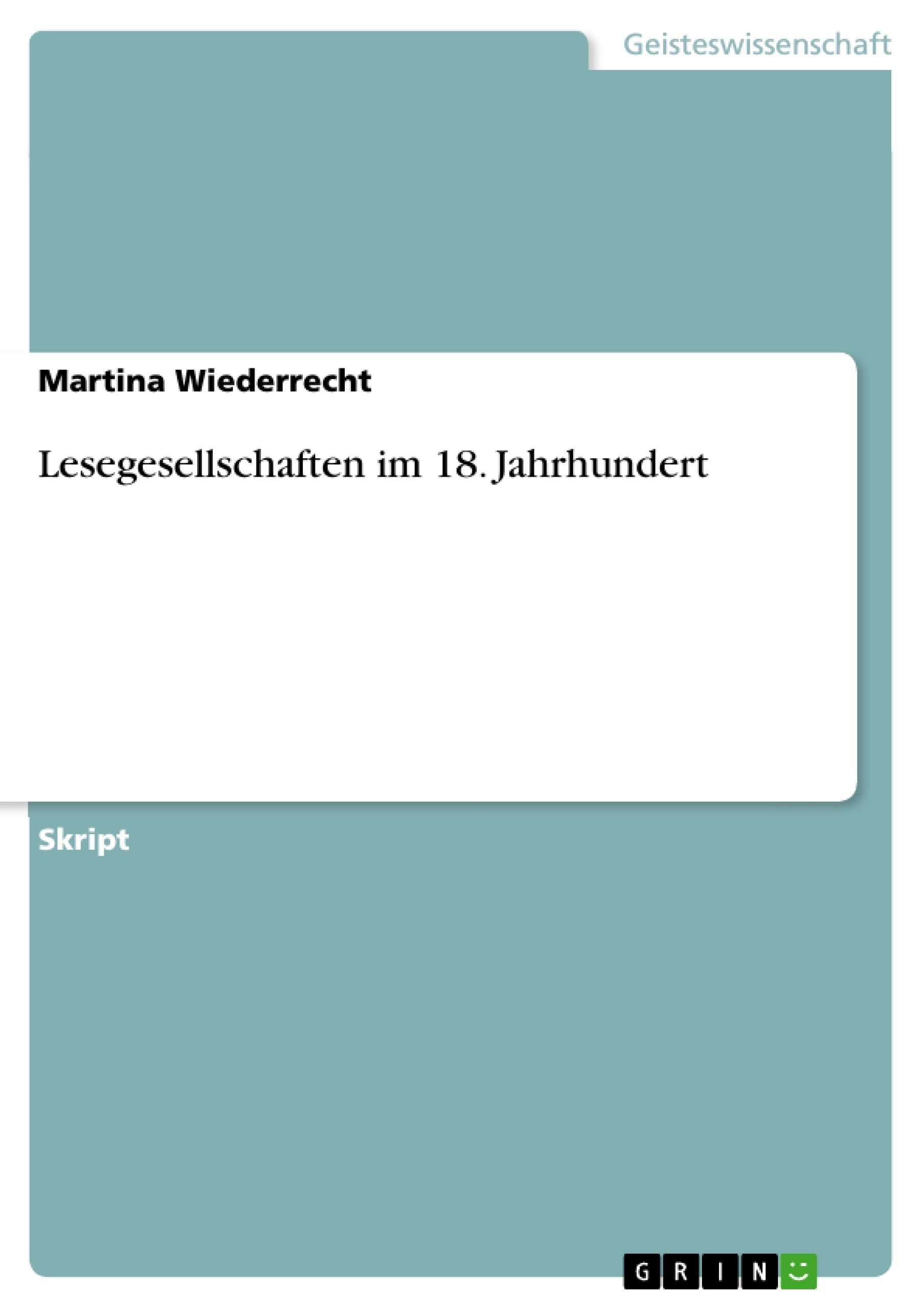Stellen Sie sich vor, das 18. Jahrhundert – eine Epoche des Umbruchs, in der das Flüstern der Aufklärung durch Lesesäle hallte und das gedruckte Wort zur Waffe des Geistes wurde. Diese fesselnde Studie entführt Sie in die verborgene Welt der Lesegesellschaften, jenen geheimen Zirkeln, in denen sich Bürgerliche, Gelehrte und Denker versammelten, um gemeinsam die neuesten Schriften zu verschlingen und über politische, wissenschaftliche und literarische Strömungen zu debattieren. Entdecken Sie, wie diese zunächst elitären Vereinigungen, von den bescheidenen Lesezirkeln bis zu den prächtigen Lesekabinetten, die Lesegewohnheiten revolutionierten und den Grundstein für eine neue, meinungsstarke Öffentlichkeit legten. Verfolgen Sie die Entwicklung der Lesegesellschaften von ihren Anfängen im aufgeklärten Norden bis zu ihrer Blütezeit in den 1780er und 1790er Jahren, und erleben Sie, wie sie zu Zentren des Wissensaustauschs, der politischen Meinungsbildung und der sozialen Interaktion wurden. Erfahren Sie, welche Rolle die Lesegesellschaften bei der Verbreitung der Aufklärungsideen spielten, wie sie die „Lesesucht“ beförderten und welche Zensurmaßnahmen der Staat ergriff, um ihre Macht einzudämmen. Analysiert werden die unterschiedlichen Typen von Lesegesellschaften, ihre Mitgliederstruktur, ihre Lektüreauswahl und ihre Statuten, sowie ihre Bedeutung für die Emanzipationsbestrebungen des Bürgertums. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Wandel der Lesegesellschaften im Laufe der Zeit, von ihren ursprünglichen Zielen der Wissensvermittlung und moralischen Bildung hin zu geselligen Clubs mit Schwerpunkt auf Unterhaltung und Vergnügen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Literatur des 18. Jahrhunderts, von gelehrten Zeitungen über politische Journale bis hin zu Unterhaltungsblättern und Romanen, und entdecken Sie, welche Werke in den Lesegesellschaften besonders beliebt waren und welche Rolle sie bei der Meinungsbildung spielten. Diese umfassende Untersuchung beleuchtet nicht nur die Geschichte der Lesegesellschaften, sondern auch ihre Bedeutung für die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, die Entstehung einer neuen Öffentlichkeit und die Verbreitung der Aufklärungsideen im Zeitalter der Revolutionen. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die Kultur- und Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts interessieren, für Literaturwissenschaftler, Historiker und alle, die mehr über die Wurzeln unserer modernen Gesellschaft erfahren möchten.
Lesegesellschaften im 18. Jahrhundert
Einleitung
- in der 2. Hälfte des 18. Jh. änderte sich die Rezeptionsweise vom intensiven zum extensiven Lesen
- Lg tauchten in der selben Zeit auf, gleichzeitig auch mit dem Anwachsen der Zeitschriften- und Buchproduktion und der Erweiterung des Lesepublikums über weitere Schichten
- es entstanden eigene Bibs der Lg, die - anders als die öffentlichen - nur diejenige Literatur sammelten, die von den Mitgliedern auch erwünscht war
- fast alle Lg waren ähnlich organisiert, deshalb darf man davon ausgehen, daß auch wenige untersuchte Lg repräsentativ sind
- es kam von Seiten des BH zu Kritik, da sie um einen breiteren Absatzmarkt fürchteten, andererseits kam es aber vielfach zur Zusammenarbeit zwischen BH und Lg, manche BH gründeten sogar eigene Lg
- es kam auch zu Publikationen speziell für Lg, weil Verleger und Autoren in ihnen einen eigenen Markt vermuteten
- auch der Staat sah in ihnen eine große Macht, so, daß sie oft zur Zielscheibe für Zensur wurden
- man darf trotz der Diskussion über „Lesewut“ und „Lesesucht“ nicht zu dem Schluß kommen, daß alle Schichten in gleichem Maße lasen, obwohl man einen Rückgang bzw. ein Hervortreten einzelner Literatursparten erkennen kann (allerdings lassen sich differenzierte Haltungen zu unterschiedlichen Literatursparten innerhalb der Gesellschaftsschichten erkennen)
- man muß die Lg unterscheiden: in der CH gab es vielfach konservative, traditionelle und ständische Lesegesellschaften, die vor allem antike Literatur anschafften und sich nicht mit dem Gedanken der Aufklärung beschäftigten; bei einigen Lg war aber dafür auch der Anteil der Romane und Unterhal- tungsschriften erheblich höher als in den D; in Zürich entstanden sogar Lg, die mit dem Gedanken der franz. Revolution sympathisierten
1. Geschichte und Typologie der Lesegesellschaften
1.1 Voraussetzungen für die Entstehung von Lesegesellschaften
- in Bremen entstanden in den 60ern einige Lg, deren Mitglieder die Bücher wöchentlich untereinander weitergaben und am Schluß der Kette versteigerten
- in der 2. Hälfte des 18. Jh. kam es zu einer enormen Steigerung der Buchproduktion, man muß bei der Hinzuziehung von Meßkatalogen allerdings Fehlerquellen (nicht erschienene Bücher ebenso wie Nachdrucke) zurechnen
- es kam zu einer Erweiterung der Leseschichten, das früher ein Privileg der Oberschicht war; man sprach von „Lesesucht“ oder „Lesewut“, die auch die Handwerker, Frauen usw. mit einschloß
- durch die schnelle Verbreitung von Neuigkeiten durch Zeitungen und Zeitschriften kam ein gesteigertes Bedürfnis nach aktueller Literatur auf, es kam zu einer Veränderung der Lesegewohnheiten (vom intensiven zu extensiven Lesen)
- durch diesen Wandel wurde es selbst Gelehrten (den eigentlichen Bücherkäufern) und relativ ver mögenden Leuten unmöglich, jedes Buch selbst anzuschaffen, das sie lesen wollten àBibs hatten nur ein eingeschränktes Angebot an gelehrter Literatur, ein schwaches Budget verhinderte weitere Anschaffungen, die schlechten Öffnungszeiten und die Tatsache, daß es sich um Präsenzbibs handelte, machte den Umgang nicht einfacher
- der Bedarf an Unterhaltungs-, popularwissenschaftlicher und schöngeistiger Literatur konnte auf keinen Fall von den öffentlichen Bibs gedeckt werden
- bei den Lg handelte es sich also um einen Zusammenschluß von Lesern, die durch gemeinsamen Erwerb von Büchern und Zeitschriften ihren Bedarf durch ein relativ geringes Budget zu decken versuchten („Für unsre Liebhaberei bleibt kein bequemeres Mittel als Lesegesellschaften, wo man durch die Menge der Mitglieder für einen kleinen Beytrag viel Bücher zu lesen bekommt.“)
1.2 Frühester Typ: Lesezirkel und seine Erweiterung zur Lesebibliothek
- die Vorläufer der Lg waren die Gemeinschaftsabonnements (bereits in der ersten Jh.-Hälfte)
- diese Abos entwickelten sich weiter zuLesezirkeln,die sich zuerst Lg nannten:
àd.h., in dieser Form der Lg wurden Zeitschriften und Bücher in bestimmten Abständen und bestimmter Reihenfolge weitergegeben; wenn man den Plan nicht einhielt, konnte es passieren, das Periodika nicht mehr aktuell waren
- die Weiterentwicklung der Lesezirkel waren dieLesebibliotheken, die sich ebenfalls Lg nannten
àsie besaßen im Gegensatz zu den Zirkeln eine Bibliothek, so daß das Herumtragen und Weiterreichen der Literatur entfiel, die Lektüre wurde je nach Interesse zu den Öffnungszeiten ausgewählt und mitgenommen (Vorteil: man bekam nur das, was man auch wirklich lesen wollte), Periodika las man aber ebenfalls in den Bibs angegliederten Zirkeln
1.2.1 Entwicklung und Verbreitung
- Lesebibliotheken und Lesezirkel sind die frühesten Erscheinungsformen der Lg, sie existieren seit ca.1750 in D
- der Begriff „Lesegesellschaft“ tauchte aber erst in den 70ern auf, wurde aber rückwirkend verwendet
- die ersten Lg gab es im aufgeklärten, protestantischen Norden
- ab den 70ern setzte eine breitere Entwicklung ein, mit einer Verzögerung von 10 Jahren auch im Süden
- Lg verband man mit Aufgeklärtheit und Geisteskultur
1.2.2 Mitgliederstruktur
- Mitglieder waren zumeist Angehörige des gehobenen und mittleren Bürgertums, die das Ideal hatten „Bildung durch Lektüre“ (unter Bürgertum sind v.a. Beamten der Verwaltung und Juristen zu verste- hen, Ärzte, Pfarrer, Offiziere und Professoren bis hin zum Dorflehrer und Schreiber zum Volk)
- der Handelsstand war nicht beigetreten, sie hatten aber bereits im Jahr 1781 ein „Colleg“, in dem sie auch Zeitungen und Zeitschriften hielten
- auf dem Lande und in kleineren Städten entstanden „Aufklärungs-Lg“, die von Akademikern geleitet wurden, an manchen Orten wurden die Bücher vorgelesen, weil die Bauern kaum oder nicht lesen konnten; diese Arten der Lg zählten zu den ersten Lg überhaupt
- in den Städten gab es solche Lg nicht, sie waren Vorrecht des Bildungsbürgertums àerst um 1800
taten sich die Handwerker zusammen, um nützliche Literatur zirkulieren zu lassen und trafen sich zum Singen und zu Vorlesungen
1.2.3 Lektüre
- in den Aufklärungs-Lg befanden sich vor allem Kalender, moralische Romane, Almanache, religiöse Erbauungsschriften, Reisebeschreibungen...
- da Lg nur überleben konnten, wenn ihre Literatur auf Interesse bei den Mitgliedern stieß, Kauf wurde meist durch Mehrheitsbeschluß bestimmt
- diese Methode unterschied die Lg besonders von gewerblichen Leihbibs und Lesezirkeln, die v.a. in den unteren Schichten der Stadtbevölkerung ihr Publikum fanden, das nicht die Motivation hatte, eine eigene Lg zu gründen
- zu Romanen läßt sich nichts Allgemeingültiges sagen; einige Lg hatten überwiegend andere keine Romane
- zur Zeit der franz. Revolution nimmt das Interesse an zeitpolitischer Literatur zu
- gegen Ende des Jh. treten in zunehmenden Maße Fach-Lg auf, deren Mitglieder Fachleute der jeweiligen Disziplinen waren
1.3 Neuer Typ: Lesekabinett
1.3.1 Charakterisierung und Unterschiede zum Lesezirkel
- in ländlichen Gegenden gab es nur Lesezirkel und Lesebibs, andere Formen waren nicht praktikabel
- in größeren Städten kam eine neue Organisationsform auf: die Lg mieteten sich eigene Räume
àLesekabinette entstanden ( in Paris gab es eine solche Form angeblich bereits zu Beginn des 18. Jh.)
- manche Gemeinschaftsabos entwickelten sich über einen Zirkel zu einer Bib zu einem Kabinett
- das Lesekabinett mietete sich eigene Häuser, in denen die Mitglieder lesen, diskutieren und wissenschaftlich arbeiten konnten àdiese Erscheinungsform der Lg nannte sich „Lesegesellschaft“ oder „Lesezimmer“, der Begriff des „Lesekabinetts“ trat erst 1788 in Nürnberg auf
- sie hatten den Vorteil, daß man nicht nur las, sondern über das Gelesene sprechen konnte, man einen Versammlungsort hatte und Zeitschriften nicht durch große Verzögerungen veralteten oder ganz verschwanden
- diese Form sprach vor allem das gebildete Bürgertum an, die unteren Schichten begnügten sich mit der Lektüre
- zeitgleich mit der deutschen Leserevolution kam es in England zur industriellen und AußenhandelsRevolution und in Frankreich zur politischen Revolution
- Lesekabinette dienten dem Meinungsaustausch und der Bildung einer eigenen Meinung, eines festen Standpunktes àfrühe „Publikumsinstitutionen“
- die ersten Lesekabinette entstanden zu Beginn des letzten Viertels des 18. Jh., sie beschränkten sich aber auf größere Städte, da nur dort das bildungsorientierte Bürgertum ansässig war
- die Zahl der Lesekabinette ebenso wie die der übrigen Lg stieg in den 80ern
- man muß bei den Lesekabinetten auch die unterschiedlichen Besitzverhältnisse im Gegensatz zu den anderen Formen der Lg beachten: bei den angeschafften Büchern handelte es sich um gemeinsamen Besitz, auf die Ausstattung der Gemeinschaftsräume wurde größter Wert gelegt, in reichen Lesekabinetten wurde evtl. sogar ein Haus auf Aktienbasis der Mitglieder gekauft
1.3.2 Hintergrund für die Entstehung von Lesekabinetten, aufgezeigt am Beispiel der rheinländischen Gesellschaften
- Lesekabinette entstanden überall dort, wo das Bürgertum wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegswil- len zeigte
- das rheinländische Gebiet wurde von der erst relativ spät auftretenden Aufklärung (2. Hälfte des 18. Jh.) und französischen Aufklärung beeinflußt, es herrschte noch lange Zeit eine mittelalterliche Stän- deordnung
- die Aufklärungsbewegung zog 1770 eine breit angelegte Schul- und Unireform nach sich; Volksbildung und Aufklärung wurden als Staatsaufgabe angesehen
- Versuche von Steigentesch, einem Herausgeber einer Zeitschrift, versuchte vergeblich, dem Volk den Sinn von Lg nahezubringen; eine so weitgreifende Veränderung mußte von oben erfolgen
- am 1.1.1782 eröffnete die Mainzer Lesegesellschaft mit Genehmigung des Kurfürsten; es gab einen Vertrag mit dem Ffm BH Hermann, der sich bereit erklärte, bestimmte Literatur zur Verfügung zu stellen, wenn die Gesellschaft jährlich für mindestens 300 Reichstaler Bücher und Monatsschriften bei ihm kaufte
- der Kurfürst untersagte der Mainzer Lg das Treffen in ihren Räumen für Spielgesellschaften, Freimaurerei oder „Caffé-Haus und öffentlichen Billard“ zu mißbrauchen
- bei den Mainzern gab es Unstimmigkeiten bei der Namenswahl, man einigte sich schließlich auf „gelehrte Lesegesellschaft“, was die Intention verdeutlichte, wissenschaftliche, politische und literarische Themen zu vertreten
- obwohl durchaus Publikationen angedacht waren, beschränkte sich die Lg im wesentlichen auf die Rezeption
- die Lg erfreute sich sehr bald einer großen Beliebtheit und Ansehen: am Ende des ersten Jahres zählte sie 161 Mitglieder; es kam auch zu keiner negativen Kritik
- die Mainzer Lg war die erste rheinländische Lg, ihrem Beispiel folgten aber etliche
- in Ffm gründete am 1.11.1788 ein BH eine Lesegesellschaft, die täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet
hatte und etwa 100 gelehrte und politische Zeitungen und Journale in D, F, I, GB anbot; Fremde durften durch Einführung eines Mitglieds die Lg kostenlos nutzen
1.3.3 Statuten
- buchhändlerische Museen hatten keine geschlossene gesellschaftliche Form, keine aufklärerischen Tendenzen und keine „Gesetze“, wie es bei den bürgerlichen Lg üblich war
- die Statuten der einzelnen Lg waren inhaltlich ähnlich; sie beinhalteten Gleichberechtigung und Mitbestimmung der Mitglieder und unterstützten so ein demokratisches Prinzip, das es in der politischen Realität noch nicht gab
- Verfassung, Gesetze und die Neuaufnahme von Mitgliedern wurde gemeinsam ausgearbeitet, bzw. beschlossen (Mehrheitsbeschluß)
- die Auswahl des Lesestoffes erfolgte durch alle Mitglieder oder, wenn es zu viele waren, durch ein Gremium, auf das die Mitglieder aber durch ein Desiderienbuch oder mündliche Äußerungen in den Versammlungen Einfluß nehmen konnten
1.3.4 Mitgliederstruktur
- die Mitglieder der Lesekabinette setzten sich aus den gleichen Schichten zusammen wie die der Lesezirkel àgelehrte und gebildete Kreise, die nach Aufklärung strebten
- die Aufnahme neuer Mitglieder wurde durch Aushang bekanntgegeben, erfolgten Einwände wurde bei einer Versammlung durch „Kugelung“ oder „Ballotage“ abgestimmt (geheime Wahl mit weißen Jaund schwarzen Nein-Kugeln)
- nur selten - z.B. in der Aschaffenburger Lg wurde festgelegt, wer aufgenommen werden konnte
- normalerweise fielen innerhalb der Gesellschaft die in der Realität noch existierenden ständischen Schranken weg
- ausgeschlossen aus generell allen Lesekabinetten waren Frauen und Studis
- Frauen mußten sich auf familiäre Schranken beschränken, sie konnten aber an Zirkeln teilnehmen, die nicht in die Öffentlichkeit gingen
- die Lesegesellschaften werden generell als emanzipatorische Einrichtungen in kultureller, sozialer und politischer Form gesehen
- auffällig ist, daß Lesekabinette nicht in Reichsstädten, die mehr Einfluß auf Politik hatten, gab; dort ging die Initiative nur von den BH aus, die auf ihren eigenen finanziellen Vorteil bedacht waren
- die Emanzipationsbestrebungen waren also zuerst kulturell in den Lg vorhanden, bevor sie in der Politik verwirklicht werden, sie bereiteten aber den Boden für die spätere Parteienbildung
1.4 Bedeutung und Aufgaben der Lesegesellschaften in der Gesellschaft des späten 18. Jahrhunderts
- in den 80ern gab es kaum noch eine Stadt, die keine Lg hatte, sie hatten sich zu bekannten und selbstverständlichen Einrichtungen entwickelt
- vermutlich gab es mehr Lg als wir heute belegen können
- in den 70ern breiteten sich die Lg vorwiegend (ähnlich wie auch in der Literatur allgemein) im protestantischen Norden (Sachsen, Preußen) aus, Süddeutschland folgte etwas später
- die Blütezeit der Lg lag in den 90ern des 18. Jh., ab der Jahrhundertwende lassen sich weniger
Neugründungen verzeichnen, bis 1820 nahmen diese noch weiter ab àGründe hierfür könnten in den Zensurbestimmungen liegen; außerdem wurden Zeitschriften und Bücher durch neue technische Möglichkeiten immer billiger; die gewerblichen Leihbibliotheken breiteten sich immer weiter aus, da sie rentabler arbeiten konnten, es wurden neue öffentliche Bibs gegründet oder schon bestehende der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
- das Vereinswesen dieser Zeit befand sich insgesamt im Wandel, hin zur Geselligkeit; bei den Lese- kabinetten setzte sich der Hang zur Unterhaltung so weit durch, daß sie zwar einige Standardwerke und Zeitschriftenabos behielten, sich ansonsten aber auf Spiele, Tanz und andere Geselligkeiten be- schränkten
- Lesezirkel und -Bibs lebten oftmals in Fachlesegesellschaften weiter
1.4.1 Literaturvermittlung
- in der 2. Hälfte des 18. Jh. fand das Lesen Einzug auch in breiter Bevölkerungsschichten, diese Entwicklung wurde v.a. durch die Zeitschriften gefördert, was gleichzeitig Einfluß auf den Wechsel vom intensiven zum extensiven Lesen hatte
- Beiträge der Lesezirkeln waren an das Vermögen der Mitglieder angepaßt (2-6 Reichstaler, das entspricht in etwa einem Zeitschriftenabo); die Beiträge der Lesekabinette betrugen - je nach Ausstattung zwischen 4 und 8 Reichstaler
- für diese Beiträge wurde ein breites Lektüreangebot gemacht, die Zirkel unterhielten meist ebenso
viele Abos wie sie Mitglieder hatten (15-20), bei Bücherzirkeln gab es soviel Angebot, daß das einzelne Mitglied alle 7-14 Tage ein neues Buch bekam àdiese regelmäßige Literaturversorgung unterstützte die Gewohnheit zu lesen
- die höheren Kosten der Lesekabinette und -Bibs wurden durch höhere Beiträge und eine höhere Mitgliederzahl ausgeglichen (60-150)
- Lg waren für viele Menschen (Bürgertum) leicht zugänglich, außer bei den Lesekabinetten gab es normalerweise keine Aufnahmebeschränkung
- Lesekabinette boten Fremden eine kostenlose Nutzung für die Dauer ihres Aufenthalts an, sofern sie von einem Mitglied eingeführt wurden àes kam hin und wieder zu Mißbrauch durch ansässige Gast- wirte, die ihre eigene Mitgliedschaft nur dazu benutzten, ihren Gästen diesen kostenlosen Service zu bieten
- um zu verdeutlichen, welchen Stellenwert die Lg hatten, muß klar gemacht werden, daß sie die einzige finanziell mögliche Variante zum Kauf der Bücher und Zeitschriften war; Bibliotheken hatten nicht die gewünschte Literatur, außerdem waren sie oft nicht öffentlich oder hatten schlechte Öffnungszeiten; ein Abo einer allgemeinwissenschaftlichen Zeitschrift kostete in etwa so viel wie die Mitgliedschaft bei einer Lg, die unverhältnismäßig mehr Vorteile brachte
1.4.2 Übernahme der Bildungsbestrebungen der Aufklärung
- Lg und Bildungsreformen lagen zeitlich oft genau übereinander
- diese neuen Bildungsbestrebungen kamen aber v.a. den Jugendlichen und Kindern zugute; die Erwachsenen profitierten meist nur über Lg oder Aufklärungsgesellschaften daran
- die allgemeinen Lg vermittelten meist nur weitere Kenntnisse und dienten somit der Weiterbildung
- der Begriff der Bildung schloß neben der Wissensvermittlung auch die gesamte Herzens- und Geistesbildung (ganzheitliche Bildung) mit ein
- die Ziele der Lg waren: „Beförderungen der Wissenschaften und des guten Geschmacks“
- die Mitglieder wurden gesehen als: „gute moralische und vernünftige Menschen“, „Freunde und Förderer des Wahren und Guten und Schönen“, Männer mit „wissenschaftlichen Kenntnissen und gutem moralischem Karakter“
- die Bürger und Lg förderten eher die Allgemeinbildung, man verlangte ein breites Spektrum, ging aber bei keinem Thema in die Tiefe àTradition der moralischen Wochenschriften
- die 2. Hälfte des 18. Jh. ist auch die Zeit der Lexika, Enzyklopädien und populärwissenschaftlichen Schriften
- Ende des Jh. kam es zu einer Verselbständigung einzelner wissenschaftlicher Fachbereiche, es gab vermehrt Fachliteratur (sowohl im Zeitschriften als auch im Buchbereich) und die Fach-Lg (da auch in diesem Fall die Leihbibs nicht die gewünschte Literatur anbieten konnte) entstanden
- bei der allgemeinen Lektüre steht vor allem bei der Anschaffung der Werke die Nützlichkeit der Wissenschaft im Vordergrund, so wie während der Aufklärung generell
- in den Lesegesellschaften kommt zu einem Aufbrechen der alten ständischen Ordnung; die Mitglie- der befreien sich aus ihrer Unmündigkeit, aber nicht mehr als Individuum, sondern als Teil der Ge- meinschaft
- Lesekabinette boten neben Nachschlagewerken, Atlanten, Wörterbüchern im Präsenzbestand, Bü- cher, Zeitschriften und mit Schreibmaterialien auch die Möglichkeit der intensiven Lektüre und des Studiums; außerdem besaßen sie den Vorteil ggü. den anderen Arten der Lg, daß die Mitglieder den direkten Kontakt zueinander hatten, was zur „wechselseitigen Aufklärung" führen sollte, außerdem legte man Wert auf Geschmacksbildung, Gespräche und Austausch über das Gelesene
1.4.3 Der gemeinschaftsbildende Faktor der Lesekabinette
- diese Möglichkeit des Austausch könnte auch eine Erklärung für die weite und rasche Ausbreitung der Lesekabinette gewesen sein
- man lobte an den Lg allgemein, daß sie die Sitten und den guten Geschmack schulten, Literatur und Wissenschaft vermittelten, was man als Gewinn für das gesellschaftliche Leben empfand
- die idealistisch-auflärerische Programmatik der Lg führte vermutlich auch zu dem engen Kontakt und zur Gemeinschaft, die viele Lg auch über ihre Blütezeit hinaus bestehen ließ, denn gegen Ende des Jh. nahm das Hauptinteresse, die gemeinschaftliche Literaturversorgung ab
- es entstanden, obwohl die Zeit der Lesegesellschaften im eigentlichen Sinne vorbei war, immer wei- ter noch Lg, deren Hauptinteresse allerdings in der „Geselligkeit“ und dem „gesellschaftlichen Vergnü- gen“ bestand
- dennoch versuchte man, die Erkenntnisse der Aufklärung und das demokratische Gefüge der Lg weiter auch in der Öffentlichkeit umzusetzen
- zu Beginn des 19. Jh. erhalten dann auch endlich Frauen die Möglichkeit, als ordentliche Mitglieder in den „neuen“ Lg aufgenommen zu werden
2 Der Umkreis der Literatur in den Lektürebeständen der Lesegesellschaften
- die Lg sind als Literaturvermittler zwischen den Lesern und Literatur zu verstehen, die Kommunikation zwischen Leser und Literatur wird untersucht
- beim „Leser“ handelt es sich ausschließlich um den Leser des Bürgertums, der auch das Publikum der Lg stellte
2.1 Periodische Literatur
- im 18. Jh. verstand man unter „Literatur“ alles Gedruckte, Schriften jeglicher Art
- infolge des überwiegenden Interesses der Lg-Mitglieder an neuester Literatur, wurden v.a. Zeitschriften abonniert, sie waren in fast allen Lg anzutreffen
- eine Unterscheidung der Begriffe „Journal“, „Zeitung“ und „Zeitschrift“ bestand zu dieser Zeit noch nicht, weder inhaltlich noch begrifflich
- am häufigsten gab es in den Lg „Politische Journale“ und „Gelehrte Zeitungen“, diese beiden Gattungen werden auch in den Registern der Lg einzeln aufgeführt, auch dann, wenn diese normalerweise die Periodika nicht getrennt voneinander notierten
2.1.1 Gelehrte Zeitungen
- unter gelehrten versteht man allgemeinwissenschaftliche Zeitungen; sie behandeln alle Wissensgebiete (daran merkt man das polyhistorische Bildungsideal des 18. Jh.)
- obwohl in der 2. Hälfte des Jh. eine zunehmende Spezialisierung der Wissensgebiete zu verzeichnen ist, kann man diese Entwicklung bei den Lg nicht beobachten
- die beliebteste Zeitschrift war das RezensionsmagazinJenaer„Allgemeine Literatur-Zeitung“(1785- 1803), die in 26 der 31 untersuchten Lg abonniert worden war àALZ
- Nicolais ADB (Allgemeine Deutsche Bibliothek) richtete sich nur an ein Fachpublikum, das könnte die wenigen Abos erklären
- die Rezensionsorgane halfen oft auch bei der Wahl der Monographien, die die Lg anschaffen wollte
- fast ebenso beliebt wie die ALZ war dieBerlinische Monatsschrift(1783-1796), die zu den allge meinwissenschaftlichen Zeitungen zählte; sie richtete sich an eine gebildete Leserschicht und enthielt, belehrende, gelehrte Aufsätze aus allen Wissensgebieten
- mit der Französischen Revolution taucht das Interesse an der aktuellen Zeitgeschichte auf, das in allen Lg berücksichtigt und bevorzugt behandelt wurde
2.1.2 Historisch-Politische Periodika
- die Zahl der Periodika, die aktuelle politische und kulturelle Ereignisse zum Thema hatten, mehrten sich, am häufigsten wurde von den Lg die „Minerva“ (Berlin, Hamburg 1792-1857) abonniert
- die Auswahl der politischen Zeitschriften war nicht inhaltlich, sondern durch die publizistische Gestaltung motiviert, ansonsten wäre man wohl auch innerhalb der Lg zu keiner Einigung gekommen
- die Zensurmaßnahmen taten ihr übriges; sie waren der Grund dafür, daß nur sehr wenige revolutionsfreundliche Blätter abonniert werden konnten
- dennoch war der „Staats-Anzeiger“ (Göttingen 1782-1795) die am meisten abonnierte Zeitung; sie hatte den anderen voraus, daß die Göttinger Professoren bei ihren Veröffentlichungen Pressefreiheit gewährt bekamen; die Zeitung bekämpfte Mißstände und forderte Reformen
- in den erhaltenen Verzeichnissen der Lg finden sich ca. 140 Titel mit insgesamt ca. 350 Nennungen, teils sind es regionale Zeitungen, die neben Nachrichten auch praktische Tips gaben und belehrende Aufsätze enthielten
2.1.3 Organe der schönen Wissenschaften und Künste
- 1/5 der Schriften waren allgemeinwissenschaftlich, ¼ historisch-politisch der rund 500 vorkommenden Titel, 1/10 waren literarische Zeitschriften
- die beliebteste Zeitschrift war Wielands „DeutscherMerkur“ (1773-1810), das sich an ein „mittelmä- ßiges“ Publikum wandte und einen möglichst großen Leserkreis zu erreichen suchte; sie war gezeich- net von popularisierten, zweitrangigen Publikationen, die Literaturkritik war unter aller Würde; nach der Französischen Revolution gewinnen auch bei Wieland die politischen Ereignisse an Bedeutung; den noch hatte die Zeitschrift enormen Einfluß bei der Frage der „toleranten Geschmackserziehung“ und der Vermittlung „humorvoller Weisheit“
- fast die gleiche Verbreitung fand das „Deutsche Museum“ (ab 1776) von Dohm und Boie, sie wurde aber nach kürzerer Erscheinungszeit wieder eingestellt, daher erklärt sich die geringere Zahl der Abos
- das gleiche gilt für die „Deutsche Monatsschrift“ (1790-1799) , die von der Literarischen Gesellschaft in Halberstadt herausgegeben wurde
- zwischen 1795n und 1800 erschien das„Berlinische Archiv der Zeit und ihres Geschmacks“
- diese Periodika waren auf das gebildete Bürgertum zugeschnitten, ihr Ziel war die Vermittlung der schöngeistigen Literatur; man könnte sie auch zu den gehobenen Unterhaltungsschriften zählen
- Schillers „Thalia“ (1787, 1789 und 1791 je 1 Band, „NeueThalia“ 1792-93 in 12 Heften) und „Horen“ (1795-1797) fanden wenig Anklang, sie hatten einen zu hohen Anspruch
2.1.4 Unterhaltungsblätter
- zu dieser Gattung gehören ca. 1/12 der periodischen Literatur aus, hinzu kommen einige Frauenzeitschriften
- sie wollten unterhalten und belehren, „ohne den Geist allzusehr anzustrengen“; ihre Themen beinhal- ten alles, was zum Leben gehört: Haushalt, Mode, Schmuck, Hygiene, Kinder, fremde Länder, Politik, Kultur...
- literarische Beiträge waren zumeist ohne künstlerischen Wert oder Anspruch
- eine der erfolgreichsten Zeitschriften dieser Art war „Journal des Luxus und der Moden“, die Friedrich Justin Bertuch ab 1786 in Weimar herausgab (Wieland gab eine vernichtende Kritik ab, was ihrer Beliebtheit aber keinen Schaden zufügen konnte)
- in die Gruppe der Unterhaltungsschriften gehören auch die moralischen Wochenschriften, die noch immer in beträchtlicher Zahl vorhanden waren, allerdings selten langlebig waren und auch immer mehr an Bedeutung verloren, da sie sich den politischen Themen nicht öffneten
2.1.5 Fachwissenschaftliche Zeitschriften
- man kann die Periodika der Lg in 3 große Gruppen gliedern:
1. die Hälfte waren Schriften mit den Hauptzwecken: Allgemeinbildung, Belehrung und politische Information (allgemeinwissenschaftliche und historisch-politische)
2. etwa 1/5 der Periodika waren Schriften der gehobenen und leichten Unterhaltung (LiteraturMusik-, Theater-, Kunst-Zeitschriften und Unterhaltungsblätter)
3. den Rest nehmen wissenschaftliche Fachorgane ein, diese dritte Gruppe gliedert sich in verschiedene Einzeldisziplinen, v.a. Theologie und Wirtschaftswissenschaften
- gerade auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften wurden in der 2. Hälfte des 18. Jh. sehr viele neue Zeitschriften herausgegeben, da sich neben den Beamten auch die Kaufleute und viele Bürger dafür interessierten; sie stellten auch neue Produkte und „Modeartikel“ vor
- der Anteil anderer Fachblätter ist verschwindend gering, es handelt sich hierbei um: historische und geographische Blätter, naturwissenschaftliche, medizinische, juristische, philosophische, pädagogische und land- und forstwirtschaftliche Schriften
2.2 Bücher
- zu Beginn der Lg gab es vielfach nur Periodika
- auch die Buchbestände lassen sich in 3 Gruppen teilen:
1. bürgerliche Bildungslektüre mit den Hauptzwecken: Allgemeinbildung, moralische Aufklärung, politische Information
2. wissenschaftliche Fachliteratur
3. Literatur zur „Verschönerung der Mußestunden“: Dichtung, leichtere Unterhaltungslektüre
- in fast allen Lg waren diese 3 Gruppen vorhanden, nur große Städte, die mehrere Lg hatten, konnten es sich leisten nur eine der Arten zu haben, da sich die Mitglieder nach dem Literaturangebot richten konnten
- wenn in Lg in kleineren Städten ein Übergewicht an bestimmter Literatur auffällt, findet sich die Er- klärung dazu entweder beim Lesepublikum oder beim Verantwortlichen für Literaturkauf (Superinten- dent)
2.2.1 Pragmatische Literatur (bürgerliche Bildungslektüre, wissenschaftliche Fachlite- ratur)
- das Buch wird als Wissensvermittler und Informationsquelle betrachtet, es gibt Einblick in politische Verhältnisse und Probleme
- Nachschlagewerke, die natürlich nur in den Lesebibliotheken und v.a. in den Lesekabinetten vorhanden sind, bilden den Grundstock der Standardwerke im Präsenzbestand; dazu gehören: Universallexika, Enzyklopädien, Zeitungs- und Konversationslexika, AD Bibliographie...
- wichtig für die Allgemeinbildung waren v.a. Geschichte und Geographie, was den Grundstock für das Verstehen der Biographien und Reisebeschreibungen war
- bei den Lesern gab es ein großes Interesse am Weltgeschehen, an der Kolonialpolitik, Reisen, frem- den Ländern und Völkern... àin Lesekabinetten fanden sich also zumeist auch Atlanten und Landkar- ten
- besonders stark vertreten waren zeitpolitische Ereignisse, v.a. die Französische Revolution, zu der es eine Vielzahl von Schriften gab
- die Zensurmaßnahmen, die 1789 verstärkt wurden, stellten auch die Lg unter ihre Aufsicht, das läßt die eingeschränkte Auswahl zum Thema Franz. Rev. erklären
- die einzigen Ereignisse, die noch größeres Interesse hervorriefen waren der amerikanischen Befreiungskampf 1775-82
- außerdem wurden die Kolonialpolitik und die Machtverteilung in Europa behandelt
- die hist. Lektüre der Lg bestand in den meisten Fällen zu 1/3 aus Briefberichten und Biographien
- die Geographie war zu 75-100% (ca. 80%) durch Reisebeschreibungen gedeckt, die spannend geschrieben sein sollten, so daß der Leser mitfiebern konnte; außerdem wurden sie von allen Monographien am häufigsten verlangt
- die restlichen 20% der geographischen Literatur bestand aus wissenschaftlich ausgerichteten Werken: geographisch-statistische Beschreibungen und völkerkundliche Arbeiten
- in den Aufklärungs-Lesegesellschaften gab es natürlich v.a. Werke über die aufklärerisch-moralische Bildung, religiös-moralische Belehrungen, populär-theologische Literatur, aber auch andere Lg besa- ßen religiöse Erbauungsbücher, aber hauptsächlich wurden aufklärerisch-moralische Schriften gele- sen
- popularphilosophische Schriften lösten die Erbauungsliteratur ab
- moralische Belehrungen holten sich die Leser v.a. aus der Trivialliteratur
- es zeigte sich auch ein starkes Interesse an Gewerbe und Wirtschaft, was auf die Berufsbezogenheit und den praktischen Nutzen schließen läßt, den die Leser dieser Zeit in ihrer Lektüre gesucht haben
- es gab auch ein gewisse Anzahl hauswirtschaftliche Bücher und „wissenschaftliche Literatur“ (v.a. in den Hauptwissensgebieten Geographie und Geschichte), die sich aber sprachlich und stilistisch nicht an den Studierten oder Fachmann richten sollte
- Wissenschaft, die nicht praktisch anwendbar war, hatte keinen praktischen Nutzen und wurde daher nicht beachtet
- viele Lg lehnten die Fachliteratur der sog. „Brotstudien“ (Theologie, Jurisprudenz und Medizin) als zu speziell ab, sie waren nicht von allgemeinen Interesse (àman bot in Lesegesellschaften ja der bürgerlichen Schicht Bücher an, nicht unbedingt nur den Studierten)
- die theologischen Werke nahmen - außer in den religiös-aufklärerischen Lg - einen verschwindend kleinen Anteil an der Gesamt-Bücherzahl ein: davon waren es in der Mehrzahl Biographien, moralisch-theologische Schriften und Predigtbücher oder Werke über die Kirchengeschichte
- einen noch geringeren Anteil hatten die juristischen Bücher, wenn bezogen sie sich auf angewandte Jurisprudenz, Gesetzestexte und besondere Fälle der Rechtsprechung
- der Anteil der medizinischen Bücher ist kaum erwähnenswert, wenn sie vorhanden sind, beschäftigen sie sich mit allgemein interessanten Fragen (Tod, Vertilgung von Blattern)
- sogar die Philosophen fanden nur Beachtung, wenn sie in popularisierter Form schrieben oder ihre Werke zeitgenössisch diskutiert wurden (Mendelssohn, Jacobi, Fichte), selbst Kant und Wolff sind in den Lg nicht anzutreffen
- obwohl in der Zeit der Lg sehr viele pädagogische Bestrebungen zu erkennen waren, nahm dieses
Thema keinen Platz in den Lg ein; sie beschäftigten sich auch hauptsächlich mit den Verbesserungen des Schulwesens, das auf mehr Praxisbezug ausgelegt werden sollte
2.2.2 „Schöne Literatur“
- unter schöner Literatur versteht man die Belletristik (Dichtung und leichte Unterhaltung), die aber ursprünglich nicht als zweckfreie Dichtung erkannt wird; da kein Gewinn für Herz und Kopf zu erkennen ist, wird sie oft abgelehnt
- sie forderte also eine neue Art Leser, die der Freizeitlektüre geneigt waren, da sie den Triebkräften der bürgerlichen Emanzipation und Aufklärung nicht mehr entgegenkam àkein Bezug mehr zum All- tag
- erst später, als die Geselligkeit mehr Beachtung fand, zunehmend auch Frauen in die Lg aufgenommen wurden, fand sich auch die schöne Literatur in den Lektürebeständen
- Unterhaltung ohne praktischen Nutzen wurde als „Zeit töten“ gesehen und als „Hochverrath an der Menschheit“ verurteilt
- Erbauung und Belehrung konnten allerdings sehr gut im Roman verarbeitet werden, der unter ande- rem auch unterhaltsam war; daher besteht der größte Teil der „schönen Literatur“ in den Lg aus Ro- manen
- Autoren waren u.a.:
um 1800 erreichte August Lafontaine (1758-1831) den Höhepunkt seines Ruhmes: seine
Themen entsprachen denen der moralischen Wochenschriften (Stellung der Frau, Beziehung Mann - Frau, häusliche Probleme...), was mit dem aktuellen Gesprächsstoff deckungsgleich war in den 90ern wurde Karl Gottlob Cramer (1758-1817) verbreitet, der eigentlich Forstrat und Lehrer war: seine Helden verkörperten das bürgerliche Zeitidol, seine Werke formal und inhaltlich anspruchslos, dafür war er sehr erfolgreich
Johann Gottwerth Müller (1743-1828), dessen Beruf BH war und der auch an moralischen Wochenschriften mitarbeitete, schrieb humoristische Romane, in denen er Kritik an seinen Zeitgenossen übte
August Gottlieb Meißner (1735-1807) war Jurist und Schuldirektor, seine Werke wurden von Schmieder (Nachdrucker) in der „Sammlung der besten deutschen prosaischen Schriftsteller und Dichter“ aufgenommen; sie handelten als moralische Erzählungen von Selbstlosigkeit,
Edelsinn und Großmut; die meisten seiner Romane verarbeiteten einen historischen Stoff
- der Trivialroman erschien meist anonym, da er kein großes Ansehen mit sich brachte; außerdem identifizierten sich die Autoren mit den Titeln der Werke und warben auch mit diesen
- erwiesenermaßen merkten sich die Leser auch eher den Titel als den Namen des Autors, in den Verzeichnissen der Lg erschienen die Bücher der Unterhaltungsliteratur immer unter dem Titel, auch wenn der Name des Autors bekannt war
- die Romane der Zeit sollten realistisch sein, Phantasieprodukte hatten keine Chance; die Romane waren mit hilfreichen abschreckenden Beispielen und vorbildlichen Charakteren angereichert, so daß eine Identifikation leicht viel
- zu den anspruchsvolleren Romanen gehörten die von Johann Jakob Dusch (1725-1787), Professor der schönen Wissenschaften und der englischen Literatur; leider konnte er nur geringes Interesse hervorrufen
- Johann Timotheus Hermes dagegen war ein Erfolgsautor (1738-1821); eigentlich war er Oberkonsi- storialrat und Professor der ev. Theologie, sein Hauptwerk „Sophiens Reise von Memel nach Sach- sen“ wurde zu einem der meistgelesenen Werke des Jh.; inspiriert wurde er vom Engländer Richard- son (s. Mädchenbuch); in einem Briefroman prangerte er das „süße Leben“ in Berlin an, dem sich die Reichen hingaben, er wird mißverstanden: sein Werk wird als „Anleitung zur moralischen Abkehr“ angeprangert
- eine der berühmtesten Schriftstellerinnen war Benedikte Naubert (1756-1819), die ihre historischen Forschungsergebnisse in über 50 Romane kleidete
- obwohl wenig schöne Literatur in den Lesegesellschaften vertreten war, gehörte Wieland noch zu den am meisten vertretenen und auch gelesenen, auch Georg Christoph Lichtenberg wurde geschätzt
- noch seltener gab es lyrische Werke in den Lg, etwas häufiger gab es aber Dramen, die dem Unterhaltungsbedürfnis der Zeit entsprachen
- sehr begehrt waren auch die Werke Von August von Kotzebue, er konnte den größten Erfolg verbuchen, noch erheblich mehr als Shakespeare, selbst mehr als die Reisebeschreibungen
- generell kann man zusammenfassen, daß das geringe Angebot der schönen Literatur, falls sie über- haupt in den Lesegesellschaften zu finden war, aus künstlerisch weniger anspruchsvollen Werken bestand, die aber das Ideal der nützlichen Literatur vertraten (moralisch-didaktische Schriften)
3 Die pragmatische, bürgerliche Gesellschaft als Integrationszentrum gesellschaftli- cher, literarischer und politischer Kräfte am Ende des 18. Jahrhunderts
3.1 Die Leser-Erwartungen bei den Mitgliedern der Lesegesellschaften
- die Lg zwischen 1770 und 80 gegr. wurden, hatten als Ziel, nützliche und angenehme Lektüre anzubieten, eine genauere Erklärung wurde nicht gegeben, Lg waren wohl allgemein bekannt und jeder hatte seine Vorstellung (verm. waren ja alle auch ziemlich gleich strukturiert)
- erst als in den80ern und 90ern immer mehr Lg mit auch sehr unterschiedlicher Ausrichtung auftauchten, mußten die Ziele genauer angegeben werden
- obwohl die Literatur den Mittelpunkt der Lg bildete, waren Bücher nicht der primäre Ausgangspunkt, primär war das Selbstbewußtsein der bürgerlichen Leser
- als Schlüssel zur Zukunft erschien ihm die Bildung, daraus ergibt sich der hohe Anspruch an Qualität und Inhalt der Literatur und der Lektüre, die sowohl angenehm als auch nützlich sein sollte
- in den Lg kann man eine sehr genaue Tendenz erkennen: Politik der eigenen, gespaltenen Nation und der anderen europäischen Länder wurde als „zur Bildung gehörend“ verstanden; neben Sensationslust sollte sie auch Informationen bringen, denn der Bürger lebte im Bewußtsein einer „unmittelbar bevorstehenden Aufgabe im politischen Bereich“
- neben der Politik sah man auch die Wissenschaft als neuen Bereich der Bürger an, man propagierte die Wichtigkeit des Lesens v.a. der aktuellen wissenschaftlichen Journale
- gefordert wurden populäre wissenschaftliche Schriften, die die Angelegenheiten des menschlichen Lebens betrafen und einen Bezug zur Praxis und zum Beruf aufwiesen
- neben Weisheit und Tugend, sollte auch das sittliche Gefühl und der Geschmack gebildet werden
- Bücher waren nicht nur zur Vertreibung der Langeweile zu verstehen, sondern sollten Wahrheit, Tugend, Ideen, Kenntnisse (Mensch, Erde) verbreiten und damit die Aufklärung erleichtern und ein besseres Verstehe ermöglichen
3.2 Periodika, der Grundstock der Bibliothek, als Antwort auf die Leser-Erwartungen
- es wurden v.a. politische Zeitschriften geführt (auch regionale), aber auch gelehrte Anzeiger
- das Bedürfnis nach ausländischer Literatur läßt sich sogar an den Abos franz., ital., engl. Zeitschriften sogar in kleinen Städten erkennen
- das Bewußtsein der Veränderlichkeit in der Politik ließ das Interesse an Tageszeitungen in den Lg steigen, viele Tageszeitungen lagen auch in Cafés aus; in Lesekabinetten suchte man auch das Gespräch über die aktuelle Tagespolitik, das sollte „Aufklärung und Licht“ verbreiten
- dennoch stehen die politischen Zeitungen im Schatten der historisch-politischen Journale, Magazine, Museen u.ä. Schriften, die einen historischen Zusammenhang der aktuellen Politik aufzeigen sollten
- auch die Zeitschriften mußten einen Zusammenhang zum „tätigen Leben“ aufweisen und im populäraufklärerischen Sinne „nützlich“ sein
- Schriften gab es neben den historischen, politischen usw. auch auf dem Gebiet der Nationalökonomie, Medizin, Wirtschaft, Landwirtschaft und Jurisprudenz
- unter den wenigen Buchtiteln gibt es prägnant philosophische, die der Vervollkommnung des Verstandes und des Sittlichen Gefühls und Geschmacks dienen sollten
- die wohl wirksamsten literarischen Zeitschriften waren verm. „Deutsches Museum“ und Wielands „Deutscher Merkur“, evtl. gab es noch einige mit lokalem Charakter („Pfälzisches Museum“)
- das deutliche Übergewicht der Periodika in allen Lg zeigt auch deutlich den Trend des extensiven Lesens, der das intensive Lesen verdrängt
- durch die überwiegende Zahl der Journale kommt eine gewisse Dynamik auch in die Lg, sie haben eine häufig zu beobachtende Tendenz zur Französischen Revolution, die eigene revolutionäre Bewe- gungen fördert
- Bücher sind meist Nachschlagewerke oder Wörterbücher, denn das Schwergewicht wurde immer auf die Zeitschriften, die ja den eigentlichen Grund der Gründung verdeutlichen, gelegt
- zu der Zeit als die Lg ihre Bestände um Bücher erweitern kam es noch immer zu Neugründungen von Lg in der alten Form (nur Zeitschriften), bzw. war weitere Bestehen dieses Typs zu beobachten
- Fach-Lg entstanden v.a. in den Unistädten, da nur dort ein gebildetes Publikum Fachliteratur fordert
3.3 Die Zusammensetzung des Buchbestandes als Erweiterung des Grundstocks
- in generell allen Lg kann man eine überwiegende Zahl an Journalen und Zeitschriften verzeichnen
- erst später, als ein gewisses Budget vorhanden war, kaufte man Bücher, viele Bücher kamen als Spende oder wurden als Angebote bei dem BH gekauft, der auch die Zeitschriftenabos verwaltete
- das eindeutige Interessenschwergewicht liegt auf dem historisch-politischen Bereich, der Schwerpunkt, v.a. im Bezug auf Reisebeschreibungen, unterscheidet sich bei den einzelnen Lg
- in den meisten Lg gab es keine Romanliteratur (wurde nur selten explizit ausgeschlossen, war den- noch selten vertreten), da die Autoren nur unterhalten wollten, was ohne bleibenden Nutzen für Herz und Verstand sei
- erst nachdem auch Frauen in die Lg aufgenommen wurden, die Frau als Richterin des Geschmacks angesehen wurde, kamen zunehmend auch Romane in die Lg
- die Bremer Lg „Museum“ hatte eine Vielzahl an Büchern, aus ihr entwickelte sich eine „Historische Lesegesellschaft“, von der sich später eine „Physikalische Lesegesellschaft“ abspaltete; obwohl sie sehr viele Werke angeschafft hatten, schlossen sie den Ankauf von fakultätswissenschaftlichen Werken aus, auch der Ankauf von Belletristik war zeitweise ausgeschlossen
- viele Lg hatten Bücher über die Französische Revolution und deren Folgen
- die Trierer Lg hingegen hatte sehr viele prosaische Werke, u.a. von Wieland, Gessner, Gleim, Goethe, Hagedorn, Herder, Klopstock, Kotzebue, Lessing
- Wielands Werke waren z.T. deswegen vertreten, weil man ihn als Aufklärer kannte; sein „Teutscher Merkur“ war eine bekannte Zeitung
- im allgemeinen gab es wenig schöne Literatur, obwohl durchaus Interessenten vorhanden waren, neben Wieland waren auch Kotzebues und Shakespeares Werke in vielen Lg vertreten, wenn auch die wenigsten Werke mit den begehrten Reisebeschreibungen Schritt halten konnten
- die meisten Werke waren historisch-politisch, sie waren auch sehr häufig im Ausleihregister wieder- zufinden
- obwohl die wenigsten Lg Romane hatten, wurden diese nur verurteilt, wenn sie Untätigkeit und Empfindelei hervorriefen oder förderten und weder Herz noch Verstand bildeten
3.4 Lektüre als integraler Bestandteil der gesellschaftlich-politischen Zielsetzungen der Lesegesellschaften
- es besteht ein Zusammenhang zwischen Lektüre und gesellschaftlicher Form; diese gesellschaftli- che Form erfordert ein „politisches Verhältniß“, d.h., es muß verschiedene Regeln für das Zusammen- leben geben; die Lg sehen in sich die Möglichkeit der Selbstbildung und der gegenseitigen Aufklärung, wobei im Umgang mit anderen die eigentliche Aufklärung und Erziehung zu Herz und Verstand gese- hen wurde
- Lg waren private Vereinigungen, die unabhängig von der staatlichen Kontrolle sein wollten, eine demokratische Struktur hatten, eigenverantwortlich handeln wollten und einen inneren Abbau der ständischen Schranken erreichen wollten
- gerade aber die Autonomie der Lg schien den Fürsten höchst suspekt, daher wurden die Zensur- maßnahmen strenger und jede Lg mußte nun Lektüreverzeichnisse der Zensurbehörde vorlegen
- durchgreifende Maßnahmen gegen die Lg und andere gesellschaftliche Vereinigungen gab es meist erst nach der Französischen Revolution, vorher gab es nur vereinzelt Verbote
- eine zentrale Bedeutung hatte in den Lg natürlich die Lektüre, die zur „Leserevolution“ geführt hatte und so dem Bürger auch das Recht einräumte, sich mit der eigenen Stellung kritisch auseinanderzusetzen; das Vorrecht der Gelehrten auf Lektüre verlor an Bedeutung
- die Lg wollten auch nicht Treffpunkt für die Gelehrten sein, sie waren höchst bürgerliche Einrichtun- gen, die sich nicht nur theoretisch mit dem Stoff auseinandersetzen wollte, sondern auch Einfluß auf die Umwelt nehmen wollte; bei einigen Lg kam es zu praktischer Umsetzung dieses Ziels: es gab Stif- tungstage für arme Schulkinder, denen man die Bücher schenkte, Armenspeisungen und Spenden
- der überaus auf Aufklärung bedachte Kreis der Lg kam auch in den Verdacht der aufrührerischen
Umtriebe oder wurden mit den Illuminaten (geheime Gesellschaften, zwischen dem16. und 18. Jh.; I.Orden 1776 in Ingolstadt gegr.) identifiziert
- der starken dynamisierenden Wirkung der gesellschaftlichen Lektüre, die auf breitere Schichten ü- bergriff, versuchte man mit Zensur entgegenzutreten; mancher glaubte, die Lektüre würde den Hand- werker und Landwirt von seiner Arbeit abhalten und in Armut stürzen; außerdem wurde den „soge- nannten Gesellschaften“ vorgeworfen, durch „irreligiöse, aufrührerische und sittenverderbliche Bücher und Schriften“ würden Bestrebungen deutlich, die sich nicht mit dem Obrigkeitsstaat vertrugen
4. Literatur und Leser: verschiedene Formen gesellschaftlichen Lesens um 1800
- man muß verschiedene Bestrebungen unterscheiden; es wird ein Zusammenhang zwischen Literaturauswahl, sozialer Situation und gesellschaftlichen Zielvorstellungen deutlich
4.1 „Aufklärungs-Lesegesellschaften“
- bei diesen meist in ländlichen Gegenden auftretenden Lg, ging es um die Förderung der patriarchalischen Gesellschaft; in erster Linie ging es um „Beförderung der Frömmigkeit“ und des guten Ge- schmacks; Vergnügen und Erweiterung der Kenntnisse sollten miteinander einhergehen
- in diesen Lg ist ein geringeres Angebot an Periodika zu verzeichnen, auch wenn die wichtigsten durchaus vorhanden waren
- eine historisch-politische Ausrichtung fand sich in einigen Werken zu geschichtlichen Themen eben- so wie in einigen Reiseberichten; den weitaus größten Teil macht aber die theologische Literatur aus: Erbauungs- und Andachtsbücher, Predigten und Entwürfe zu diesen, theologisch-pädagogische und exegetische Bücher
- die Aufklärungs-Lg hatten eine unpolitische Form, ihr Ziel war das gesellschaftliche Vergnügen und Erweiterung der gelehrten Kenntnisse
- es gab auch hier nur wenig schöne Literatur, keine Romane
- in der gesellschaftlich-politischen Komponente scheint dieser Typ der Lg noch unentwickelt
4.2 Die Form des „Clubs“
- die Form der geselligen Clubs ist sehr weit verbreitet gewesen und ähnelt in ihrer unpolitischen Haltung den Aufklärungs-Lesegesellschaften àdie Form der Clubs, die sich z.T. weiterhin Lg nannten, sind das, was den Begriff der Lg ins 19. Jh. rettete
- viele dieser Clubs entstanden vor allem gegen Ende des Jh. aus Lg oder übernahmen doch deren institutionelle Form; in größeren Städten existierten oft Lg und Clubs nebeneinander
- alles, was früher verboten war, scheint in den Clubs an der Tagesordnung zu sein: Teilnahme von Damen, Gelegenheit zum Spiel, Aufstellen von Billardtischen
- die Hamburger Lg „Harmonie“ stellt eine typische Form der gesellschaftlichen Vereinigung mit dem Ziel der kultivierten Unterhaltung dar; 1789 gegr., sie wollte zuerst nur Forum „wöchentlicher geselliger Zusammenkünfte während des Winters“ sein
- 1790 richtete man ein Lesezimmer ein, in dem man Journale als beliebteste Lektüre hielt
- es gab mehr „Spieler“ als Leser
- bei der Wahl der Literatur legte man kein Gewicht mehr auf politische Lektüre, man wollte „ohne Partei und Sektengeist“ auswählen und so für jeden etwas bieten
- hier wurden allerdings viele Romane gelesen
4.3 Der unterhaltsame Lesegesellschafts-Typ im Gegensatz zum pragmatischen
- gegen Ende des Jh. nimmt die Lg immer mehr gesellige Züge an; es kommt zu Mitgliedschaften von Damen, woraus auf den vermehrt unpolitisch-geselligen Charakter geschlossen wird
- es kommt zu einer Veränderung der Literaturauswahl, immer mehr Romane und Schauspiele werden angeschafft, die von pragmatischen Lg abgelehnt wurden, dennoch kann man den Ursprung an der Literaturauswahl noch deutlich erkennen: immer noch bilden Periodika das (wenn auch schwächer gewordene) Gerüst der unterhaltsamen Lg, auch hier gab es viele historisch-politische Werke, wenn auch der Neuerwerb dieser Gattung ab Ende des Jahrhunderts stark zurückgeht
- bei manchen Lg kann man ein Ansteigen der Reiseliteratur feststellen, bei anderen hingegen ist ihr Anteil verschwindend gering
- aber in allen Lg des neuen, unterhaltenden Typs kann man ein Ansteigen der Roman- und Schauspielliteratur erkennen, doch die Vorliebe für historische Romane deutet auf die ehemals pragmatische Vergangenheit der Lg hin
4.4 Das „Museum“ als buchhändlerische Unternehmung großen Stils
-Museen entstanden fast ausschließlich aufgrund privater Initiative von BH, sie entstanden fast ausschließlich im letzten Jahrzehnt des 18. Jh. (bis auf Trattner, der sein Wiener Museum bereits 1777 eröffnete àgilt als Vorläufer)
- beachtlich scheint die reiche Ausstattung und die Vielzahl an Räumen (Lesesaal, Ausstellungsraum für Gemälde und Kupferstiche..., Musikzimmer und Unterhaltungszimmer) zu sein
- dennoch handelte es sich bei dieser Art der Gesellschaft um eine unpolitische, obwohl durch die Diskussion eine Verbindung zu den Lesekabinetten zu sehen ist
- Unterschiede erkennt man u.a. an dem Fehlen einer gesellschaftlichen Verfaßtheit, Gesetze bezogen sich meist nur auf Tarife und Mitgliedsdauer, aufgenommen wurde jeder, die Ballotage ist gänzlich unbekannt; außerdem konnten auch Nichtmitglieder Bücher und Zeitschriften gegen Gebühr entleihen (wenn auch nicht die Räumlichkeiten nutzen)
- die Museen hatten meist unterhaltende Literatur, mußten aber große Bestände haben, um die versprochenen Werke aus sämtlichen Wissenschaften für die Gelehrten präsent zu haben und, da sie damit warben, immer die neueste Literatur von der Messe zu kaufen, auch immer aktuell sein, dennoch ist ein Schwergewicht auf die Romane und Schauspiele nicht zu übersehen
4.5 Die offene Form der Leihbibliothek
- sie unterschied sich von den Museen v.a. durch ihre Literaturzusammenstellung (fast ausschließlich Romane) und ihr Publikum (meist untere Schichten)
- die Leihbibliotheken waren weit verbreitet, ihr Angebot richtete sich an die unteren Schichten und
auch an Frauen, Mädchen und Studenten, die angeblich durch das Angebot zu „Lesesüchtigen“ erzo- gen würden, und durch die schlechte Literatur „für den Geschmack nachtheilig“ beeinflußt zu werden
- diese Form der Literaturverbreitung entstand ca. zur gleichen Zeit wie die frühen Lg, doch im Gegensatz zu diesen hatten sie „immer neue Massen vornehmlich trivialer Literatur“
- aber gerade bei dieser Form kann man gewaltige Qualitätsunterschiede erkennen; die von BH un-
terhaltenen Bibs hatten meist sehr gute Sammlungen; was man als „moralische Giftbuden“ bezeichnete waren die von Buchbindern oder „Unzünftigen“ betriebenen Bibs
4.6 Die „Literarische Gesellschaft“ als exklusiver Freundeszirkel
- eine von Gerhard Anton Halem (oldenburgischer Justizrat) 1779 gegr. Literarische Gesellschaft entstand aus dem Bedürfnis, gleichaltrige, an schöner Literatur und Theater zusammenzubringen
- diese Gesellschaften hatten nur eine begrenzte Zahl an Mitgliedern (in Halems Fall 12), die nur nach Tod oder Wegzug eines Mitglieds durch neue Mitgliedschaft ergänzt wurde (zur Aufnahme gehörte eine 100%ige Zustimmung der Mitglieder
- sie sollte auf Vertrauen und gegenseitige Freundschaft aufgebaut sein, Ziel war auch nicht die Belehrung, sondern die angenehme Unterhaltung mit schöner Literatur und Kunst
- Literarische Gesellschaften gab es in ganz Deutschland, man versteht sie als eine Vergesellschaftung des Freundschaftskultes des 18. Jh., der sich im Bürgertum ausbreitete
4.7 Fachlesegesellschaften
- seit dem letzten Jahrzehnt des 18. Jh. weit verbreitet
- ihre Ziele: Journale und Abhandlungen über das jeweilige Gebiet zugänglich zu machen, die „für die Wissenschaften ein Gewinn“ sein könnten
- mit den Lg haben sie den Bezug auf die Nützlichkeit der Literatur gemeinsam
Schluß
- ab 1783 (Verbot der Aschaffenburger Lg) breitete sich langsam ein Verbot der Lg in den deutschen Einzelstaaten aus, welche in der Jahrhundertwende nicht verboten waren, wurden mit strengen Aufsichtsverordnungen belegt
Häufig gestellte Fragen
Was waren Lesegesellschaften im 18. Jahrhundert?
Lesegesellschaften (Lg) waren Vereinigungen von Lesern im 18. Jahrhundert, die gemeinsam Bücher und Zeitschriften erwarben, um ihren Lesebedarf kostengünstiger zu decken. Sie entstanden in einer Zeit, in der die Buchproduktion anstieg, das Lesepublikum sich erweiterte und das intensive Lesen sich zum extensiven Lesen wandelte.
Welche Typen von Lesegesellschaften gab es?
Es gab verschiedene Typen: Lesezirkel (die Bücher und Zeitschriften zirkulieren ließen), Lesebibliotheken (mit eigenen Bibliotheken, in denen man Literatur ausleihen konnte) und Lesekabinette (die eigene Räume mieteten, in denen Mitglieder lesen, diskutieren und wissenschaftlich arbeiten konnten).
Wer waren die Mitglieder von Lesegesellschaften?
Die Mitglieder stammten hauptsächlich aus dem gehobenen und mittleren Bürgertum, darunter Beamte, Juristen, Ärzte, Pfarrer, Offiziere und Professoren. Handwerker schlossen sich später auch zusammen, um nützliche Literatur zu zirkulieren. Frauen und Studenten waren in Lesekabinetten generell ausgeschlossen.
Welche Art von Literatur wurde in Lesegesellschaften gelesen?
Die Lektüre umfasste Kalender, moralische Romane, Almanache, religiöse Erbauungsschriften, Reisebeschreibungen, politische Journale, gelehrte Zeitungen, und Fachzeitschriften. Es gab eine Tendenz zu aktueller Literatur und Unterhaltungsschriften. Die Auswahl des Lesestoffes erfolgte meist durch Mehrheitsbeschluss.
Warum entstanden Lesekabinette?
Lesekabinette entstanden in Städten, in denen das Bürgertum wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegswillen zeigte. Sie dienten dem Meinungsaustausch, der Bildung einer eigenen Meinung und der Etablierung eines festen Standpunktes. Sie boten auch einen Versammlungsort und ermöglichten Diskussionen über das Gelesene.
Was waren die Statuten von Lesegesellschaften?
Die Statuten beinhalteten Gleichberechtigung und Mitbestimmung der Mitglieder. Verfassung, Gesetze und die Neuaufnahme von Mitgliedern wurden gemeinsam ausgearbeitet bzw. beschlossen. Die Auswahl des Lesestoffes erfolgte durch alle Mitglieder oder ein Gremium.
Welche Bedeutung hatten Lesegesellschaften im späten 18. Jahrhundert?
Lesegesellschaften trugen zur Literaturvermittlung und zur Verbreitung der Bildungsbestrebungen der Aufklärung bei. Sie förderten die Allgemeinbildung, Geschmacksbildung und den gemeinschaftlichen Austausch. Sie ermöglichten den Mitgliedern, sich aus ihrer Unmündigkeit zu befreien und bereiteten den Boden für die spätere Parteienbildung.
Welche Rolle spielten Periodika in Lesegesellschaften?
Periodika, insbesondere Zeitschriften, waren ein Grundbestandteil der Lesegesellschaften. Es gab "Politische Journale" und "Gelehrte Zeitungen". Auch Zeitungen aus dem Ausland wurden häufig abonniert.
Warum nahm die Bedeutung von Lesegesellschaften ab?
Gründe für den Rückgang waren Zensurbestimmungen, die Verbreitung billigerer Zeitschriften und Bücher durch neue technische Möglichkeiten, die Ausbreitung gewerblicher Leihbibliotheken und die Gründung neuer öffentlicher Bibliotheken. Außerdem wandelte sich das Vereinswesen hin zur reinen Geselligkeit.
Wie unterschieden sich Aufklärungs-Lesegesellschaften von anderen Formen?
Aufklärungs-Lesegesellschaften, die meist in ländlichen Gegenden auftraten, konzentrierten sich auf die Förderung der patriarchalischen Gesellschaft, "Beförderung der Frömmigkeit" und des guten Geschmacks. Sie hatten weniger politische Ausrichtung als andere Lesegesellschaften.
Was waren "Museen" im buchhändlerischen Sinne?
"Museen" waren buchhändlerische Unternehmungen, die von Buchhändlern gegründet wurden. Sie verfügten über Lesesäle, Ausstellungsräume und Unterhaltungszimmer, waren aber unpolitisch. Jeder konnte gegen Gebühr Bücher und Zeitschriften entleihen.
Was war das Ziel von Literarischen Gesellschaften?
Literarische Gesellschaften waren exklusive Freundeszirkel, die sich dem Freundschaftskult des 18. Jahrhunderts widmeten. Ihr Ziel war die angenehme Unterhaltung mit schöner Literatur und Kunst.
Was waren Fachlesegesellschaften?
Fachlesegesellschaften dienten dazu, Journale und Abhandlungen über ein bestimmtes Fachgebiet zugänglich zu machen. Sie teilten mit den anderen Lesegesellschaften den Fokus auf die Nützlichkeit der Literatur.
- Quote paper
- Martina Wiederrecht (Author), 1998, Lesegesellschaften im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103630