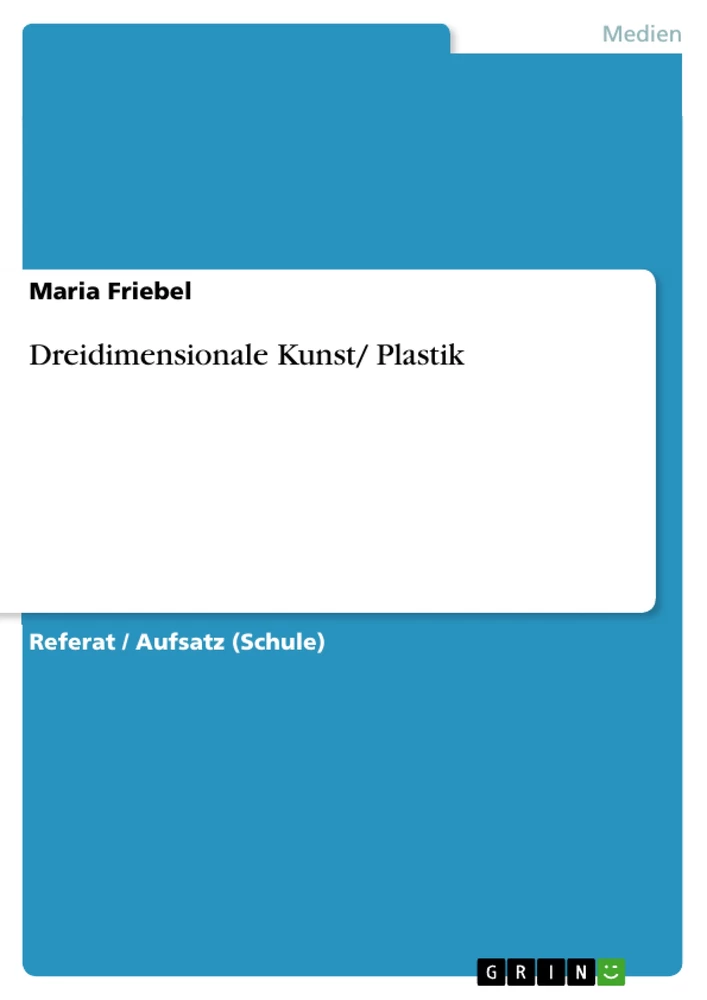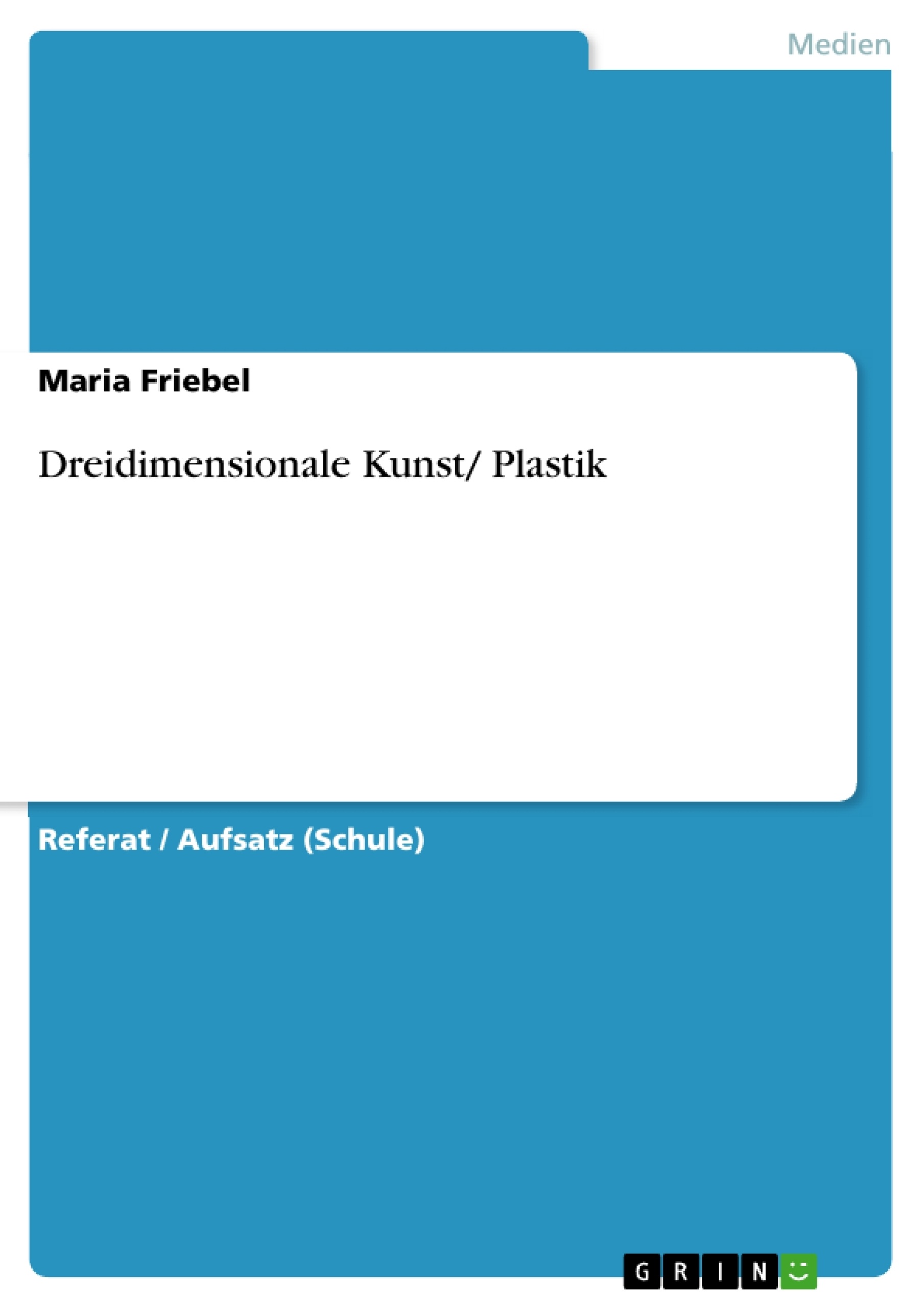Was bedeutet es, Raum zu formen, Gewicht zu verleihen und eine Geschichte ohne Worte zu erzählen? Entdecken Sie die faszinierende Welt der dreidimensionalen Kunst, von den erhabenen Skulpturen Michelangelos bis zu den beweglichen Mobiles Calders. Diese umfassende Erkundung führt Sie durch die Grundbegriffe der Plastik, von additiven und subtraktiven Verfahren bis hin zur Materialgerechtigkeit und der komplexen Beziehung zwischen Körper, Raum und Betrachter. Erfahren Sie, wie Künstler wie Bernini, Cellini und Rodin mit Licht und Schatten, Oberflächenstruktur und Komposition spielen, um Werke von bleibender Wirkung zu schaffen. Tauchen Sie ein in die Analyse von Schlüsselkonzepten wie Volumen, Masse, Ansichtigkeit und Kontur, um die vielfältigen Ausdrucksformen dreidimensionaler Kunst zu verstehen. Von den monumentalen Denkmälern der Antike bis zu den expressiven Nanas von Niki de Saint Phalle, diese Reise enthüllt die Techniken, Materialien und philosophischen Überlegungen, die Bildhauer und Plastiker seit Jahrhunderten antreiben. Untersuchen Sie die Bedeutung von Sockeln und Plinthen, die subtile Lenkung des Blicks durch Kontur und Komposition und die Rolle von Bewegung und Zeit in kinetischen Skulpturen. Lassen Sie sich von den Beispielen großer Meister inspirieren und entwickeln Sie ein tieferes Verständnis für die formalen ästhetischen Gesichtspunkte, die Aussageabsichten und die Wirkung, die dreidimensionale Kunst auf uns ausübt. Ob Sie ein Kunststudent, ein Sammler oder einfach nur ein neugieriger Betrachter sind, dieses Buch bietet Ihnen die Werkzeuge und das Wissen, um die vielschichtige Welt der Plastik in all ihren Dimensionen zu erkunden und zu schätzen. Verstehen Sie die feinen Unterschiede zwischen Skulptur und Plastik, die Bedeutung der Materialwahl von Gips über Ton bis Marmor und die vielfältigen Techniken von Akkumulation bis Assemblage. Ergründen Sie die Konzepte der Kernplastik, der Raumgreifenden Formen und der Durchbruchsformen, um die subtile Sprache der dreidimensionalen Kunst zu entschlüsseln. Diese Abhandlung beleuchtet die epochenübergreifenden Entwicklungen und lädt dazu ein, die Werke von Archipenko, Kollwitz, Moore und vielen anderen im neuen Licht zu sehen. Erweitern Sie Ihren Horizont und entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten der dreidimensionalen Kunst, eine Kunstform, die uns immer wieder aufs Neue herausfordert und inspiriert, den Raum um uns herum und unsere eigene Wahrnehmung zu hinterfragen.
Dreidimensionale Kunst
2 Bildbeispiele vorgesetzt und nach bestimmten Aspekten vergleichen
- formal ästhetische Gesichtspunkte
- Aussageabsichten
- Wirkung auf den Betrachter
Grundbegriffe der Plastik
Definition:
- Plastik im weiteren Sinne: Oberbegriff für dreidimensiobale Kunst Überbegriff für Skulptur, Objekt, Plastik im engeren Sinne
- Skulptur: subtraktive, wegnehmende oder abtragende Herstellung häufigste Materialien: Holz, Stein Korrekturen nur schwer möglich
- Plastik im engeren Sinne: additive, aufbauende, modellierende Herstellung verformbare Materialien, z.B. Ton, Wachs
zum Halt: an Gerüst (Armierung) angetragen Korrektur durch subtraktive Manipulationen
- Kombination verschiedener Verfahren: Akkumulation: Anhäufung
(Gips) Assemblage: Zusammenfügen von Gegenständen
Konstruktion Montage
”object trouvé” : Fundstück mit Gebrauchsspuren → Objektkunstwerk/ Objekt
Materialgerechtheit/ Materialgerechtigkeit:
- Wahl des geeigneten Werkstoffes im Hinblick auf das anzugehende Thema
→ Material = emotionale Grundlage
Gips: Tod; Ton: Leben; Marmor: Wiederauferstehung
- richtiger Umgang mit dem gewählten Material
→ Nachahmung von Stofflichkeit, Darstellung von Textilien, Haar, Inkarnat (Haut)
→ Charakter des Werstoffes durch Faktur (Machart), z.B. in Werkspuren
Körper-Raum-Beziehung:
- Plastik nimmt realen Raum ein; in Vorstellung wirkt sie virtuell auf den sie umgebenden Raum
- Material: positive Formen
- Raum: negative Formen
- Grundformen des Körpers:
Block/ Kernplastik: wirkt blockhaft; oft geschlossene Umrisse raumabweisend, durchgängige konvexe Wölbung → keinerlei ”Angriffsfläche” z.B. bei stereometrischen ldealformen (Kugel, Ei)
sammeln Energie im Innern
Körper mit konkaven & konvexen Partien: ausgeglichen; raumoffen eingezogene oder Hohlformen/ Durchbrüche tw. raumgreifend/ raumweisend Bsp: verschiedene Stellungen des menschlichen Körpers
Gegensätze zu Kernplastiken: + Komposition mit dominanten Hohl- oder Mantelformen:
z.B. an einer Seite offener Zylinder
+ Durchbruchsformen
+ Komposition mit ausgedünnten Formen
z.B. in Gestalt eines geraden oder gebogenen Stabes wirken vom Raum erdrückt, linear, Verkürzung der Stäbe → vorne-hinten- Wirkung
Volumen, Masse, Gewicht:
- Unterscheidung des plastischen Volumens in
Massevolumen: Menge des verwendeten Materials Raumvolumen: geformte Raumanteile
- Betrachter vervollständigt die reduziert gegebene Form nach dem “Gesetz der guten Gestalt” in seiner Vorstellung
- optisches Gewicht: durch besondere Masseverteilung, Komposition und Anordnung: massive oder leichte Wirkung (Würfel leichter, wenn auf Spitze gestellt oder aufgehängt)
Größe, Präsentation:
- Großplastik: lebensgroß, überlebensgroß
- Kleinplastik: unterlebensgroß
- Monumentalplastik: beeindrucken durch ihre Größe
- Sockel/ Postamente: vor allem bei Denkmälem erhöhende Funktion → Betrachter Untersicht aufzwingen; Überlegenheit suggerieren
- Plinthe: meistens aus dem selben Material wie die Figuren; Standfestigkeit; erhöhende Funktion
Ansichtigkeit, Kontur, Blickführung:
- Frage des Betrachterstandpunktes
- mehransichtige Plastiken: voll-/rundplastisch
- Bodenplastiken (umschreitbar)
- Standplastiken und freistehende Werke
- oft eine Hauptansicht → oft am aufschlussreichsten
- allansichtige Plastiken: häufig eine oder zwei Schauseiten => v.a. abstrakte Kunst
- einansichtige Plastiken:
+ Relief: - Skulptur, bei der das Bild aus einer Stein- oder Metalloberfläche erhaben herausgearbeitet wird
- Unterscheidung zwischen versenktem und erhabenem Relief
→ erhabenes Relief: nach Grad der Erhebung: Flach-, Halb-, Hochrelief Hinterschneidungen <+
+ Nischen- und Wandfiguren: - für Nische oder Wand konzipiert
→ am Rücken nicht näher ausgearbeitet
- frontalansichtig/ en face (von vorn)
- z.B. Bauplastiken an mittelalterlichen Kathedralen
- Kontur : Umrißlinie der betrachteten Plastik
- Silhouette: Schattenriß
- Blickführung = Ansichtigkeit und Kontur → Reihenfolge der Betrachtung der einzelnen Teile einer Plastik
Licht und Schatten:
- Wirkung: abhängig von Material (Gips = stumpf, Marmor = transluzid/ leuchtend) abhängig von der Farbe des Materials
abhängig von der Bearbeitung der Oberfläche (unruhiges Licht-Schatten-Spiel einer zerklüfteten Oberfläche)
abhängig von der Plastizität und der Lichtquelle (stark seitliche Lichtquelle: dramatischer als diffuses Licht)
- Spitzlichter: hell reflektierende Stellen + Spiegelung der Umgebung = bei stark polierten Werken
- Schatten:
- Eigenschatten (auf Oberfläche der Plastik)
- Schlagschatten (wirft Plastik auf Umgebung)
- Halb- oder Nebenschatten: nicht direkt ausgeleuchtete Stellen
- Kernschatten: unbeleuchtete Stellen
Oberfläche, Plastizität:
+ Oberflächenstruktur (Textur): ”begreifbare” Qualitäten
- glatt, stumpf, warm, kalt, poliert, rauh, feucht, rissig, spröde, rostig o.ä.
- Bosse : Werkspuren des Meißels → (absichtsvolles) Non-finito => Kontrast polierte Formen - Bosse
+ Fassung : Überarbeitung der Oberfläche einer Plastik mit anderen Materialien (Glasur/ Patina/ Vergoldung)
+ Plastizität: (Formbarkeit, Wechsel von konkaven und konvexen Formen) → Faltenwurf Stärke der Oberflächenstrukturierung
Gerichtetheit, Bewegung, Zeit:
- Gerichtetheit : Dominanz der Ausdehnung in eine bestimmte oder mehrere Richtungen
- Richtungsbeziehungen: oft in bestimmten Rhythmus oder Kontrast angeordnet ”stehend”, ”liegend”, ”sitzend”, ”sich aufrichtend”
beliebteste Anordnung: Kontrapost (”Gegensatz”)
Ponderation: Ausgleich, Harmonie Körperteile - Gewicht
- Verhältnis des Körpers zum Raum:
- von einem Zentrum nach außen gerichtet → raumweisender Körper; flüchtig, vergänglich, lebendig, weltzugewandt, extrovertiert
- nach innen, auf eine gedachte oder tatsächliche Mitte gerichtet
→ raumabweisender Körper; ewige Gültigkeit, ruhig, geschlossen, introvertiert, innerlich bewegt
- Gleichgewicht, Statik, Dynamik:
- vertikale/ horizontale Richtungsdominanz: statisch/ standfest
- diagonale Richtungsdominanz: labil, dynamisch-bewegte Wirkung
- Bewegung: + dargestellte Bewegung (z.B. einer Handlung)
→ Darstellen eines Bewegungsflusses/ Moment des Stillstandes eines Ablaufes
+ fruchtbarer Moment : Zeitpunkt in einem Handlungsablauf
+ tatsächliche Bewegung: in beweglichen, kinetischen Plastik (Körper-Raum- Bewegung in ständigem Wechsel)
Komposition, Proportion:
Komposition: Anordnung nach Harmoniegesetzen
- Aufbau: organisch, tektonisch
- Gliederung:
- zielt auf: + Formkontraste, Verhältnis der Teile zum Ganzen, Rhythmus, Abfolge der Teilvolumina und -massen
+ Ausgleiche schaffen
Proportion :Verhältnis von einzelnen Maßen/ Körperteilen zueinander
- Goldener Schnitt: teilt Strecken, Flächen, Körper in ein konstruierbares, harmonisches Verhältnis → Spannung
Beispiele:
- Bernini, Gian Lorenzo (1598-1680):
italienischer Bildhauer, Hauptvertreter des Barock → von Pathos geprägte Stilrichtung des 17. Jh.
→Kardinalsbüste: Veränderung des mimischen Ausdrucks: behält was Lebendiges im polierten Stein “Vanitas”-Denken der Zeit; Überwältigung aller Sinne (schwülstig)
- Cellini, Benvenuto (1500-1571):
italienischer Bildhauer des Manierismus → “persönliche Handschrift”; “figura serpentinata”= geschlängelte Figur Mehransichtigkeit
- Michelangelo, Buonarroti (1475-1564)
italienischer Maler, Bildhauer und Architekt der Renaissance und des Manierismus
→ Wiedergeburt der Antike: Darstellung der Menschen und der Welt, nicht mehr der Heiligen; neues Menschenbild; Welt der wissenschaftlichen Entdeckungen; verfeinerte Proportionen
→ Beispiele: + ”David” => Aushängeschild für Freiheit der Florentiner
- Siegerpose, Souveränität, Individualität, neues Selbstbewußtsein, Symbol junger städtischer Macht, Jugend, Ruhe, Kraft, athletisch gebaut, Mut, konzentriert
- weißer Marmor, perfekte Lockenpracht, allansichtig
- Kontrapost: Ausgleich zwischen Bewegung und Ruhe, Stehen und Schreiten, ansteigenden und fallenden Linien (Standbein-Spielbein-Haltung)
+ “Pietá” - Darstellung Mariens mit dem Leichnam Christi auf dem Schoß = “Vesperbild”
- überlebensgroß, betonte Senkrechte, Leid: nach unten gezogen (Blickführung), Überschneidung, proportional, Bewegung friert ein, Mutter und Sohn = eng zusammen → Block, Strukturierung => Licht-Schatten, glänzendes Material (Marmor), Marias rechte Hand umfasst ihn kraftvoll, linke präsentiert ihn → fordert Betrachter zur Verehrung auf, Blick gesenkt; Christuskörper fast gänzlich von Umrißlinie des Marienkörpers aufgenommen; schwere Falten Mariens → Erdverbundenheit, Christi berührt Erde nur mit re Fußspitze; Hauptansicht
- Leochares → Apollon von Belvedere
Apoll (Rom, vatikanische Museen, Marmor, Höhe 2.24m)
- fast schon schwebend, leichtfüßig; prä sentiert seine Nacktheit nicht so, sanfter Blick mit pathetischem Ernst, jedoch luftig, leicht, wie gerade gelandet; präsentiert sich
- runde Plinthe → Drehbewegung verstärkt
- überlebensgroß; raumgreifend; Halbprofil
- antik: scharfe Falten des Umhangs; römische Kopie einer antiken Bronze
- Verstärkung an den Beinen (Baumstamm) → Schlange
- These: von den Christen in einen Adam umgearbeitet (bedeckte Scham, Schlange)
- Apoll = heidnischer, mit seinem Körper prahlenden Gott
- Umhang: windet sich mit der Leichtigkeit eines feinen Seidenschleiers um den ausgestreckten linken Arm; die kurze und kräftige Haarpracht kräuselt sich sanft
- Kontrast: Schwere und Massivität der Figur - Leichtigkeit und Sanftheit der Bewegungen
- fehlende Arme - leicht angehobenes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kinn→ bereit jemand zu tadeln; schaut über Betrachter hinweg; herablassend
- Gewicht: auf dem rechten Bein, der körperliche Schwerpunkt im Becken
- vertikale Achse schwingt in einer flachen S-Kurve, die in horizontaler Richtung von einer durch Arme und Schultern gebildeten S-Kurve gekreuzt wird
- Betrachter mit linker Schulter zugewandt; nimmt rechte leicht zurück
- Hüfte kippt nach rechts unten; rechtes Bein = Standbein; linkes: Spielbein
- Archipenko, Alexander (1887-1964)
russischer Bildhauer des Konstruktivismus → auf geometrischen Formen beruhend
Vereinfachung und Stilisierung der menschlichen Figur; Formabstraktion und Materialexperimente → Beispiel: “Flacher Torso”
- nach oben hin Aufhellung der blau-grünen Patina
- Frauentorso; schwungvolle Kurven
- unproportional (lange überschlanke Oberschenkel, tief sitzende Kniescheiben)
- untere Teil des Beins in Sockel eingeschlossen → keine Bewegung möglich
- starr, ruhig, zeitlos, ewige Gültigkeit; raumabweisend (in sich gerichtet) → Block
- Sockel + schmale runde Plinthe unterstreichen die senkrechte Ausrichtung
- mehransichtig (von der Seite flach; von vorne runde weibliche Formen) → Hauptansicht = Vorderansicht
- Eleganz, Grazie, Zerbrechlichkeit
- Kontrast zwischen senkrechter rechter Seite und geschwungener linker Seite
- Alexander Calder (1898 - 1976):
amerikanischer Plastiker
→ kinetische Plastik: + Werk, das Bewegung als Gestaltungsmittel enthält und damit unendlich viele
= Mobilé Konstellationen von Körper und Raum ermöglicht
+ tritt vorrangig in Verbindung mit abstrakten Formen auf + bei Calder: windbetrieben
+ unflexible, unberechenbare (Windeinflüsse) Bewegung → Eingebungen des Augenblicks
+ Farbe: Kälte genommen, Gesichtsform unterstrichen
+ keine Nachbildung; fängt die Bewegung ein
+ vergängliches, wertloses Material; durch Bewegung existent (virtuelles Volumen)
- Niki de St. Phalle (*1930)
französische Plastikerin des Nouveaus réalisme → parallel zur Pop-Art (grell-plakativ, poppig-bunt) Autodidaktin; in der Jugend von Vater vergewaltigt → Kunst als Selbstbefreiung
→ Beispiel: Nanas (aus Polyester)
- Bewegung, unproportional => typisch weibliche Merkmale überproportional; Rest vereinfacht
- Fruchtbarkeitsgöttinnen
- leuchtende, klare Farben (Grundfarben) → fröhlich, warm, bewegt, lebendig
- “ich liebe das Runde, die Kurve, die Welle” -> keine Symmetrie, kein rechter Winkel
- raumweisend; viele konkave und konvexe Wölbungen; Durchbrüche
- Postament; eine Hauptansicht
- Blickführung in alle Richtungen
- Rodin, Auguste (1840-1917)
französischer Plastiker zwischen Impressionismus, Realismus und Symbolismus → Geheimnis, Athmosphäre des Irrealen, Verinnerlichung
modelé: Kunst der Buckel und Höhlen; Torso, Non Finito
- Kollwitz, Käthe (1867-1945)
deutsche Grafikerin und Plastikerin im Umkreis des Expressionismus
→ Selbstbildnisse
- Moore, Henry (1898-1986) englischer Plastiker
→ Torso = verletztes Menschenbild (Symbol und Ausdruck für den gefährdeten Menschen) Angst, Wehrlosigkeit; Anklage gegen Krieg und Gewalt
Kopf = dump fe Hinnahme von Schmerz (Kraft); Schild = Schutz knochige, eckige, gedrungene Formen
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Grundbegriffe der Plastik?
Die Grundbegriffe der Plastik umfassen die Definitionen von Plastik im weiteren und engeren Sinne, Skulptur, Objekt, Akkumulation, Assemblage, Konstruktion, Montage und "object trouvé". Materialgerechtheit/Materialgerechtigkeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Was ist der Unterschied zwischen Skulptur und Plastik im engeren Sinne?
Skulptur ist eine subtraktive Herstellungstechnik, bei der Material abgetragen wird (z.B. Holz, Stein), während Plastik im engeren Sinne eine additive Technik ist, bei der Material aufgebaut und modelliert wird (z.B. Ton, Wachs).
Was bedeutet Materialgerechtheit/Materialgerechtigkeit in der Plastik?
Materialgerechtheit bedeutet die Wahl des geeigneten Werkstoffes im Hinblick auf das Thema und den richtigen Umgang mit dem gewählten Material. Das Material kann die emotionale Grundlage des Kunstwerks bilden (z.B. Gips für Tod, Ton für Leben).
Wie beeinflusst die Körper-Raum-Beziehung die Wirkung einer Plastik?
Die Körper-Raum-Beziehung beschreibt, wie die Plastik realen Raum einnimmt und virtuell auf den umgebenden Raum wirkt. Grundformen des Körpers wie Block/Kernplastik, Körper mit konkaven & konvexen Partien und Kompositionen mit Hohlformen beeinflussen die Raumwirkung.
Was sind Massevolumen und Raumvolumen?
Massevolumen bezeichnet die Menge des verwendeten Materials, während Raumvolumen die geformten Raumanteile beschreibt. Der Betrachter vervollständigt die reduzierte Form oft in seiner Vorstellung ("Gesetz der guten Gestalt").
Wie beeinflusst die Größe einer Plastik ihre Wirkung?
Großplastiken sind lebensgroß oder überlebensgroß, Kleinplastiken sind unterlebensgroß. Monumentalplastiken beeindrucken durch ihre Größe. Sockel und Postamente erhöhen die Plastik und suggerieren Überlegenheit.
Was bedeutet Ansichtigkeit in Bezug auf Plastiken?
Ansichtigkeit bezieht sich auf den Betrachterstandpunkt und die Anzahl der Ansichten, die eine Plastik bietet. Es gibt mehransichtige (voll-/rundplastisch), allansichtige und einansichtige Plastiken (Relief, Nischen- und Wandfiguren).
Wie wirken Licht und Schatten auf eine Plastik?
Die Wirkung von Licht und Schatten hängt vom Material, der Farbe und der Bearbeitung der Oberfläche ab. Eine zerklüftete Oberfläche erzeugt ein unruhiges Licht-Schatten-Spiel. Es gibt Spitzlichter, Eigenschatten, Schlagschatten und Halbschatten.
Was sind Oberfläche, Textur und Plastizität?
Oberflächenstruktur (Textur) beschreibt die "begreifbaren" Qualitäten der Oberfläche (z.B. glatt, rau, warm). Fassung bezeichnet die Überarbeitung der Oberfläche mit anderen Materialien. Plastizität bezieht sich auf die Formbarkeit und den Wechsel von konkaven und konvexen Formen.
Was bedeutet Gerichtetheit und wie beeinflusst sie die Wirkung einer Plastik?
Gerichtetheit beschreibt die Dominanz der Ausdehnung in eine bestimmte Richtung. Richtungsbeziehungen können in einem Rhythmus oder Kontrast angeordnet sein. Das Verhältnis des Körpers zum Raum kann raumweisend oder raumabweisend sein.
Wie beeinflussen Gleichgewicht, Statik und Dynamik die Wirkung einer Plastik?
Vertikale oder horizontale Richtungsdominanz wirken statisch/standfest, während diagonale Richtungsdominanz eine labile, dynamisch-bewegte Wirkung erzeugt. Bewegung kann dargestellt sein oder tatsächlich in kinetischen Plastiken vorkommen.
Was bedeuten Komposition und Proportion in der Plastik?
Komposition bezeichnet die Anordnung nach Harmoniegesetzen. Proportion ist das Verhältnis von einzelnen Maßen/Körperteilen zueinander. Der Goldene Schnitt ist ein Beispiel für ein harmonisches Verhältnis.
Welche Künstler werden als Beispiele genannt?
Genannte Künstler sind Bernini, Cellini, Michelangelo, Leochares, Archipenko, Calder, Niki de St. Phalle, Rodin, Kollwitz und Moore.
Welche Werke von Michelangelo werden erwähnt?
Es werden Michelangelos "David" und "Pietá" (Vesperbild) erwähnt.
Was ist eine kinetische Plastik und wer war ein bedeutender Vertreter?
Eine kinetische Plastik ist ein Werk, das Bewegung als Gestaltungsmittel enthält. Alexander Calder war ein bedeutender Vertreter mit seinen Mobilés.
Was sind die Nanas von Niki de St. Phalle?
Die Nanas sind Plastiken aus Polyester von Niki de St. Phalle, die durch ihre grellen Farben, unproportionalen Formen und Fruchtbarkeits-Assoziationen auffallen.
Was bedeutet "Non-finito" im Bezug auf Rodins Werke?
"Non-finito" bezieht sich auf Rodins Technik, bei der Werke unvollendet wirken, oft durch Werkspuren wie "Bosse", was eine besondere Ästhetik erzeugt.
Wie thematisiert Henry Moore den Menschen in seinen Plastiken?
Henry Moore thematisiert oft den verletzten Menschen, Angst und Wehrlosigkeit in seinen Torsi. Seine Naturformen, Durchbrüche und fließenden Asymmetrien stehen im Gegensatz zum technikorientierten Konstruktivismus.
- Quote paper
- Maria Friebel (Author), 2000, Dreidimensionale Kunst/ Plastik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103543