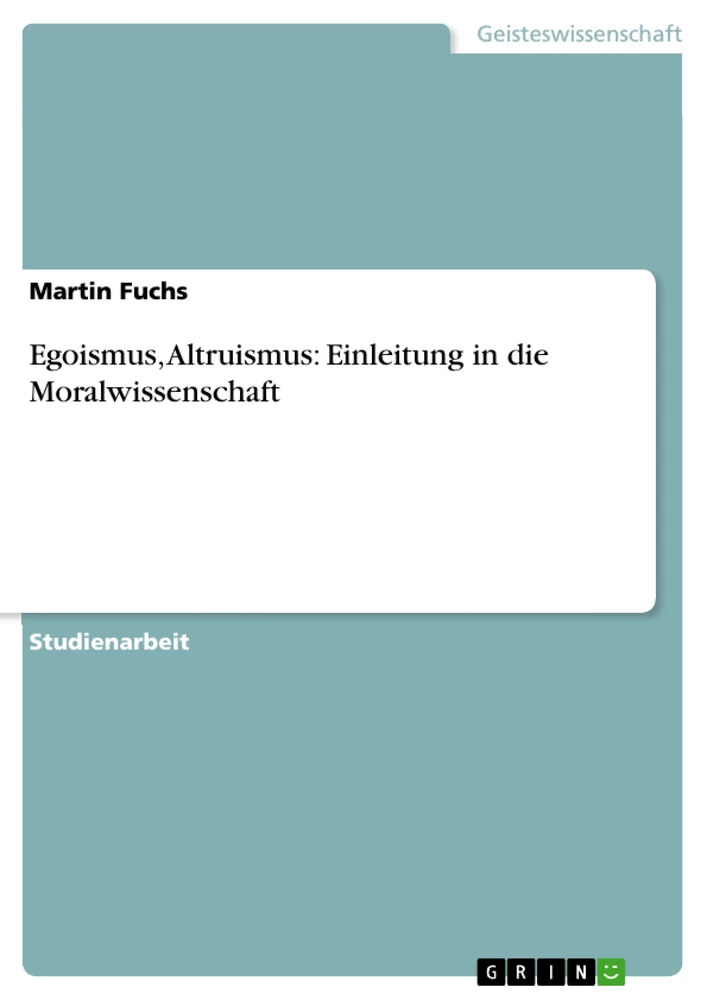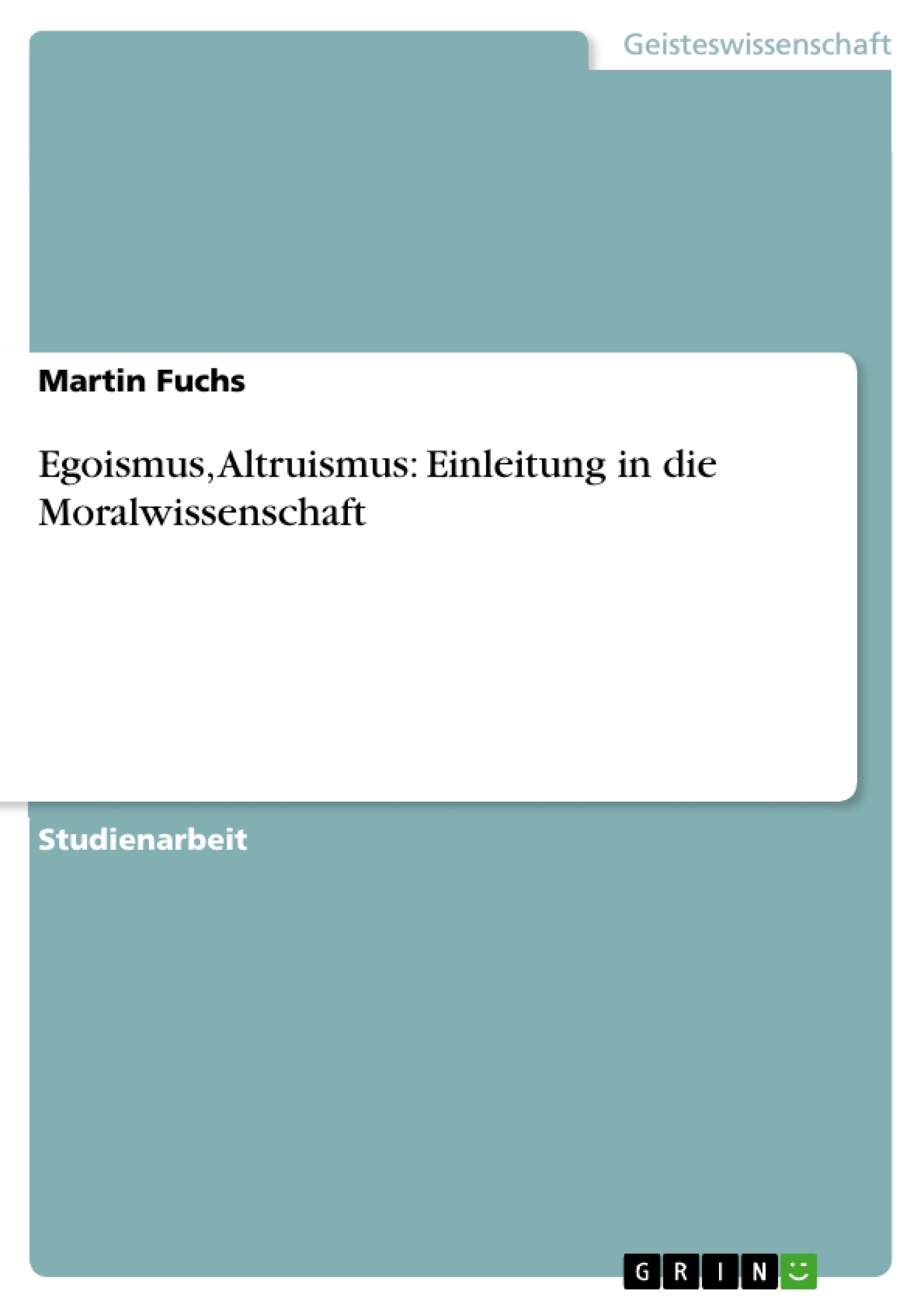Was treibt uns wirklich an? In einer Welt, die von Selbstoptimierung und dem Streben nach persönlichem Erfolg besessen scheint, wirft dieses Buch einen provokativen Blick auf die ewige Frage nach Egoismus und Altruismus. Georg Simmel, einer der Gründerväter der Soziologie, seziert in seiner "Einleitung in die Moralwissenschaft" messerscharf die Triebfedern menschlichen Handelns und entlarvt die vermeintliche Eindeutigkeit dieser beiden scheinbar gegensätzlichen Prinzipien. Erleben Sie, wie Simmel die komplexen Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gesellschaft analysiert, um zu zeigen, dass selbstlos wirkendes Verhalten oft tief in egoistischen Motiven verwurzelt sein kann und umgekehrt. Entdecken Sie, wie kulturelle Normen, soziale Strukturen und die allgegenwärtige "Philosophie des Geldes" unser Verständnis von Moral und Selbstaufopferung prägen. Simmel dekonstruiert gängige Denkmuster und fordert uns heraus, unsere eigenen Wertvorstellungen zu hinterfragen. Ist Altruismus wirklich das Gegenteil von Egoismus, oder sind sie untrennbar miteinander verbunden? Inwieweit beeinflussen gesellschaftliche Zwänge unser moralisches Handeln? Dieses Buch bietet keine einfachen Antworten, sondern eröffnet einen faszinierenden Diskurs über die Natur des Menschen und die Grundlagen unserer Zivilisation. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Philosophie, Soziologie, Ethik und die tieferen Beweggründe unseres Daseins interessieren. Lassen Sie sich von Simmels brillanter Analyse inspirieren und entwickeln Sie ein differenzierteres Verständnis der komplexen Dynamik zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe. Tauchen Sie ein in die Welt der Moralwissenschaft, die bis heute nichts an ihrer Aktualität verloren hat. Eine zeitlose Auseinandersetzung mit den Wurzeln unseres Handelns, die zum Nachdenken anregt und neue Perspektiven eröffnet. Dieses Werk ist ein Muss für jeden, der die Mechanismen unserer Gesellschaft und die Motivationen des Individuums verstehen will. Es bietet eine fundierte Grundlage für ethische Entscheidungen und ein tieferes Verständnis der menschlichen Natur im Spannungsfeld zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohl. Simmels Analyse ist nicht nur von historischem Wert, sondern bietet auch wertvolle Einsichten für die Gestaltung einer gerechteren und humaneren Zukunft, in der Egoismus und Altruismus nicht als Gegensätze, sondern als sich ergänzende Kräfte wirken. Ein zeitgemäßer Klassiker, der zum kritischen Denken anregt und unsere Sicht auf die Welt nachhaltig verändern kann.
Georg Simmel - Einleitung in die Moralwissenschaft Egoismus und Altruismus
1. Einleitende Worte
Georg Simmel erscheint in den letzten Jahren wieder vermehrt im Rampenlicht, seine Werke, die um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden sind und sich durch die Bank großer Aufmerksamkeit erfreuten, wurden in einer Gesamtausgabe neu verlegt und mehrheitlich positiv rezensiert. So sagt der „Spiegel“ am 20. März 2000 in der Einleitung zu einem Artikel über Simmel folgendes: „Lange war er ein Geheimtipp. Nun kommt Georg Simmel, der Pionier der Soziologie, groß heraus. Dank einer Komplett-Edition entdecken Ökonomen, Kunstforscher, Cyber-Planer und Kolumnisten: Die Beobachtungen des unkonventionellen wilhelminischen Gelehrten sind hochaktuell.“ (Spiegel 2000-03-20)
Simmels Werk scheint darüber hinaus auch aktuell zu sein, was allein schon durch die Tatsache, dass „Egoismus und Altruismus“ Gegenstand dieser Arbeit ist, gestützt wird. Ziel dieser Arbeit nun soll es sein, einen Ausschnitt, eben „Egoismus und Altruismus“, ein Kapitel aus Simmels „Einleitung in die Moralwissenschaft“, zusammenzufassen und aus heutiger Sicht zu interpretieren.
2. Biographisches
Georg Simmel wurde am 01.03. 1858 in Berlin geboren und starb am 26.09. 1918 in Straßburg. Er entstammte einer wohlhabenden jüdischen Familie. Wie seine sechs älteren Geschwister wurde auch er evangelisch getauft und in christlichem Sinn erzogen. Nach dem frühen Tod seines Vaters wurde dem Musikverleger Julius Friedländer die Vormundschaft übertragen, der den jungen S. nicht nur umfassend förderte, sondern ihm auch ein kleines Vermögen überschrieb, das Simmel erlaubte, eine akademische Laufbahn einzuschlagen und diese trotz vielfältiger Schwierigkeiten und langer Erfolglosigkeit auch durchzuhalten. Simmel immatrikulierte sich 1867 an der Univ. Berlin und begann das Studium der Geschichte, der Völkerpsychologie, der Philosophie und der Kunstgeschichte. Bereits seine 1881 an der Berliner Universität erfolgte Promotion verlief nicht problemlos. Seine zuerst eingereichte Arbeit „Psychologisch-ethnologische Studien über die Anfänge der Musik“ wurde wegen mangelhafter Beweisführung und thesenhaftiger Argumentation abgelehnt. Nach längeren Auseinandersetzungen wurde schließlich die zusätzlich eingereichte Preisarbeit „Darstellung und Beurteilung von Kants verschiedenen Ansichten über das Wesen der Materie“ als Dissertation angenommen. 1883 bewarb sich Simmel bei der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin mit einer Arbeit über Kants Raum- und Zeitlehre um die Zulassung zur Habilitation. Auch diese wurde zunächst abgelehnt, dann aber auf Betreiben vor allem Wilhelm Diltheys doch noch zugelassen. Obwohl Simmel sich mit seinen Arbeiten „Über sociale Differenzierung“ (1890), „Die Probleme der Geschichtsphilosophie“ (1892) und „Einleitung in die Moralwissenschaft“ (1892/93) früh einen Namen auch im Ausland machte, setzten sich die Schwierigkeiten in seiner akademischen Karriere fort. Erst 1900 wird Simmel wiederum nach längeren Auseinandersetzungen zum Extraordinarius für Sozial- und Geschichtsphilosophie an der Universität Berlin ernannt. Im gleichen Jahr heiratete Simmel Gertrud Kinel, die unter dem Pseudonym Marie Luise Enckendorf zu einer der bedeutendsten Schriftstellerin und Protagonistin der bürgerlichen Frauenbewegung avancierte. Aus dieser Ehe ging der Sohn Hans hervor. Ebenfalls 1900 erschien Simmels „Philosophie des Geldes“, ein Buch, das zusammen mit der 1908 erschienen „»Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung“ seinen Ruf als „Begründer der Wissenschaft der Soziologie“ festigte. Für diese Leistung wurde Simmel 1911 die Ehrendoktorwürde der Staatswissenschaft der Universität Freiburg verliehen, insbesondere seine soziologischen Schriften wurden früh ins Italienische, Französische und Englische übersetzt und er erhielt Angebote, in den USA zu lehren. An der Berliner Universität hingegen wurde Simmel bei Berufungsverfahren mehrfach übergangen. Auch eine von Max Weber und Eberhard Gothein initiierte Berufung an die Universität Heidelberg scheiterte. Die Gründe für diese lange akademische Erfolglosigkeit sind vielfältig. Sicher spielt seine jüdische Herkunft eine Rolle, antisemitische Ressentiments sind in vielen gescheiterten Berufungsverfahren bezeugt. Aber auch seine rhetorische Brillanz, sein unkonventioneller Vortragsstil und seine geistige Unabhängigkeit, die unter anderem dazu führten, dass seine Berliner Vorlesungen als kulturelle Ereignisse gefeiert wurden, müssen genannt werden, weil sie den Neid der etablierten Kollegen schürten. Schließlich ist das Misstrauen gegenüber dem neuen Fach Soziologie zu nennen, das Simmel leidenschaftlich vertrat und dem aufgrund seiner relativistischen Methode eine zersetzende Wirkung unter anderem auf die christliche Religion unterstellt wurde. All dies führte dazu, dass Simmel erst 1914, als 56-Jähriger, einen Ruf auf ein Ordinariat an der Universität Straßburg erhielt, das er bis zu seinem Tod 1918 innehatte. - Simmel gilt neben Max Weber und Ferdinand Tönnies als Gründungsvater der deutschen Soziologie und inzwischen auch - nach seiner Wiederentdeckung in den 80er-Jahren - als Klassiker der „Moderne“, dem in seinen Arbeiten zur Logik, Ästhetik, Kultur- und Religionsphilosophie nicht nur eine umfassende Diagnose der „Signatur seiner Zeit“ gelang, sondern der mit seiner lebensphilosophischen Ethik des „individuellen Gesetzes“ auch einen Weg weisen wollte aus den als „Tragödie der Kultur“ interpretierten Entfremdungserscheinungen der modernen „kapitalistischen Gesellschaft“. Sein Berliner Haus gehörte zu den geistig-kulturellen Zentren Deutschlands, in denen sich Literaten, Künstler und viele jüngere Wissenschaftler wie Friedrich Gundolf, Ernst Bloch, Georg Lukàcs, Max Dessoir, Rainer Maria Rilke, Hermann Kantorowicz, Heinrich Rickert, Edmund Husserl, Stefan George, Bernhard Groethuysen und Max Weber trafen, um in leidenschaftlichen Debatten die Zukunft des modernen Menschen und der modernen Kultur zu erörtern. Simmels grundlegendes Denkprinzip, das alle seine Schriften durchzieht, ist die Idee der Wechselwirkung, der Dialektik von Form und Inhalt als einer „Dialektik ohne Versöhnung“. Seine oftmals als „soziologischer Impressionismus“ bezeichneten Studien über die „Großstadt“, „den Fremden“, die „Mode“, die „Geselligkeit“, das „Verhältnis der Geschlechter“ und vieles andere mehr gelten bis heute als in ihrer Tiefenschärfe unübertroffene Analysen sozialer Formen in der historischen Variabilität ihrer Inhalte. Seinen relativistischen, weil die Gleichrangigkeit aller Kulturerscheinungen betonenden Gedanken der Wechselwirkung zwischen Form und Inhalt übertrug Simmel auch auf die Religion. In seiner Religionsphilosophie und -soziologie lehrte er, dass die Kritik keinen einzigen Inhalt der historischen Religionen bestehen lässt, aber die Religion selbst nicht trifft. Religion ist für Simmel ein Sein der religiösen Seele, eine a priori formende Funktion, und deshalb so wenig zu widerlegen, wie das Sein selbst. Dieses Sein oder diese Funktion, aber nicht der von diesen erst vorstellungsmäßig gebildete Glaubensinhalt, ist der alleinige Träger des religiös-metaphysischen Wertes.
3. Zum besseren Verständnis: „Die Philosophie des Geldes“
Dieses philosophische Werk erschien 1900. In diesem Hauptwerk aus der ersten Periode des Denkens Georg Simmels konvergieren soziologische und geschichtsphilosophische Werke mit seinen Untersuchungen zur Werttheorie und zur „philosophischen Kultur“. Die singuläre Stellung des Buches im Denken der Jahrhundertwende und in der Philosophiegeschichte ergibt sich aus Simmels Begriff des „Konkreten“, der grundlegend für die essayistischen Struktur des Werks ist: Das Geld erscheint als fundamentales „Symbol“ neuzeitlicher Kultur, das die „Ganzheit ihres Sinnes“ vertritt. So wird eine Philosophie des Geldes entwickelt, der alles Ökonomische „Mittel, Material oder Beispiel“ bleibt „für die Darstellung der Beziehungen, die zwischen den äußerlichsten... Erscheinungen und den ideellsten Potenzen des Daseins... bestehen“; die uneingeschränkte Fungibilität des Geldes erscheint andererseits als Spiegelbild eines absoluten Relativismus von Wert und Erkenntnis, als reinster Ausdruck gegenwärtiger Tauschgesellschaft und schließlich als „Symbol für den absoluten Bewegungscharakter der Welt“.
Sosehr Simmel durch sein alternativisches Verfahren gegen Koigens Vorwurf der „Geldapologetik“ geschützt ist, so berechtigt bleibt andererseits Woyslawskis Kennzeichnung dieses Denkens als „Philosophie des kapitalistischen Geistes“. Zwischen der Position des Vorläufers und des traditionellen Philosophen, zwischen Kritik und Rechtfertigung blieb Simmel mit der „Philosophie des Geldes“ ohne direkte Nachfolge, beeinflusst aber (wie durch seine gesamte Philosophie) nachhaltig die zeitgenössische Bildung.
4. „Egoismus und Altruismus“
An ersten Stelle dieses Abschnitts sollen zunächst Definitionen stehen, die die Begriffe „Egoismus“ und Altruismus“ im alltäglichen Gebrauch zeigen, die schlüssig machen sollen, in welcher Begriffdimension sich Simmel damals wie heute lesen lässt. „Egoismus“ steht letztlich heutzutage für eine menschliche Charaktereigenschaft, die dem Individuum zuschreibt, weite Teile seines Handelns auf persönlichen Vorteil zu begründen. Ein „Egoist“ unternimmt alles, damit er persönlich davon profitiert. Dem entgegengestellt steht der Begriff des „Altruismus“, der grundsätzlich jenes Handeln meint, das dem Handlungsträger keinen Gewinn verspricht. Der Altruist handelt, um selbstlos zu helfen, er handelt aus der Überzeugung, Gutes zu tun, und eben nicht, sich selbst zu bereichern.
An dieser Stelle nun betritt Georg Simmel die Bühne und versucht im zweiten Kapitel des ersten Bandes seiner „Einleitung in die Moralwissenschaft“ genau über diese beiden Begriffe zu philosophieren, deren Gehalt ans Tageslicht zu bringen. Bereits früh erkennt er den Missbrauch, der oft mit einschlägigen Begriffen getrieben wird. Seine Arbeit soll Teil des Versuchs sein, mit eben diesem Missbrauch aufzuräumen, die Termini so zu definieren, dass Klarheit herrscht.
Simmel sagt, dass am Beginn jeder moralphilosophischen Betrachtung die Annahme stehe, dass Egoismus der natürliche Ausgangspunkt menschlichen Handelns sei. „Im Anfang war das Ich; und nicht nur zeitlich habe in der Entwicklung der Menschheit und des Menschen der Egoismus den Vortritt vor dem Altruismus, sondern er habe ihn, weil er sachlich das Primäre, der natürlichste und ursprünglichste Trieb alles Lebenden sei.“ (Simmel 1892: 92) Im Weiteren nun geht Simmel auf die Leitbegriffe dieser Art von Prämisse ein. Der Missbrauch, der mit dem Begriff „Natürliches“ getrieben werde, sei Grund vieler Missverständnisse und falscher, weil zu allgemeiner Annahmen. (vgl. Simmel 1892: 92) Er sieht nun zwei Gesichtspunkte, die helfen können, das Verwirrspiel um die Auseinandersetzung zwischen Egoismus einerseits, Altruismus andererseits zu beenden.
Zum einen sieht Simmel einen wichtigen Grund für die falsche Verwendung des Begriffes „Egoismus“ darin, dass dieser als solcher eine weite Verbreitung aufweisen kann. Er sagt, dass das Häufige zumeist über das Seltenen gestellt wird: „Im Denken wie im Empfinden, im Ethischen wie im Ästhetischen erwirbt das Verbreitete, Volksmässige, statistisch Überwiegende den Titel des Natürlichen, und da nun der Altruismus dem Egoismus gegenüber sehr in der Minorität zu bleiben scheint, erregt dieser die Vorstellung, der natürlichere Affekt zu sein.“ Allerdings gesteht Simmel diesem Ansatz keine Allgemeingültigkeit zu. Vielmehr fordert er, dass man bei der Verwendung beider Begriffe zunächst den Hintergrund beleuchten müsse, man sozusagen hinter die Kulissen blicken müsse. Simmel konstatiert ein Zustand wie folgt: Der Altruist handelt, bewusst oder unbewusst, oft aus rein egoistische Motiven. Zudem komme der Umstand, dass es sehr viele „unklare Menschen“ gäbe, die nicht wüssten, wie die Begriffe „Egoismus“ und „Altruismus“ zu verwenden seien, die darüber hinaus diese beiden auch nicht richtig verstünden. (vgl. Simmel 1892: 93) Kompliziert werde es allerdings erst dann, wenn die Verwendung beider Begriffe im Zusammenhang mit sozialen Gruppen passiere. Denn, so Simmel, je intensiver der soziale Kontakt eines Individuums, desto abhängiger sei der Einzelne von der Gruppe, sodass beiden Begriffen eine erhöhte Aufmerksamkeit zukommen müsse. „Hierin liegt die wichtige Erkenntnis, dass die blosse quantitative Ausdehnung der Beziehungen, Interessen, Verbindungen rein als solche schon ein Hebel der Sittlichkeit, über den Egoismus hinweg, wird.“ (Simmel 1892: 95) So muss also eine Kultur, eine Gesellschaft Rahmenbedingungen schaffen, die es möglich machen, dass sich die Ausbreitung des Egoismus zurück entwickelt. Festzuhalten bleibt aber, dass die Interpretation der einzelnen Handlungen nicht außer Acht gelassen werden darf. „Mag der Endzweck noch so sehr ein persönlicher sein - zu den Mitteln müssen wir uns aus uns selbst entfernen.“ (Simmel 1892: 95)
Die Umwelt prägt das Individuum, so weit nichts Neues, Simmel sagt dazu aber, dass die Umwelt eben auch das Verhältnis von „Egoismus“ und „Altruismus“ entscheidend präge, dass der Altruismus eng mit der Arterhaltung zusammenhänge. Hilft dir die Umwelt nicht, was bleibt dir dann noch? Wirst du nicht gefördert, was dann? Außerdem sei es leichter, alles Handeln auf Egoismus zurückzuführen: „Das Egoismusprinzip hat überhaupt als Erklärung wie als praktische Norm etwas sehr Verstandesmässiges und rational Einleuchtendes.“ (Simmel 1892: 97)
Zum anderen sieht Simmel den Grund für Missverständnisse darin, dass der Egoismus als Phänomen zeitlich früher auftrete als der Altruismus. Egoismus kann aber laut Simmel in der gebräuchliche Form erst dann auftauchen, wenn eine menschliche Gesellschaft existiert. Gesellschaft aber funktioniert nur dann, wenn sich der Egoismus auf ein erträgliches Maß zurück zieht. „Damit überhaupt die Zustände sich bilden können, in denen der Mensch als solcher existieren und seinen Egoismus entfalten kann, muss ein gewisses Mass von Altruismus schon vorhanden sein, ganz ebenso wie intellektuell ein Bewusstsein des Ich erst durch Abscheidung und Gegensatz gegen Andere entstehen konnte.“ (Simmel 1892: 98)Altruismus erhält seinen Sinn erst durch die Reibung mit dem Egoismus.
Allerdings macht Simmel darauf aufmerksam, dass die Verwendung der Begriffe „Egoismus“ und „Altruismus“ in anderen Sprachen, Kulturkreisen, vor aller aber auch in anderen Zeiten anderen Normen unterliege. Er nennt als Beispiel das Verhältnis zwischen reichen, mächtigen Menschen und „armen Schluckern“ in Zeiten, in denen sich Moral durch die herrschende Klasse definierte, dass der Arme als moralisches Vorbild beispielsweise einen verkommen absoluten Fürsten vor sich hatte, der sagte, was Moral sei. Dieses Problem erübrige sich laut Simmel in dem Moment, in dem breite Bevölkerungsschichten gesellschaftliche Relevanz erlangen. Simmel entkräftet die Vermutung, dass das zeitliche frühere Eintreten des Egoismus für dessen Dominanz oder Wichtigkeit stünden, mit einem weiteren Vergleich: Er sagt, mit dem Egoismus und dem Altruismus sei es wie mit dem Hunger und dem Geschlechtstrieb. Ein Phänomen erscheine vor dem anderen, sei aber deswegen nicht als wichtiger. Menschlich seien alle angeführten Begriffe in jedem Fall. Simmel stellt im Weiteren die Frage, ob das Frühere unzulänglicher sei als das später Eintretende. Er beantwortet diese Frage mit einem Nein, indem er, wie oben schon gesagt, alle Phänomene als menschlich bezeichnet, dass die zeitliche Reihenfolge des Eintretens keine Rolle für die Wertung der Begriffe spielen soll.
„Denn das muss hier nochmals hervorgehoben werden, dass der Gegensatz zwischen der Natur und der Vernunft - derart, dass die erstere dem Egoismus, die letztere der Sittlichkeit entspräche - absolut nicht diejenige Aufklärung bringt, die die bisherige Ethik fast durchgehendes von ihm erwartet.“ (Simmel 1892: 103) Inwiefern spielt nun „Sinnlichkeit“ eine Rolle für die Bewertung der Begriffe „Egoismus“ und „Altruismus“, für die Handlungen des Individuums? „Über die Beziehung der Sinnlichkeit zum Egoismus will ich nur folgendes bemerken. Wenn die Erregung gewisser Sinnesempfindungen in mir den Endzweck meines Handelns bildet, über den ich nicht hinausfrage, so ist wohl kein Zweifel, dass ein solches Handeln egoistisch heissen darf. Allein darum ist die Umkehrung noch nicht richtig, dass alles egoistische Handeln den Charakter der Sinnlichkeit trüge. Kant hat richtig darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn man einmal die eigene Lust zum Zweck des Handelns macht, das Mittel für sie an und für sich und abgesehen von seinen sonstigen Wirkungen sittlich gleichgültig wäre. Ob man also in den groben Empfindungen der Sinne oder in den feineren Genüssen der Vernunft sein Vergnügen finde, mache prinzipiell keinen Unterschied.“ (Simmel 1892: 107f) Der Vergleich mit Kant überrascht nicht, ist Simmel nicht nachhaltig von ihm beeinflusst. „Wie die Versuchung im Allgemeinen, so wird die Sinnlichkeit im Besonderen als eine ausserhalb des eigentlichen Ich gelegene Potenz vorgestellt, die sich partikularistisch durchzusetzen sucht und dies in dem Masse erreicht, in dem ihre für sich bestehende Kraft grösser ist als die der vernünftigen Seele; die leichter erkennbaren Beziehungen zum Körper, die die Sinnlichkeit anderen Seelenfunktionen gegenüber zeigt, erleichtern diese Abtrennung ihrer von dem Ich und ihre Entgegensetzung gegen dieses.“ (Simmel 1892: 108) Wenn man Egoismus nun als fundamentale Tatsache anerkennt, dann muss das Handeln, das in der Verneinung des Egoismus besteht, als metaphysisches Rätsel angesehen werden. Eine Ausnahme dieser Annahme besteht laut Simmel nur dann, wenn aller Altruismus dem Egoismus diene.
Simmel rügt auch den Irrglauben, dass Egoismus gegenüber dem Altruismus etwas Einfaches sei. Zudem sagt er, dass etwas, nur weil einfach sein soll, noch lange nicht richtig ist. Was aber ist einfach, was kompliziert? Dazu kommt, unter dem Einfluss Darwins, das die Befriedigung eines Triebs nie „selbstverständlich, analytisch oder rein logisch“ sei, sondern vielmehr „stets als erlernt, erworben, angezüchtet“ angesehen werden muss. (vgl. Simmel 1892: 113) An dieser Stelle zieht Simmel Vergleich mit dem Tierreich, die heute vielleicht als nicht mehr ganz treffen zu werten sind.
Im Weiteren macht sich Simmel Gedanken zum Thema Altruismus: „Dies hängt vielleicht mit der Entstehungsweise der Moral durch äussern Zwang zusammen; zuerst war es ein enger Kreis, der nur darauf hielt, dass sich Individuum gegen Individuum sittlich betrug; dann erfolgten Vergrösserungen, welche diese Kreise als Sozialindividuen in sich schlossen und sie einem Zwänge unterstellten, der zu moralischer Gerichtsbarkeit auswuchs usf.“ (Simmel 1892: 122) Moral entsteht durch äußeren Zwang. Simmel zieht einen Vergleich zur Liebe: Wenn Liebe Egoismus zu zweit ist, dann ist Sittlichkeit (entspricht hier wohl am ehesten dem Altruismus) Egoismus zu allen. So zeige der Sieger dem Unterlegenen gegenüber versöhnliche Gefühle, man hat Symphatie für Schwächere.
Zum Abschluss seiner Überlegungen zum Thema formuliert Simmel folgendes: „Es liesse sich prinzipiell in Abrede stellen, dass der Egoismus dasjenige ist, was schlechthin nicht sein soll, der Altruismus das, was sein soll. Man könnte etwa behaupten, das klassische Altertum sei ganz und gar egoistisch gewesen, es habe den Altruismus als Selbstzweck nicht gekannt, und alle patriotische Hingebung sei entweder ein sozialer Zwang gewesen, der zwar zum selbständigen Triebe geworden sei, aber doch höchstens einen Indifferenzzustand zwischen Egoismus und Altruismus dargestellt habe, während jedenfalls die Gruppe als solche den höchsten Egoismus besessen habe; oder diese Hingabe sei nur ein Umweg des Egoismus gewesen, der bei der Kleinheit der Gruppe und der Unmittelbarkeit, mit der ihre Förderung dem Einzelnen zu gute kam, sich vermöge dieser letzteren selbst am besten gestanden habe.“ (Simmel 1892: 126)
Simmel bemerkt auch mit einem Seitenhieb auf das Christentum, dass dieses die Moral zum Prinzip erhebe, was zur Folge hat, dass Kultur und Tradition in unseren Breiten ja geradezu vorbestimmt sind für den Konflikt zwischen Egoismus und Altruismus.
Außerdem stehe der naturwissenschaftlichen Methode zum Beweis der „Alleinherrschaft“ des Egoismus entgegen, dass alles „meine“ Vorstellungen seien, dass, so Simmel, alles „meine“ Welt, „mein“ Empfinden sei. Jeder habe so seine eigenen Ansätze zur Interpretation der Begriffe „Egoismus“ und „Altruismus“. (vgl. Simmel 1892: 131f.) Eine allgemeingültige Aussage sei somit sehr schwer zutreffen, wenn nicht sogar unmöglich. Egoismus kann nicht allein existieren, denn er mach nur Sinn, wenn auch Altruismus, also das Gegenteil, vorahnden ist. „So haben auf theoretischem Gebiet Descartes und Kant aus der gleichen Tatsache: eine Welt wird vorgestellt, das absolut Entgegengesetzte gefolgert; jener: also existiert der vorstellende Geist, aber über sein Objekt ist dadurch noch nichts ausgemacht; dieser: also existiert diese Welt, aber über den vorstellenden Geist ist dadurch noch nichts ausgemacht. Wir sehen hier recht, wie wenig monistische Vorstellungen uns zu realen Erkenntnissen verhelfen; es bleibt eben alles beim Alten, wenn ich das in Frage stehende Gebiet in seiner Gesamtheit einheitlich charakterisiere, und es ist nur Sache der Betonung, durch welchen der verschiedenen in dieser Alleinheit inbegriffenen Bestandteile ich ihm eine Färbung nach der einen oder der anderen Seite hin erteilen will.“ (Simmel 1892: 132)
Der Ich-Begriff wird zuallerletzt noch als das Wichtigste herausgearbeitet. „Der Mensch ist ein so wenig einheitliches Wesen, so viele Triebe, Bedürfnisse, Ideale, erfüllen ihn in jedem Augenblick, dass der Egoismus schlechthin ein ganz hohler Allgemeinbegriff ist. Wie die Einsicht in jenen Charakter des Ich die theoretische Philosophie zu dem Verzichte darauf geführt hat, aus dem Begriff des Ich irgend eine reale Eigenschaft der denkenden Substanz erschliessen zu wollen, so muss sie uns auch zeigen, dass kein reales Ziel der praktischen Bestrebung aus ihm herauszuerkennen ist.“ (Simmel 1892: 137)
Zuletzt soll noch einmal Georg Simmel selbst zu Wort kommen: „Wenn wir, von der begrifflichen Unklarheit des Egoismus absehend, auch zugeben wollten, dass er die alleinige Wurzel alles psychischen Lebens, zeitlich und sachlich die Grundlage sei, auf die alles Handeln zurückweist, so wäre es doch ein gründlicher psychologischer Irrtum, im Bewusstsein des Handelnden in jedem Fall irgendwo versteckte egoistische Triebfedern aufsuchen zu wollen. Denn wenn auch die Sorge für die Interessen des Anderen, die Aufopferung des Ich für andere Ichs und für die Gesamtheit, die Bezähmung der rücksichtslosen Triebe zunächst nur Mittel und Umwege für den Egoismus gewesen sein sollten, so macht sich hier doch jene höchst weitgehende und folgenreiche Eigenschaft des menschlichen Geistes geltend, derzufolge ihm, was ursprünglich nur Mittel war, zum Zweck auswächst. Dasjenige, was nur mit Rücksicht auf damit zu erreichende Zwecke Sinn und Bedeutung hatte, streift unzählige Male diese Beziehung ab und stellt sich als Ziel dar, das nur um seiner selbst willen erreicht werden soll; alle äussere Sitte z. B. gewinnt allein durch diesen Prozess die Kraft, an und für sich als sittliche Vorschrift aufzutreten, da sie doch ursprünglich nur das Mittel oder die Bedingung fernerliegender sozialer Zwecke war.“ (Simmel 1892: 147)
„Der Egoist will, was er will. Sittlichkeit soll, was sie soll.“ (Simmel 1892: 146)
Hier endet die zu bearbeitende Stelle aus Simmels „Einleitung in die Moralwissenschaft.
5. Abschließende Bemerkungen
An sich ist es nicht verwunderlich, dass Georg Simmel seine Renaissance erleben darf. Seine Gedanken zum Thema „Egoismus und Altruismus“ erwecken zum Teil den Eindruck, recht aktuell zu sein. In unserer heutigen Konsumgesellschaft mit all ihren Ausprägungen steht der Begriff des Egoismus in vorderster Front. Karriere- und Lebensplanung beschreiben das Leben vieler erfolgsorientierter Menschen. Wenn diese allerdings auf ein gesundes Maß am Egoismus verzichten, so muss festgehalten werden, dass ihre Chancen in einer Leistungsgesellschaft nicht als zielführend bezeichnet werden können. Egoismus wird von selbsternannten „Gurus“ als Erfolgsprinzip Nummer eins verkauft, und nicht wenige glauben diesen Worten. Unterstützt wird diese Einstellung auch von Idealbildern, die uns durch viele Bilder aus diversen Medien nahe gebracht werden sollen. Erfolg durch Egoismus - dies könnte wohl das Motto der westlichen Industrienationen unserer Zeit sein.
Simmels Kontrapunkt, der Altruismus, kommt allerdings auch nicht zu kurz, wenn allerdings auch gesagt sein muss, dass viele Menschen und Institutionen aus reinem Selbstzweck, also eigentlich egoistisch, handeln. Hier zeigt sich die Richtigkeit Simmels Ansatz. Haltungen und Wertvorstellungen zu hinterfragen, Definitionen zu kritisieren, Oberflächliches zu analysieren - diese Kernaussage Simmels trifft heute genauso zu wie vor 100 Jahren. Dass sich mit Altruismus Geld verdienen lässt, steht außer Zweifel, ebenso die Tatsache, dass es genug Menschen gibt, die handeln, ohne auf ihren Profit zu achten.
Unter dem Strich ergibt sich aber in jedem Fall die Aktualität Simmels Gedankenwelt. Seine Ansätze sind vielleicht im Detail zu überdenken, man führe sich die häufigen Vergleiche mit dem Tierreich vor Augen, auch hat das Christentum in unseren Breiten nicht mehr den Einfluss vergangener Tage, allerdings ist kaum eine Zeit vorstellbar, in der der Dualismus Egoismus-Altruismus so brennend interessant war wie heute. Frei nach dem Motto: Egoist sucht Altruist zwecks ausgleichender Ergänzung erfolgs- und zielorientierter Verbindung sich ergänzender Eigenschaften.
6. Literaturliste:
Simmel, Georg. 1989. Philosophie des Geldes. Frankfurt a. Main: Suhrkamp
Simmel, Georg. 1. Auflage 1892. Einleitung in die Moralwissenschaft. Eine Kritik der ethischen Grundbegriffe. Erster Band - Gesamtausgabe Band 3. Frankfurt a. Main: Suhrkamp
Spiegel, Artikel. 2000-03-20
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Georg Simmels "Einleitung in die Moralwissenschaft Egoismus und Altruismus"?
Das Hauptthema ist eine philosophische Auseinandersetzung mit den Begriffen Egoismus und Altruismus, wobei Georg Simmel die vorherrschenden Definitionen hinterfragt, den potenziellen Missbrauch dieser Termini aufzeigt und versucht, eine klarere und differenziertere Perspektive auf die beiden Konzepte zu entwickeln. Er untersucht, inwieweit Egoismus als natürlicher Ausgangspunkt menschlichen Handelns betrachtet werden kann und wie Altruismus durch soziale Interaktionen und kulturelle Einflüsse geformt wird.
Wer war Georg Simmel?
Georg Simmel (1858-1918) war ein deutscher Philosoph und Soziologe, der als einer der Gründerväter der deutschen Soziologie gilt. Er war bekannt für seine Analysen moderner Gesellschaft und Kultur, insbesondere für seine Arbeiten zur Philosophie des Geldes, zur Soziologie und zu verschiedenen sozialen Formen wie Großstadt, Fremder und Mode.
Was sind die wichtigsten Punkte in Simmels Analyse des Egoismus?
Simmel argumentiert, dass der Begriff Egoismus oft missverstanden und überstrapaziert wird. Er kritisiert die Vorstellung, dass Egoismus immer natürlich oder einfach ist. Stattdessen betont er, dass Egoismus nur im Kontext einer Gesellschaft existieren kann und dass ein gewisses Maß an Altruismus erforderlich ist, damit Egoismus überhaupt eine Bedeutung haben kann. Er untersucht auch die Rolle der Sinnlichkeit und des Verstandes im Zusammenhang mit egoistischem Handeln.
Was sind die wichtigsten Punkte in Simmels Analyse des Altruismus?
Simmel sieht Altruismus nicht als das absolute Gegenteil von Egoismus, sondern als ein Phänomen, das oft mit egoistischen Motiven verbunden sein kann. Er betont die Bedeutung sozialer Bedingungen und kultureller Normen für die Entwicklung altruistischen Verhaltens. Simmel argumentiert, dass Altruismus oft aus der Notwendigkeit der Arterhaltung oder aus sozialen Zwängen entsteht. Er untersucht auch die Rolle der Moral und des Mitgefühls im Zusammenhang mit altruistischem Handeln.
Welche Rolle spielt der Begriff "Natur" in Simmels Analyse?
Simmel kritisiert die naive Verwendung des Begriffs "Natur" in moralphilosophischen Diskussionen. Er argumentiert, dass das, was als natürlich angesehen wird, oft durch soziale Konventionen und statistische Häufigkeit bestimmt wird, und dass dies zu falschen Annahmen über Egoismus und Altruismus führen kann. Er fordert eine differenziertere Betrachtung der Hintergründe und Motive, die menschlichem Handeln zugrunde liegen.
Welchen Einfluss hatte Simmels "Philosophie des Geldes" auf seine Sichtweise auf Egoismus und Altruismus?
Simmels "Philosophie des Geldes" untersucht die Auswirkungen des Geldes auf moderne Gesellschaften. Das Geld, als ein reines Tauschmittel und Symbol für Relativismus, spiegelt die Dynamik von Egoismus und Altruismus wider. Das Werk zeigt, wie wirtschaftliche Strukturen die Beziehungen zwischen Individuen beeinflussen und wie die Verfolgung egoistischer Ziele durch den Austauschprozess geformt werden kann. Die fungible Natur des Geldes spiegelt sich in der Flexibilität und den potenziellen Umwegen wider, die Menschen nehmen, um ihre egoistischen oder altruistischen Ziele zu erreichen.
Wie bewertet Simmel die Rolle des Christentums in der Debatte um Egoismus und Altruismus?
Simmel deutet an, dass das Christentum, indem es die Moral zu einem Prinzip erhebt, eine Umgebung schafft, in der der Konflikt zwischen Egoismus und Altruismus besonders ausgeprägt ist. Er bemerkt, dass diese Betonung der Moral unsere Kultur und Traditionen für diesen Konflikt prädestiniert.
Was ist das Fazit von Simmels Untersuchung von Egoismus und Altruismus?
Simmel kommt zu dem Schluss, dass Egoismus und Altruismus komplexe und miteinander verwobene Phänomene sind, die nicht einfach als Gegensätze betrachtet werden können. Er betont, dass das Verständnis dieser Begriffe eine kritische Auseinandersetzung mit den vorherrschenden Definitionen und eine Berücksichtigung der sozialen, kulturellen und historischen Kontexte erfordert. Er betont auch die Bedeutung des "Ich"-Begriffs als zentralen Punkt für das Verständnis menschlichen Handelns.
Warum ist Simmels Werk heute noch relevant?
Simmels Werk ist heute noch relevant, weil seine Gedanken zur Dialektik von Egoismus und Altruismus in der modernen Konsumgesellschaft immer noch von Bedeutung sind. Die Balance zwischen persönlichem Vorteil und sozialer Verantwortung ist ein anhaltendes Thema, das in einer globalisierten Welt mit ihren komplexen wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen weiter an Bedeutung gewinnt. Simmels analytische Herangehensweise, die zur Hinterfragung von Annahmen und zur Analyse von Oberflächenstrukturen auffordert, bleibt aktuell und wertvoll.
- Arbeit zitieren
- Martin Fuchs (Autor:in), 2001, Egoismus, Altruismus: Einleitung in die Moralwissenschaft, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103468