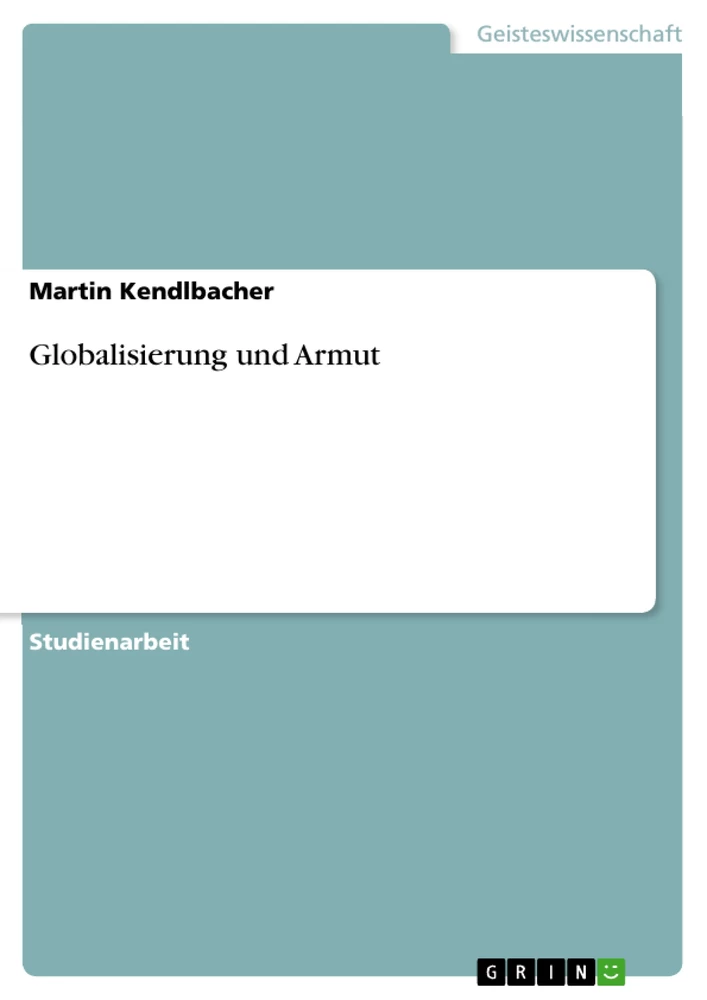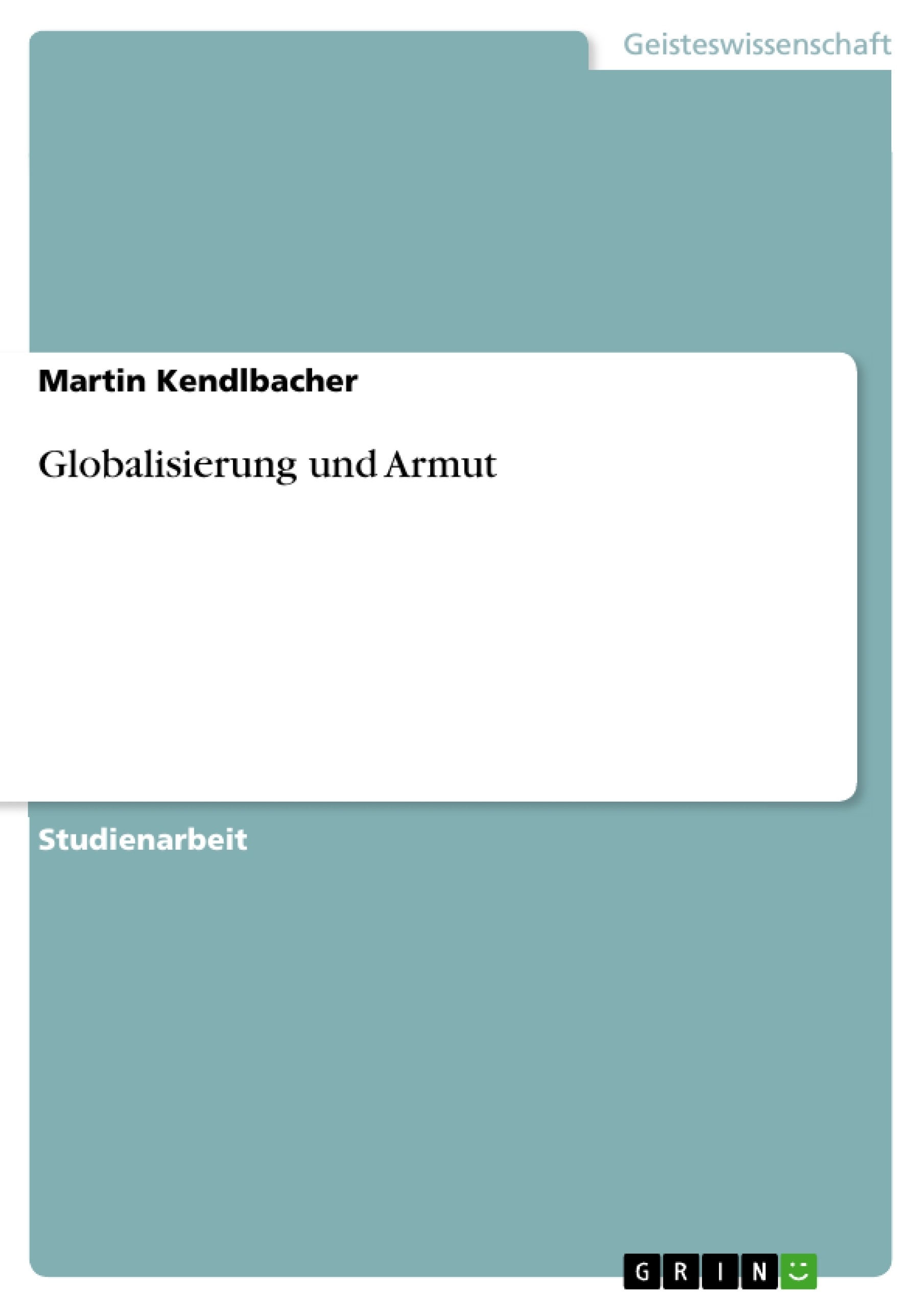Was, wenn die Globalisierung nicht der erhoffte Schlüssel zu weltweitem Wohlstand ist, sondern eine treibende Kraft für Ungleichheit und Armut? Diese brisante Frage steht im Zentrum dieser Analyse der komplexen Zusammenhänge zwischen Globalisierung, Wirtschaftswachstum und sozialer Gerechtigkeit. Die Untersuchung beleuchtet die vielschichtigen Ursachen und Folgen der Globalisierung, von den Gewinnern in den aufstrebenden Wirtschaftsnationen und den Industrieländern bis zu den Verlierern in der Dritten Welt und den zunehmend prekären Arbeitsmärkten der entwickelten Länder. Dabei werden die Mechanismen aufgedeckt, die zu einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich führen, und die Rolle von internationalen Organisationen wie der WTO kritisch hinterfragt. Es wird untersucht, wie die Verlagerung von Produktionsprozessen in Billiglohnländer, die Deregulierung der Märkte und der Abbau sozialer Sicherungssysteme die Armut verstärken und die Existenzgrundlage von Millionen Menschen bedrohen. Doch die Analyse bleibt nicht bei der Problembeschreibung stehen, sondern zeigt auch Lösungsansätze auf, wie die Globalisierung gestaltet werden kann, um soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Es werden konkrete Maßnahmen wie der Erlass von Schulden, die Einführung von Sozialstandards und die Förderung von Bildung und Wissen diskutiert, um allen Menschen die gleichen Chancen zu ermöglichen, am globalen Wirtschaftsprozess teilzunehmen. Abschließend wagt die Analyse einen Blick in die Zukunft und plädiert für ein Umdenken, das den universellen Gedanken der Gemeinsamkeit in den Vordergrund stellt und den Einfluss der wenigen Mächtigen zugunsten der Gemeinschaft schwächt. Eine engagierte Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Globalisierung, die zum Handeln auffordert und eine Vision für eine gerechtere Welt entwirft, in der die Chancen allen Menschen offenstehen und die Früchte des Fortschritts nicht nur wenigen Unternehmern, sondern der gesamten Menschheit gehören. Schlüsselwörter: Globalisierung, Armut, Ungleichheit, Welthandel, soziale Gerechtigkeit, Entwicklungsländer, Arbeitslosigkeit, WTO, Sozialstandards, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Zukunft.
Armut durch Globalisierung?
Gliederung:
1. Globalisierung
1.1. Globalisierung heute - ein Überblick
1.2. Ursachen der „neuen Globalisierung
1.3. Folgen der Globalisierung
1.3.1. Die Gewinner
1.3.2. Die Verlierer
2. Armut
2.1. Mehr Armut durch Globalisierung?
2.2. Wie kann Globalisierung gestaltet werden?
2.3. Eine Prognose & persönliches Statement
1. Globalisierung
Unter Globalisierung kann man heutzutage die Intensivierung transnationaler Beziehungen in verschiedenen Bereichen (Ökonomie, Politik, Kultur, Kommunikation, Ökologie u.a.) verstehen mit einer Dynamik an wirtschaftlicher Verflechtung in der Welt, wie es sie nie zuvor gegeben hat.
1.1.Globalisierung heute - ein Überblick
Das marktwirtschaftliche System hat sich mittlerweile weltweit durchgesetzt und es wird für uns zunehmend wichtiger, was in den anderen Teilen der Welt passiert. Die Expansion des Welthandels mit Gütern und Dienstleistungen schreitet durch die immer stärkere räumliche Vernetzung und zeitliche Verdichtung der Entwicklungen mit enormem Tempo voran. Die „Global Players“, große transnationale Konzerne und Dienstleistungsunternehmen, gewinnen durch neue Zusammenschlüsse (wie z.B. Daimler Benz oder Chrysler) zunehmend an Macht und Bedeutung und werden immer unabhängiger von Nationalstaaten, die im Gegenzug mehr und mehr an Einfluss verlieren. Globale Finanztransfers haben auf Grund der weltweit wachsenden und deregulierten Finanzmärkte immer größere Ausmaße und Dynamik und beeinflussen dadurch immer stärker Marktwirtschaften kleinerer Staaten. Globalisierung spielt sich in vielen Bereichen unseres Lebens ab, sie ist nicht mehr nur auf die Internationalisierung der Wirtschaft bezogen: Die rasante Entwicklung der Kommuniktionstechniken ermöglicht einen weltweiten Transfer von Informationen und Wissen, Fernreisen werden immer günstiger und durch Migration und Verlagerung der Arbeitsplätze gibt es immer mehr „Grenzüberschreitungen“, wodurch eine Vermischung der Kulturen unausweichlich wird. Der Prozess der Globalisierung hat eine Eigendynamik entwickelt, durch die eine Steuerung nicht mehr möglich ist. Nur durch den Einfluss weniger Mächtiger kann noch eine tendenzielle Beeinflussung dieses Phänomens bewirkt werden.
1.2.Ursachen der „neuen Globalisierung„
Wesentlich vorangetrieben wurde die Globalisierung in den achtziger und neunziger Jahren durch weltweite Veränderungen im Verhältnis der Staaten untereinander und durch grundlegende politische Entscheidungen der Regierungen. Als Folge daraus können industrielle Produktionsprozesse zunehmend auf internationaler Basis ablaufen, wodurch sich große Unternehmen der nationalen Arbeitsmärkte und Sozialsysteme entziehen können, Kapital und Arbeit gewinnt an Ortlosigkeit. Gleichzeitig verliert nationale Politik immer mehr an Bedeutung und gerät im internationalen Wettbewerb um Investitionskapital unter Druck, da es keine internationalen Regelmechanismen zur Kontrolle wirtschaftlicher Entscheidungen gibt, wie sie auf nationaler Ebene (Parlamente oder Tarifvereinbarungen) vorhanden sind. Neue Technologien, Internet, Mobiltelefone, E-Mail und Mediennetzwerke sowie die immer günstiger werdenden Transporttechnologien erleichtern und beschleunigen den weltweiten Güter- und Informationsaustausch und treiben die internationale Vernetzung der Produktionsprozesse voran. Ein weltweiter Dienstleistungsmarkt entsteht, da durch neue Kommunikationstechnologien eine Verortung von Arbeitsplätzen immer weniger wichtig wird. So übernehmen z.B. Softwarespezialisten in Indien via Datenleitung die Fernwartung von EDV- Programmen in Deutschland. Globalisierung wird auch durch zahlreiche nationale und internationale Netzwerke von Nichtregierungsorganisationen, die sich in den letzten Jahrzehnten gebildet haben vorangetrieben, die sich global für soziale Gerechtigkeit, die Sicherung natürlicher Ressourcen, für humanitäre Hilfe oder die Menschenrechte einsetzten und deren Beteiligung an Weltkonferenzen nicht mehr wegzudenken ist. Diese internationalen Prozesse, die auf verschiedenen Ebenen des alltäglichen Lebens in unserer Gesellschaft ablaufen sind die Hauptursachen für eine immer weiter fortschreitende Vernetzung unseres Planeten, eine weltweite Gemeinschaft, an der immer mehr Menschen teilhaben werden, entsteht...
1.3.Folgen der Globalisierung
Viele Folgen dieses sich eigendynamisch weiterentwickelnden, globalen Prozesses konnten und können nicht vorausgesehen werden. So gibt es, wie überall, positive und negative Aspekte: Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Globalisierungsprozess die Kluft zwischen Arm und Reich weiter voranzutreiben scheint. Die Einkommensunterschiede sowohl zwischen den Staaten als auch innerhalb - auch innerhalb der Industrieländer- ist größer geworden. Die Reichen sind somit reicher, die Armen ärmer. Nach dem „Bericht der menschlichen Entwicklung„ (Human Development Report 1999) von UNDP verfügen die drei reichsten Menschen über ein Vermögen, das größer ist als das gesamte Bruttoinlandsprodukt aller am wenigsten entwickelten Länder mit ihren 600 000000 Einwohnern zusammen. Das reichste Fünftel der Welt hatte 1960 ein dreißig mal höheres Einkommen als das ärmste Fünftel, 1997 ist deren Einkommen sogar vierundsiebzig mal so hoch. In Afrika südlich der Sahara ist das Pro-Kopf Einkommen heute niedriger als 1970. Durch die niedrigen Weltmarktpreise im Agrarsektor wird die Verarmung weiter vorangetrieben: Einerseits müssen arme Länder mehr Geld für Importe wie Maschinen, Erdöl usw. ausgeben, andererseits verdienen sie immer weniger an ihren Exporten. Ein ständiger wirtschaftlicher Aderlass ist die Folge. In Sozialleistungen, schulische Bildung oder den Ausbau eines funktionierenden Gesundheitssystems kann immer weniger investiert werden. Es sind aber auch positive Auswirkungen festzustellen. So ist es möglich geworden, an fast jedem Ort dieser Erde, dank Internet, an das gesammelte Wissen der Menschheit bzw. an jegliche Art von Informationen zu gelangen, wodurch eine global bessere Bildung aller Menschen realisierbar wird. Durch die selbstverständlich gewordene Nutzung technischer Neuerungen von breiten Bevölkerungsschichten können Millionen von Menschen ihren Lebensstandard erhöhen. Nicht zuletzt durch diesen Wandel entstand enormer gesellschaftlicher Druck für Demokratisierung - oft mit großem Erfolg, wie die Beispiele Südkorea, Taiwan oder Thailand zeigen. Wenn durch Wissen tatsächlich Einfluss, Macht und Möglichkeiten für den einzelnen geschaffen werden, sich am weltweiten Markt zu beteiligen, ist der Prozess der Globalisierung eine einzigartige Chance, dies allen Menschen zu ermöglichen.
1.3.1. Die Gewinner
Zu den Gewinnern gehören die Schwellenländer mit ihrer hohen Attraktivität für Auslandsinvestitionen, die sich am Weltmarkt mit ihren Produktionsgütern beteiligen können. Auch höherqualifizierte Fachkräfte (z.B. in der indischen Softwareindustrie) stehen auf der Gewinnerseite. Jedoch der größte Nutzen konzentriert sich auf die Industrieländer, die am meisten an den Folgen des weltweiten Globalisierungsprozesses profitieren.
1.3.2. Die Verlierer
Die Verlierer sind die „Dritte Welt„ Länder, deren Wirtschaft auf Grund der immer härteren Konkurrenz auf dem Weltmarkt nicht teilnehmen kann. Aber auch in den „Industrieländern„ gibt es Verlierer. Durch die Verlagerung vieler Produktionsprozesse in Billiglohnländer steigt der Anteil der Arbeitslosen stetig, viele Investitoren wandern ins Ausland ab und kleine Unternehmen können dem steigenden Druck der mächtigen Großkonzerne nicht mehr standhalten und müssen Konkurs anmelden.
2. Armut
Es entsteht der Eindruck dass der Globalisierungsprozess die weltweite Armut eher fördert als zu deren Abbau beiträgt. Um mit dem Begriff „Armut“ arbeiten zu können, bedarf es einer Einteilung in Kategorien um ein gewisses Maß an Orientierung zu schaffen:
- Absolute Armut: heißt die unzureichende Mittelausstattung zur Befriedigung der lebenswichtigen Grundbedürfnisse. Als Richtlinie wird hier die Verfügbarkeit von 1 US $ pro Tag angegeben.
- Relative Armut: heißt die Unterversorgung mit materiellen und immateriellen Ressourcen im Verhältnis zum Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft, was bedeutet, dass weniger als 50% des durchschnittlichen Einkommens einer Person zur Verfügung stehen.
2.1. Mehr Armut durch Globalisierung?
In den letzten Jahrzehnten hat die relative Armut, also die Ungleichheit der Menschen untereinander stark zugenommen. Dies ist immer im Verhältnis zu den jeweiligen Staaten zu sehen. Die absolute Armut ist nämlich weltweit weniger geworden. Lebenserwartung und Alphabetisierungsraten sind deutlich gestiegen, die Sterblichkeitsrate bei Säuglingen ist weitaus geringer als noch vor zwanzig Jahren. Hier sind gro0artige Erfolge zu verzeichnen. Woran liegt es dann, dass sich der Reichtum auf immer weniger Menschen verteilt? Die Ursachen der „neuen Armut“ sind oft sehr komplex und vielschichtig. Viele verschiedene Aspekte spielen eine Rolle und es kommt oft erst zu einer Verschlimmerung der Armut, wenn sie zusammentreffen. Der Globalisierungsprozess hat neben seinen phantastischen Möglichkeiten, die er der Menschheit bietet, viel zur weltweiten Steigerung der relativen Armut beigetragen: Durch die Öffnung der Märkte gelingt es Unternehmen, sich sozialer und wirtschaftlicher Sicherungssysteme zu entziehen. Darunter leiden sie Sozialsysteme westlicher Industriestaaten, die durch Sparmassnahmen die Leistungen weiter schmälern. Der allgemeine Reichtum dieser Errungenschaften wird aufgegeben. Private Vorsorge schmälert das Einkommen der Bevölkerung, die im Verhältnis immer weniger Vermögen zur Verfügung hat.
Große Unternehmen können sich weltweit der billigsten Arbeitskräfte bedienen, die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, sind meist egal. Dies passiert auf Kosten von Arbeitnehmern in Industrieländern. Produktionsstätten werden in Billiglohnländer verlegt, und die dort noch günstiger hergestellten Waren wieder reimportiert. Vor allem kleine und mittelständische Betriebe müssen auf diese Weise Konkurs anmelden, weil sie dem Druck dieser brutalen Wirtschaft nicht standhalten können. So verlieren sowohl Arbeitnehmer von großen Arbeitgebern, als auch die in Konkurrenz stehenden kleineren Betriebe ihre Existenzgrundlage. Die Arbeitslosigkeit wächst in den Industriestaaten erschreckend schnell. In vielen nordamerikanischen Städten, aber auch schon in Europa ist auf Grund der immer größer werdenden Zahl von Arbeitslosen eine Ghettobildung ähnlich wie in den Ländern der „Dritten Welt„ zu beobachten.
Auch die Binnenmärkte der Entwicklungsländer sind stark beeinträchtigt. So ist die Kleiderproduktion südlich der Sahara fast völlig verschwunden, statt dessen werden containerweise Altkleider aus der westlichen Welt importiert. Durch Warendumping und der Liberalisierung von Importen werden Arbeitsmärkte des informellen Sektors (z.B. Herstellung von Produkten im eigenen Dorf), der eine wichtige Rolle in der Beschaffung von Arbeitsplätzen spielt, zerstört. Die Überproduktion von Konsumgütern ist weltweit gegeben. Ihr gegenüber steht ein immer schwächer werdendes Konsumentenpotential auf Grund der wachsenden Arbeitslosigkeit. Auf diesem Markt können nur noch Unternehmen überleben, die die beste Technologie oder die fortschrittlichsten Maschinen einsetzten, bzw. die die billigsten Löhne zahlen. Ein Kreislauf entsteht, der die relative Armut weiter vorantreibt und den Gewinn auf wenige Beteiligte verteilt. Große Konzerne können sich auf Grund der Regeln der WTO (Welthandelsorganisation) über die Deregulierung des Handels multinational zusammenschließen und dann lokale Märkte durchdringen um dadurch Kontrolle über praktisch alle Bereiche der nationalen Industrie des jeweiligen Landes zu bekommen. Wenn nun diese Entwicklungen zusammentreffen mit anderen Gegebenheiten, wie z. B. einer korrupten Regierung, Krieg , Umweltkatastrophen u.ä. ist verständlich, wieso sich die globale, relative Armut in so einem Tempo weiter verbreitet und der „Club der Milliardäre„ immer größer wird.
Zusammengefasst kann man sagen: Auf Grund der Globalisierungsphänomens ist es möglich, dass in vielen Sektoren der Wirtschaft eine Rationalisierung von Arbeitsprozessen stattfinden kann, wodurch sich jedoch immer weniger Menschen an der Produktion von Gütern beteiligen können. Die gleich bleibenden oder sogar steigenden Gewinne werden auf immer weniger Beteiligte verteilt, die immer mehr verdienen. Im Gegenzug werden Produktionsprozesse immer effektiver und die Forschung entdeckt immer bessere Möglichkeiten, um die Grundversorgung aller Menschen zu sichern und so die absolute Armut zu bekämpfen.
2.2. Wie kann Globalisierung gestaltet werden?
Es ist sicherlich schwierig, diesen eigendynamisch ablaufenden Prozess zu beeinflussen, aber es ist nicht unmöglich. Die letzte UN - Gipfelkonferenz hat dies gezeigt und mit der „Agenda 21“ eine Art „globalen Gesellschaftsvertrag und ein Pflichtenheft zur Förderung nachhaltiger Entwicklung“1 verabschiedet. Schlagworte wie „soziale Gerechtigkeit„ oder ökologische Nutzung unserer Ressourcen“ müssen weltweit propagiert werden. Jeder Mensch soll die gleichen Entwicklungschancen haben. Dafür ist ein gemeinschaftliches, globales Denken nötig. Als Konsument kann man vermeiden, Waren aus Billiglohnländern zu kaufen. Unter solchem Druck stellen sogar große Handelsunternehmen ihre Konzepte um. Z.B. haben sich Karstadt, c&a oder auch ADIDAS bereits auf eine Sozialcharta verpflichtet, durch die verhindert werden soll, dass bei der Produktion bestimmte soziale Mindeststandards nicht eingehalten werden. Bis jetzt gibt es noch keine internationale Organisation, die bei Verstößen gegen soziale Arbeitsstandards Sanktionen aussprechen könnte. Solche Sozialchartas könnten hier eine Lösung sein.
Die Schulden der ärmsten Länder zu erlassen, damit sie überhaupt erst mal eine Chance bekommen am Weltmarkt teilzunehmen, wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Ziel muss es sein, dass sich so viele Menschen wie möglich unter den selben Bedingungen an der globalen Wirtschaft und dem weltweitem Austausch von Wissen und Informationen beteiligen können. Keiner darf ausgeschlossen sein von diesem Prozess. Der egoistische Gedanke muss überwunden werden und dafür ein universeller Gedanke von Gemeinsamkeit entstehen, der den Einfluss der wenigen Mächtigen schwächt und den der Gemeinschaft stärkt. Internationale, sozial gerechte, global einheitliche Handelsgesetzte müssen erdacht werden die eine weitere Forcierung der Kluft zwischen arm und reich verhindern. Wenn solche Sozialchartas durch öffentlichen, globalen Druck der breiten Bevölkerung durchgesetzt werden, wäre eine sinnvolle Gestaltung des Globalisierungsprozesses möglich.
2.3. Eine Prognose & persönliches Statement
Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre genauer betrachtet scheint unsere Zukunft sehr spannend zu werden. Es ist sehr schwer geworden realistische Prognosen zu stellen, da die Komplexität der Gesellschaften und deren Mechanismen immer größer und dadurch schwerer zu durchschauen wird. Oft schon haben sich in letzter Zeit Zukunftsprognosen als falsch erwiesen. So hat die neueste Shell-Studie gezeigt, dass die „alten Werte“ bei Jugendlichen wieder viel mehr im Trend liegen als noch vor 10 Jahren, oder dass sie die Zukunft wider Erwarten viel positiver erleben. Man kann durchaus glauben, dass es immer schwieriger wird, sich in einer Wirtschaftswelt, die global mit sehr komplexen Zusammenhängen funktioniert, zu überleben. Dass wenige Grossunternehmer gleichzeitig auch die größte Macht in Händen halten, dass dadurch politische Macht immer mehr abnimmt und somit auch die Mitsprache der breiten Massen stark beschnitten wird. Zeichen für so eine Entwicklung sind tatsächlich erkennbar. Der gesellschaftliche und psychisch-mentale Druck auf den Menschen nimmt immer mehr zu und das Prinzip „der Stärkere wird überleben“ erfährt eine Wiedergeburt in neuer Qualität. Dadurch vermehrt sich der egoistische Gedanke, Statussymbole werden wichtiger als das Wohl anderer Menschen, man ist sich selbst am liebsten der Nächste. Diese Entwicklungen passieren, aber man kann dagegen angehen, Zeichen setzten und sollte nicht Angst vor einer immer skrupelloseren Welt haben. Die Chancen, die uns durch den Prozess der Globalisierung gegeben werden, sind mindestens genauso beeindruckend und sie zu nutzen, um eine weltweit sinkende Armut zu fördern, sollte das Ziel sein. Eine reizvolle Aufgabe für eine Zukunft, die der Menschheit und nicht einigen wenigen Unternehmern gehört!
Quellenangaben
- Http://www.venro.org/global/glob_ges.html
- Http://welthaus.de/globarm.html
- Http://www.venro.org/global/wgwv.html
- Http://welthaus.de/global.html
- Http://www.venro.org/global/gwin.html
- Http://www.venro.org/global/divdw.html
- Http://www.kulturgeo.uni-freiburg.de/mitarb/dittrich/globali.html
- Http://www.venro.org/global/ueberblick.html
[...]
Häufig gestellte Fragen zu "Armut durch Globalisierung?"
Was ist Globalisierung gemäß diesem Dokument?
Globalisierung wird als die Intensivierung transnationaler Beziehungen in verschiedenen Bereichen (Ökonomie, Politik, Kultur, Kommunikation, Ökologie usw.) verstanden, mit einer bis dahin unbekannten Dynamik wirtschaftlicher Verflechtung weltweit.
Welche Ursachen werden für die "neue Globalisierung" genannt?
Die Globalisierung wurde in den achtziger und neunziger Jahren wesentlich durch weltweite Veränderungen im Verhältnis der Staaten untereinander und durch grundlegende politische Entscheidungen der Regierungen vorangetrieben. Neue Technologien, Internet, Mobiltelefone, E-Mail und Mediennetzwerke sowie die immer günstiger werdenden Transporttechnologien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wer sind die Gewinner und Verlierer der Globalisierung laut diesem Text?
Zu den Gewinnern gehören die Schwellenländer und höherqualifizierte Fachkräfte. Der größte Nutzen konzentriert sich jedoch auf die Industrieländer. Die Verlierer sind die Länder der "Dritten Welt" und auch Menschen in Industrieländern, die von Arbeitslosigkeit und dem Druck großer Konzerne betroffen sind.
Wie wird Armut in diesem Dokument definiert?
Es wird unterschieden zwischen absoluter Armut (unzureichende Mittelausstattung zur Befriedigung der lebenswichtigen Grundbedürfnisse, weniger als 1 US$ pro Tag) und relativer Armut (Unterversorgung mit Ressourcen im Verhältnis zum Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft, weniger als 50% des durchschnittlichen Einkommens).
Trägt Globalisierung zur Armut bei, und wenn ja, wie?
Das Dokument argumentiert, dass die Globalisierung zur Steigerung der relativen Armut beigetragen hat, indem sie es Unternehmen ermöglicht, sich sozialen und wirtschaftlichen Sicherungssystemen zu entziehen, und durch die Verlagerung von Produktionsstätten in Billiglohnländer. Dies führt zu Arbeitslosigkeit und beeinträchtigt die Binnenmärkte der Entwicklungsländer.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen, um die Globalisierung gerechter zu gestalten?
Vorgeschlagen werden die Förderung sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nutzung von Ressourcen, die Vermeidung von Waren aus Billiglohnländern, der Erlass der Schulden der ärmsten Länder und die Schaffung internationaler, sozial gerechter Handelsgesetze. Sozialchartas könnten helfen, soziale Mindeststandards bei der Produktion sicherzustellen.
Was ist die "Agenda 21" und welche Bedeutung hat sie im Zusammenhang mit Globalisierung?
Die "Agenda 21" ist eine Art "globaler Gesellschaftsvertrag und ein Pflichtenheft zur Förderung nachhaltiger Entwicklung", das auf einer UN-Gipfelkonferenz verabschiedet wurde und darauf abzielt, globale Herausforderungen wie Armut und Umweltzerstörung anzugehen.
- Quote paper
- Martin Kendlbacher (Author), 2001, Globalisierung und Armut, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103430