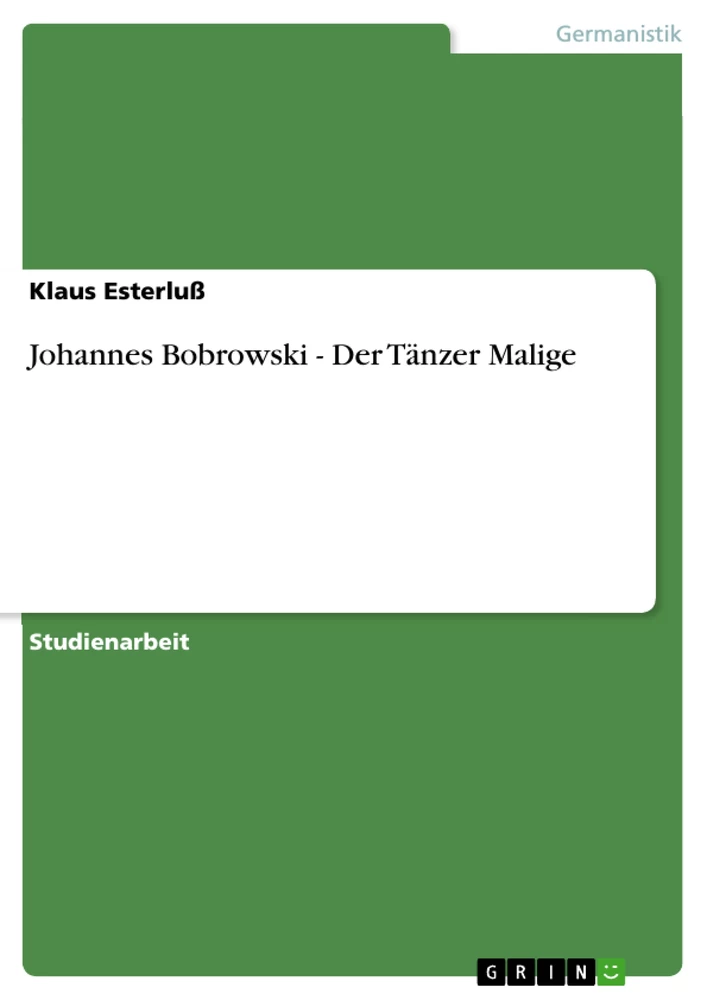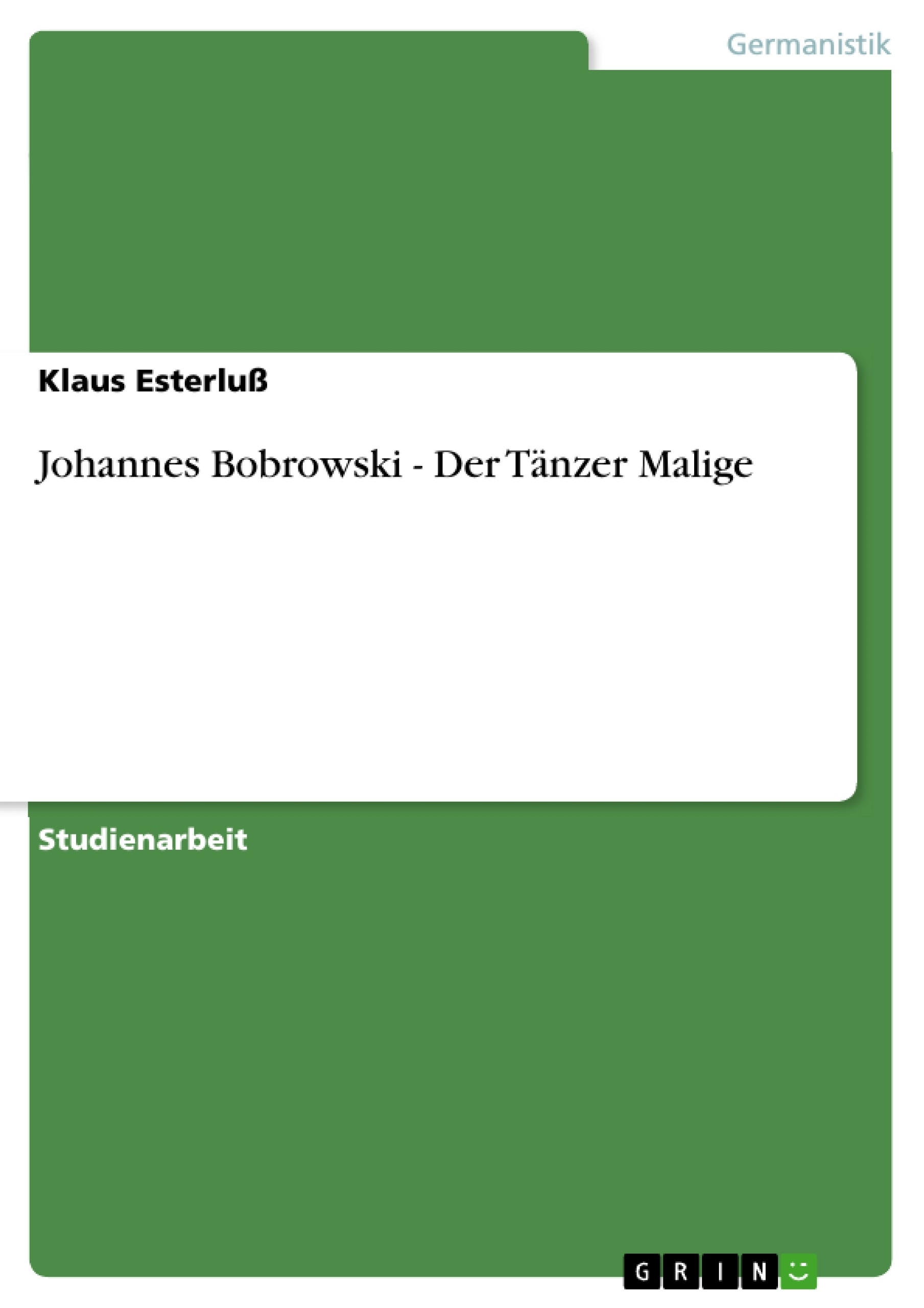Das Leben des hier zu behandelnden Künstlers, Johannes Bobrowski nämlich, beginnt im Frühjahr des Jahres 1917. Am 9. April, in Tilsit. Dies nur als Anfangsbemerkung, denn nach einigen Ortswechseln findet 1936 der erste, wenn auch erfolglose Versuch statt, Gedichte zu veröffentlichen. Dann kam das Militär. Eine Ausbildung zum Funker dort und alles in Königsberg. Am 1. September 1939 überfällt Hitlerdeutschland Polen, mit dabei Bobrowski, als Gefreiter, im Nachrichtenregiment 501, der dritten Armee. Er kommt dabei in Orte, die später (hier im Text) noch wichtig sein werden. Mlava, Rozan am Narew und andere. Der Krieg beginnt hier erst und Bobrowski ist mittendrin. Als Deutschland am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfällt, verschlägt es Johannes Bobrowski an den nordrussischen Ilmensee. Hier entstehen erste Oden auf die russische Landschaft. Im März 1944 dann erscheinen in der Münchner Zeitschrift „Das Innere Reich“ ein Vierzeiler und sieben Oden Bobrowskis. Zwischen dem Tag der Kapitulation Deutschlands und Dezember 1949 verbleibt er in Rußland und auch in russischer Gefangenschaft (unter Tage - Arbeit, später in Antifa - Zentrum in Taliza bei Gorki an der Wolga). Johannes Bobrowski kehrt nun endlich nach Friedrichshagen zu seiner Familie zurück und beginnt im Januar 1950 als Jugendreferent an der Berliner Volksbühne. Im Folgenden wird er Lektor, bald Cheflektor, im Altberliner Verlag. Seine Gedichte werden rekonstruiert (die zwischen 1945 und 1948) und Anfang 1951 erscheint die Erzählung „Im Gefangenenlager“. So und so ähnlich vergehen die folgenden Jahre, bis Bobrowski am 2. September 1965 stirbt. Der biographische Teil dieser Hausarbeit hätte umfangreicher ausfallen können, allerdings haben die Jahre nach dem Weltkrieg die Geschichte vom Tänzer Malige nicht so beeinflusst, wie es die Jahre währenddessen taten. Der Tänzer Malige ist eine Erzählung Johannes Bobrowskis aus dem Jahr 1965. Zumindest ist sie in diesem Jahr veröffentlicht worden. Nicht posthum, sondern im März des Jahres. Sie erzählt eine Begebenheit zu Beginn des zweiten Weltkrieges, bei der die Hauptfigur, Malige, eine tragende, wenn nicht die tragende Rolle einnimmt. Sie scheint auf den ersten Blick, beim ersten Lesen, nicht weltbewegend zu sein, eine Geschichte eben, die Begebenheiten erzählt, die vielleicht ungewöhnlich erscheint, aber doch glaubhaft ist. Trotzdem steckt einiges mehr dahinter.
Gliederung
1. Deckblatt
3. Einleitung
1.1. biographische Daten
1.2. Die Einleitung der eigentlichen Geschichte
2. Hauptteil
2.1. Erörterung der Geschichte im Bezug auf den Handlungsablauf
3. Fazit (mit Kommentar Bobrowskis)
4. Literaturliste
Das Leben des hier zu behandelnden Künstlers, Johannes Bobrowski nämlich, beginnt im Frühjahr des Jahres 1917. Am 9. April, in Tilsit. Dies nur als Anfangsbemerkung, denn nach einigen Ortswechseln findet 1936 der erste, wenn auch erfolglose Versuch statt, Gedichte zu veröffentlichen. Dann kam das Militär. Eine Ausbildung zum Funker dort und alles in Königsberg. Am 1. September 1939 überfällt Hitlerdeutschland Polen, mit dabei Bobrowski, als Gefreiter, im Nachrichtenregiment 501, der dritten Armee. Er kommt dabei in Orte, die später (hier im Text) noch wichtig sein werden. Mlava, Rozan am Narew und andere.
Der Krieg beginnt hier erst und Bobrowski ist mittendrin. Als Deutschland am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfällt, verschlägt es Johannes Bobrowski an den nordrussischen Ilmensee. Hier entstehen erste Oden auf die russische Landschaft. Im März 1944 dann erscheinen in der Münchner Zeitschrift „Das Innere Reich“ ein Vierzeiler und sieben Oden Bobrowskis. Zwischen dem Tag der Kapitulation Deutschlands und Dezember 1949 verbleibt er in Rußland und auch in russischer Gefangenschaft (unter Tage - Arbeit, später in Antifa - Zentrum in Taliza bei Gorki an der Wolga). Johannes Bobrowski kehrt nun endlich nach Friedrichshagen zu seiner Familie zurück und beginnt im Januar 1950 als Jugendreferent an der Berliner Volksbühne. Im Folgenden wird er Lektor, bald Cheflektor, im Altberliner Verlag. Seine Gedichte werden rekonstruiert (die zwischen 1945 und 1948) und Anfang 1951 erscheint die Erzählung „Im Gefangenenlager“. So und so ähnlich vergehen die folgenden Jahre, bis Bobrowski am 2. September 1965 stirbt. Der biographische Teil dieser Hausarbeit hätte umfangreicher ausfallen können, allerdings haben die Jahre nach dem Weltkrieg die Geschichte vom Tänzer Malige nicht so beeinflusst, wie es die Jahre währenddessen taten.
Der Tänzer Malige ist eine Erzählung Johannes Bobrowskis aus dem Jahr 1965. Zumindest ist sie in diesem Jahr veröffentlicht worden. Nicht posthum, sondern im März des Jahres. Sie erzählt eine Begebenheit zu Beginn des zweiten Weltkrieges, bei der die Hauptfigur, Malige, eine tragende, wenn nicht die tragende Rolle einnimmt.
Sie scheint auf den ersten Blick, beim ersten Lesen, nicht weltbewegend zu sein, eine Geschichte eben, die Begebenheiten erzählt, die vielleicht ungewöhnlich erscheint, aber doch glaubhaft ist. Trotzdem steckt einiges mehr dahinter.
Der Leser findet sich zunächst in einem unbenannten Ort wieder, von dem er nur erfährt, das es ein Städtchen ist, „an einem Flüßchen, das eine Ufer flach, das gegenüberliegende mit mäßigen Hängen von wechselnder Höhe, ein auseinandergestreutes Dorf, oder viele Dörfer, städtische Bauwerke einfach dazwischen, Krankenhaus, Schule, soetwas, eine katholische Kirche, eine Synagoge.“ Es ist warm, sehr warm sogar, nicht nur tagsüber und es ist der Sommer 1939. Genauer gesagt August. Ein großer Marktplatz bildet das Zentrum, er ist ganz leer, auch nachts. Man möchte dort nicht hinüber gehen, schon gar nicht allein. Lieber drückt man sich an den Hauswänden, im Schatten, entlang. Bobrowski findet eine Einleitung, die nicht viel verrät, nicht den Namen des Ortes - es scheint nur klar, daß Polen gemeint ist - die aber um so mehr versteckt hält. Den Zeitpunkt zum Beispiel, Indizien auf die Umgebung und die Namen anderer Orte: „Auch abends, wenn es ein bißchen kühl herüberkommt, von irgendwoher, vom südwestlich gelegenen See oder den feuchten Wiesen im Süden, nach dem Dorf Paradies zu und weiter nach Venedien hinunter [...]“. Es ist also möglich, mittels dieser spärlich gesäten Hinweise einen Ort auszumachen, um den es sich handeln könnte.
Laut einer Quelle ist es wohl das Städtchen Rozan (etwas andere Schreibweise wohlgemerkt) an dem Fluß Narew. Das stimmt auch mit seiner Biographie überein. Wie oben beschrieben. Man erfährt weiterhin durch Nachforschungen - und dies nur am Rande, trotzdem ist es wichtig und könnte erklären, warum Johannes Bobrowski gerade jenen Ort als Szenario für seine Erzählung gewählt hat - das die Einwohnerzahl des benannten Ortes 1945 nur noch ein Viertel derer von 1939 betrug. Ein solcher Verlust ist selbst für polnische Verhältnisse überraschend hoch und resultiert daraus, daß in dieser Gegend ein entsprechend hoher Prozentsatz Juden lebte. Bekannt ist auch, daß in der Gegend um das Flüßchen Narew heftige Kämpfe entbrannten, während der ersten Zeit des Krieges. Rozan selbst wurde am 7. September 1939 von der deutschen Wehrmacht erobert.
Zurück zur eigentlichen Geschichte:
In dieses, nun namentlich bekannte Städtchen ist eine Nachrichteneinheit eingerückt, die von einem Leutnant Anflug geführt wird. Der Name scheint fiktiv zu sein, paßt aber ausgezeichnet auf die Person, die er bekleidet.
In dieser Nachrichtenabteilung also trifft der Leser auf den Helden der Geschichte. Malige. Er erfährt, daß Malige ein Tänzer ist, ein Artist, ein Zirkus- und Varietékünstler, der immer einen guten Spruch und einige Kunststücke parat hat.
Die eigentliche Geschichte beginnt in einer Kaserne am Stadtrand. Malige sitzt angezogen als ein Soldat an einem Tisch, mit anderen - sie spielen Karten. Ein Glücksspiel, vermutlich Skat. Es geht um „Zehntelpfennige“. Weil, wie erwähnt, Malige jederzeit Kartentricks parat hat, endet es bald, schließlich handelt es sich um ein Glücksspiel, dabei geht es um Geld und in der Meinung der anderen haben Maliges Einlagen hier nichts verloren.
Im folgenden erfährt man, daß die anderen, also nicht Malige in die Kantine wechseln, um Bier zu trinken und zu reden. Fünf Tage geht das schon so. Dazu der übliche Kasernendienst: „Exerzieren, rechtsrum linksrum, Gewehrreinigen, Stiefelappell.“ Außerdem erzählt Bobrowski davon, wer die anderen sind, was für ein Naturell sie haben, welche Verhaltensweisen ihnen eigen sind, welche Berufe sie ausüben. Für die Geschichte tut das eigentlich nichts zur Sache.
Man glaubt in der Kaserne nicht so sehr an einen Krieg, schließlich gibt es einen Nichtangriffspakt und der letzte Krieg ist auch noch nicht so lange zurück, seine Spuren sind noch zu finden. Ein paar Tage später geht es los, „[...] rennen die Hauptfeldwebel und jungen Offiziere aufgescheucht herum, die neuen Einheiten, die geteilten und mit Reservisten aufgefüllten Kompanien werden verladen, auf Lastwagen, teils auf Eisenbahnzüge, es gibt noch einmal ein großes Durcheinander bei der Verteilung und Erprobung der Gasmaske 30, wie das Ding heißt.“ Die nützt sowieso nichts. Malige und all die anderen werden registriert, es scheint ernst zu werden und der Leutnant mit dem treffenden Namen Anflug spricht seine ersten Worte in dieser Geschichte. Seine „[...] Bubenstimme [...]“ ist zu hören auf den Straßen in Mlawa. Und sie sind über die polnische Grenze hinweg, angekommen in dem Ort ohne Namen, dem mit den beiden Ufern, das eine flach, das andere hoch. Leutnant Anflug residiert auf dem Hochufer. Dort sind seine Nachrichtenfahrzeuge aufgestellt, die Vermittlung und die Kabelwagen. Dorthin geht auch Malige.
Und was er dort sieht, zwingt ihn zum Einmischen. Anflug ist dort oben, er macht sich einen Spaß daraus, mit einigen alten Juden ein grausames Spiel zu spielen - sie erhalten den Befehl, eine schwere Kabeltrommel den Hang hinaufzubringen, die ihnen dann dort aus den Händen gestoßen wird. So geht das etliche Male, bis Malige das sieht.
Seine Reaktion ist unerwartet für den Leser und doch erscheint sie einem logisch, sei es auch nur aus dem persönlichen Verständnis heraus. Er hilft. Er hilft, nicht etwa seinem Vorgesetzten Anflug, nein, er hilft den alten Juden, indem er, kurz gesagt, die Kabeltrommel nach oben auf den Hügel trägt. Er tut das allein, niemand hilft ihm dabei. Niemand erwartet das wirklich und niemand kann ohne weiteres mit Maliges Tat umgehen.
Bobrowski beschreibt diese Szene äußerst interessant. Malige scheint nämlich aus seiner Tat, den Juden zu helfen, einen seiner Auftritte zu machen, die man von ihm schon kennt. „ [...] er springt ein paar Schritte vor, hat jetzt die Beine in einen Tanzschritt gebracht [...] plötzliches Stehenbleiben, vor, zwei Schritte zurück. An Anflug vorbei, der es sehen müßte, aber anderes zu tun hat, bis zur Kante des Abhangs vor.“ Und so weiter und so fort, in diesem Stil. Anflug sieht diese Akrobatik nun endlich: „Wohl verrückt geworden.“, schreit er. Malige aber, unter dessen Augen und den Augen seiner Kameraden greift die Kabeltrommel: „Und jetzt die Trommel vor sich her tragend, als müßte er sie festhalten, sie flöge ihm sonst fort, den Hang aufwärts [...]“ geht er. Anflug oben auf dem Berg schwankt. Malige tanzt auf ihn zu, in den letzten Zügen seiner Darbietung, alle sind sie gekommen, seine ganzen Kameraden, dieses Schauspiel zu sehen und Anflug ist außer sich vor Wut. Er greift seine Pistole, will nachladen, verliert das Magazin dabei.
Gewonnen, denkt man.
Nicht wirklich, weiß man, wenn man das Ende liest. Das Leben geht weiter, der Krieg auch und die Geschichte von Malige wird vergessen. Bobrowski sagt, daß er nur weiß, was er erzählt hat, nicht, was aus Malige geworden ist. Vielleicht kam er zum Frontkabarett, vielleicht auch nicht, vielleicht lebte er noch lange, wer weiß das schon.
Malige handelt als das, was er ist. Ein Künstler. Ein Artist. Nicht als der Soldat, den er augenscheinlich darstellt. Er handelt nicht wie man es vielleicht erwarten würde: „Maschke findet das komisch. [Absatz] Malige wohl auch. Denn er springt ein paar Schritte vor, hat jetzt die Beine in einen Tanzschritt gebracht [...]“. Den Rest kennen wir schon. Er fällt aus seiner Rolle, die im durch Anflug und die anderen zugedacht wurde und ihm gelingt ein Kunststück. Das Ausbrechen nämlich. Und nur, weil er sich so verhält, wie der Clown, der Künstler, der Artist, der er ist, kommt er ungeschoren davon, gelingt es ihm, Anflug zur Weißglut zu bringen, ohne, dass ihm etwas zu geschehen scheint. Zu paradox, zu unerwartet ist seine Aktion.
Malige spielt Theater. In einer Kulisse, die Bobrowski aufbaut. Der Hang ist die Bühne, Malige, Anflug, die Juden gleichen Akteuren und die Soldaten und die Menschen - da unten im Dorf - sind das, was man unweigerlich als Publikum bezeichnen will.
Nur ist es diesmal eben keine Zirkusvorstellung, keine Show, kein Varieté. Es ist ernst. Es ist das Leben und Malige stellt sich diesem Leben. Er stellt sich der Gefahr, sein Leben möglicherweise einzubüssen, weil er geholfen hat, weil er nicht wie ein Soldat dieser Zeit, sondern wie ein Mensch gehandelt hat. Es geht um die Rettung der Menschlichkeit, die Rettung der eigenen psychischen und ethischen Existenz, des Glaubens an sich selbst. Die Menschen bleiben hoffentlich Menschen, auch in Zeiten wie der beschriebenen, wie Malige ein Mensch geblieben ist. Ein Mensch, der seine Vernunft über die Befehlswelt Anflugs zu stellen bereit war.
„Nicht die Moral der Menschen interessiert, sondern hinzuweisen war auf die Immoralität der politischen Zustände, wo sich Verbrechen auf Macht und Macht schließlich auf Verbrechen stützt.“ [Johannes Bobrowski in einem Gespräch mit Eduard Zak.]
(ke)
Literaturliste
Primärliteratur
Bobrowski, J. (1987): Geschichte Band 4: Die Erzählungen, Vermischtes, Prosa und
Selbstzeugnisse. Gesammelte Werke in 6 Bänden. Union Verlag: Berlin
Sekundärliteratur
Gajek, B.; Haufe E. (1977): Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literatur- wissenschaft. Reihe B: Untersuchungen. Johannes Bobrowski, Chronik - Einführung - Bibliographie. Peter Lang: Frankfurt am Main [u.a.]
Wolf, G. (1967): Johannes Bobrowski Leben und Werk. Volk und Wissen Volkseigener Verlag: Berlin
Orlowski, H. (1975): Ein sarmantisches Triptychon. In: Johannes Bobrowski - Selbstzeugnisse und neue Beiträge. Union Verlag: Berlin
Lustner, B. (1981): Johannes Bobrowski - Studien und Interpretationen. Rütten & Loening: Berlin
Meckel, Ch. (1989): Erinnerungen an Johannes Bobrowski. Edition Akzente. Carl Hauser Verlag: München [u.a.]
Häufig gestellte Fragen zu Johannes Bobrowski's "Der Tänzer Malige"
Was ist die Hauptaussage von "Der Tänzer Malige"?
Die Erzählung handelt von dem Artisten Malige, der während des Zweiten Weltkriegs in einer polnischen Stadt stationiert ist und durch eine unerwartete, artistische Handlung die Menschlichkeit inmitten der Grausamkeiten des Krieges demonstriert. Malige hilft alten Juden, eine schwere Kabeltrommel einen Hang hinaufzutragen, um seinen Vorgesetzten, Leutnant Anflug, bloßzustellen, der sich einen Spaß daraus macht, die Juden zu quälen.
Wo und wann spielt die Geschichte?
Die Geschichte spielt im August 1939 in einer unbenannten polnischen Stadt, die wahrscheinlich Rozan am Fluss Narew ist. Die Stadt liegt an einem Flüßchen mit einem flachen und einem steilen Ufer. Es ist kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
Wer sind die wichtigsten Charaktere in "Der Tänzer Malige"?
Die wichtigsten Charaktere sind:
- Malige: Ein Tänzer und Artist, der als Soldat dient und durch seine artistische Einlage Menschlichkeit beweist.
- Leutnant Anflug: Ein sadistischer Offizier, der die Juden quält und von Malige bloßgestellt wird.
- Die alten Juden: Opfer von Anflugs Grausamkeit, die von Malige unterstützt werden.
Was ist die Bedeutung von Maliges Tanzschritt?
Maliges Tanzschritt ist ein Ausdruck seiner Persönlichkeit als Künstler. Er handelt nicht wie ein Soldat, sondern wie ein Artist, der eine Darbietung gibt. Durch diese unerwartete Handlung gelingt es ihm, Anflug zu provozieren und die Situation aufzulösen.
Was symbolisiert die Kabeltrommel?
Die Kabeltrommel symbolisiert die Last der Unterdrückung und Grausamkeit, die den Juden auferlegt wird. Maliges Hilfe beim Tragen der Trommel ist ein Akt des Widerstands und der Solidarität.
Was ist das Fazit der Geschichte?
Das Fazit ist, dass Malige als Mensch gehandelt hat, der seine Vernunft über die Befehlswelt Anflugs zu stellen bereit war. Es geht um die Rettung der Menschlichkeit, die Rettung der eigenen psychischen und ethischen Existenz, des Glaubens an sich selbst. Trotz des Krieges und der Grausamkeiten bleibt Malige ein Mensch, der sich für andere einsetzt. Das Ende der Geschichte ist offen, und es wird nicht geklärt, was mit Malige nach dem Vorfall geschieht.
Was möchte Bobrowski mit der Geschichte aussagen?
Bobrowski möchte nicht die Moral der Menschen bewerten, sondern auf die Immoralität der politischen Zustände hinweisen, in denen Verbrechen auf Macht und Macht auf Verbrechen basiert. Es geht ihm um die Kritik an der politischen Situation und die Darstellung der Auswirkungen auf das individuelle Handeln.
Welche biographischen Bezüge gibt es in der Erzählung?
Die Erzählung spielt in Rozan am Narew, einem Ort, an dem Bobrowski während des Zweiten Weltkriegs selbst stationiert war. Die Erfahrungen, die er dort gemacht hat, haben die Geschichte beeinflusst. Die Tatsache, dass die jüdische Bevölkerung in Rozan stark reduziert wurde, spiegelt die Grausamkeiten des Krieges wider und unterstreicht die Bedeutung von Maliges Handlung.
Wo wurde die Erzählung "Der Tänzer Malige" veröffentlicht?
"Der Tänzer Malige" wurde im März 1965 veröffentlicht, also zu Lebzeiten Johannes Bobrowskis.
Welche Literatur wird in der Analyse verwendet?
Die Analyse verwendet sowohl Primärliteratur (Johannes Bobrowski's "Geschichte Band 4: Die Erzählungen, Vermischtes, Prosa und Selbstzeugnisse") als auch Sekundärliteratur (Werke von Gajek/Haufe, Wolf, Orlowski, Lustner, Meckel, etc.) um die Geschichte zu interpretieren und in einen Kontext zu setzen.
- Quote paper
- Klaus Esterluß (Author), 1998, Johannes Bobrowski - Der Tänzer Malige, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103398