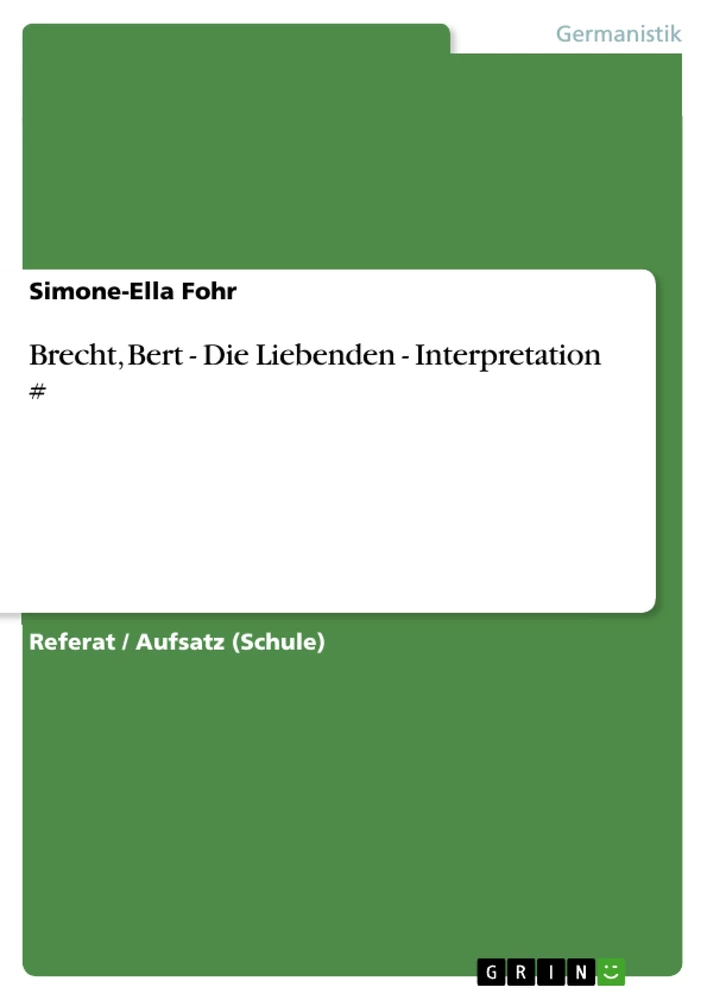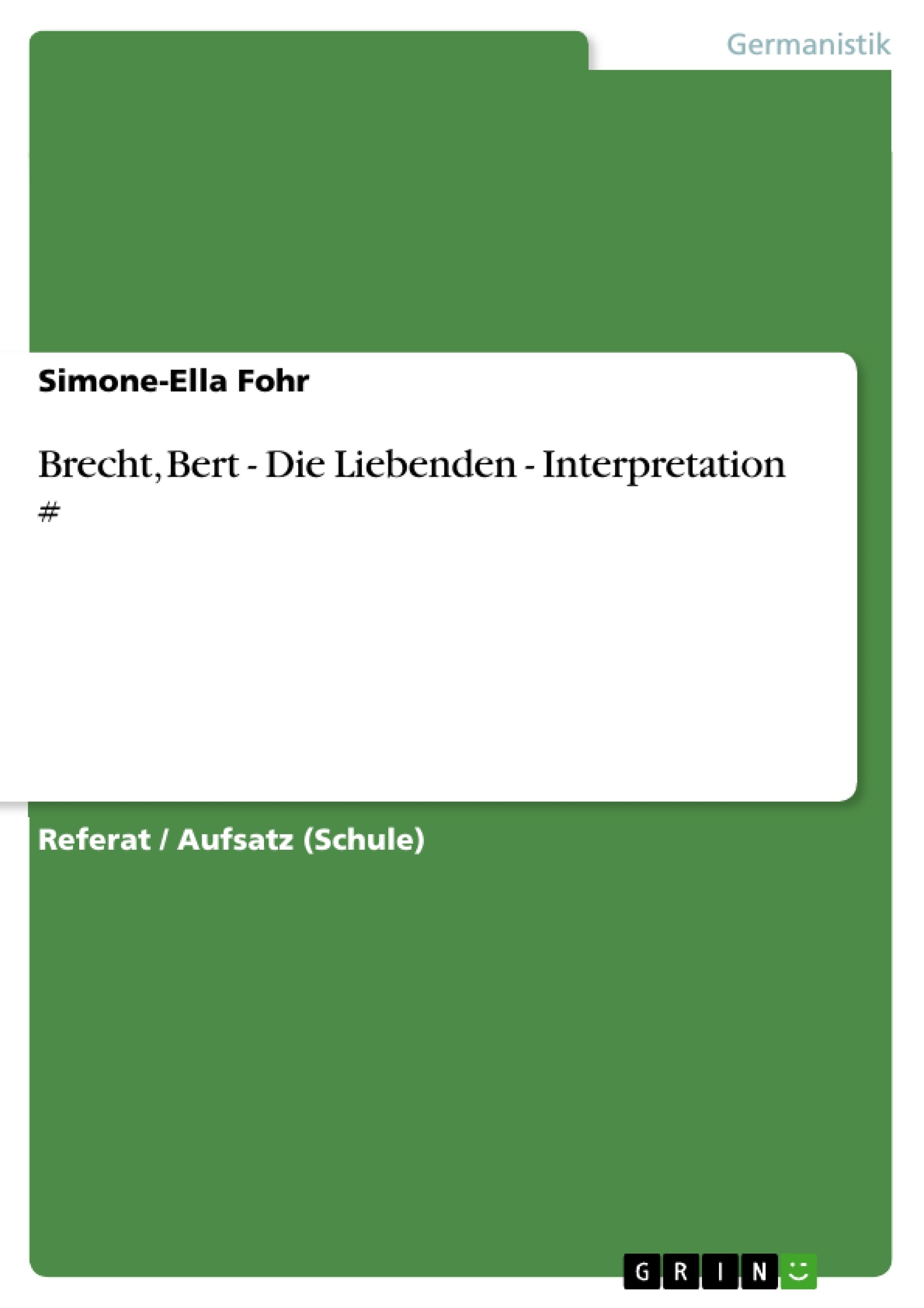Ein Hauch von Poesie, eingefangen in flüchtigen Bildern und tiefgründigen Fragen: Bertolt Brechts "Die Liebenden" ist weit mehr als nur eine Naturbeobachtung. Das Gedicht entführt uns in den Himmel, wo Kranich und Wolke scheinbar unzertrennlich ihre Kreise ziehen, ein Sinnbild vollkommener Harmonie und inniger Verbundenheit. Doch unter der Oberfläche der Idylle brodelt es. Brecht, der Meister der kritischen Reflexion, lässt uns an der Beständigkeit und den Motiven dieser ungewöhnlichen Zweisamkeit zweifeln. Woher kommen sie? Wohin fliegen sie? Und was verbirgt sich hinter der Fassade der ungetrübten Liebe? Mit jeder Zeile verdichtet sich die Ahnung, dass das Glück trügerisch, die Freiheit vergänglich und die vermeintliche Sicherheit nur eine Illusion sein könnte. Die präzise Sprache, der kunstvolle Jambus und die subtilen Reimschemata verstärken die melancholische Grundstimmung und laden den Leser ein, über die Natur der Liebe, die Flüchtigkeit des Augenblicks und die unaufhaltsame Vergänglichkeit nachzudenken. "Die Liebenden" ist ein Gedicht, das unter die Haut geht, das zum Nachdenken anregt und das uns mit einem Gefühl der bittersüßen Erkenntnis zurücklässt. Es ist eine Einladung, hinter die Fassade der scheinbaren Harmonie zu blicken und die tieferen Wahrheiten des Lebens zu erkennen. Lassen Sie sich von Brechts Worten verzaubern und begeben Sie sich auf eine poetische Reise, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Entdecken Sie die verborgenen Botschaften zwischen den Zeilen und ergründen Sie die zeitlose Relevanz dieses Meisterwerks der deutschen Literatur. Tauchen Sie ein in die Welt der Kraniche und Wolken, der Liebe und des Zweifels, und lassen Sie sich von der Kraft der Poesie berühren. Dieses Gedicht ist ein Muss für alle Liebhaber der Lyrik und für alle, die sich mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzen wollen. Ein literarisches Juwel, das in keiner Sammlung fehlen sollte.
"Die Liebenden"
von
Bertold Brecht
Das Gedicht ist eine Aufforderung, den Flug einiger Kraniche zu beobachten. Das am Anfang aufgezeigte von Harmonie geprägte Zusammensein zweier Verliebter, Symbolisiert durch Kranich und Wolke, wird vom Dichter nach und nach in Frage gestellt: Herkunft und Ziel der Liebende n liegen im Unklare n, die Best ändigkeit ihrer Liebe wird angezweifelt.
Das Gedicht besteht aus 23 Versen. Das Metrum ist ein weitgehend regelmäßiger fünfhebiger Jambus. Das Reimschema, ababcbcdc, deutet auf Terzinen hin, die jedoch durch fehlende Absätze zu einem Ganzen zusammengefügt wurden. Die Kadenzen sind alle weiblich.
In der ersten Zeile verwendet der Dichter das Wort “Sieh”. Er spricht den Leser dadurch direkt an und fordert ihn auf, seinen Ausführungen zu folgen. Außerdem gibt er dem Leser das Gefühl, die folgende Handlung ist allt äglich und ihr Gehalt nicht n ur den Gebildeten geöffnet.
In den drei Zeilen wurden viele Wörter mit “o” verwendet, dies, das Enjambement in der zweiten Zeile und die ebenfalls häufige Verwendung des Diphthongs “ei” in den Zeilen zwei bis neun schildern die fließenden Bewegungen der Kraniche.
Nach den ersten Zeilen wechselt die Beschreibung des Himmels in die Beschreibung der Herkunft der “Kraniche”, was der Dichter mit einem Wechsel vom Präsens ins Präteritum unterstreicht. Das Wort “entflogen” am Ende des vierten Verses ist gleichzusetzen mit “Entfliehen” und zeigt, dass die Herkunft sehr negativ ist.
Der Satz “aus einem Leben in ein anderes Leben” verstärkt diesen Eindruck des “Ausbrechenwollens” aus dem gewohnten, negativen Umfeld.
Die Wiederholungen der Wörter “Leben” in der vierten Zeile und “gleich” in der fünften Zeile und das Verb “teilen” in der siebten Zeile verweist auf die Gemeinsamkeit und Untrennbarkeit der beiden Liebenden.
Das in Vers acht verwendete Adverb “kurz” und die darauf folgenden Wörter “keines länger” deuten schon auf einen kommenden “Bruch” der Harmonie der vorangegangenen Verse hin. Dieser wird jedoch durch die folgenden positive n Wörter “wiege n”, “spüren ” und “beieinan der liegen” hinausgezögert.
Die Zeilen Zehn bis zwölf “und keines anders sehe als das Wiegen/Des andern in dem Wind, den beide sp üren/Die jetzt im Fluge beieinander liegen” z eigen, dass den Verliebten in dem Moment in dem sie alleine sind alles andere egal ist. Der Dichter schildert die durchaus positiven Gefühle der beiden. In Zeile dreizehn allerdings wechselt die Sichtweise des Dichters, was den endgültigen Bruch zwischen Harmonie und Negativem herbeiführt: Er äußert seine eigenen Wünsche und Zweifel durch die Wörter “mag” und “wenn nur nicht...”
Die Wörter ”Nichts”, “entführen” (Vers 13) und “vergehen” (Vers 14) verstärken den Drift ins Negative. Durch das Wort “Nichts” wird ebenso wie die Herkunft das Ziel der Liebenden verschleiert. Diese Unbestimmtheit l ässt den Leser wiederum auf ein ebenfalls negatives Umfeld schlie ßen. Das “so lange” in der fünfzehnten und sechzehnten Zeile deutet auf den baldigen Zerfall der Liebe. Der Satz “so lange kann man sie von jedem Ort vertreiben/Wo Regen drohen oder Schüsse hallen” zeigt noch einmal den harmonischen Zustand des Beisammenseins auf, der aber kurz darauf durch das Wort “verfallen” (Zeile 21) ganz zunichte gemacht wird.
In Zeile 18 wechselt der fünfhebige Jambus zu einem Sechshebigen. Der Wechsel der Stimmung des Gedichtes schlägt s ich auch in seine r äußeren Form nieder.
Das Gespräch des Dichters mit Wolke und Kranich wirkt durch die vielen Wortauslassungen abgehackt. Diese Eile verdeutlicht die zeitliche Begrenzung des Liebesgl ücks der Wolke und des Kranichs. Die direkte Ansprache in Vers einundzwanzig “ihr fragt ” bildet mit dem “sieh” der ersten Zeile einen Rahmen. Der Dichter kommt auf seine Ursprüngliche Forderung, den Kranichen zuzusehen zurück. Doch er geht noch weiter, er v erlangt vom Lese r sich mit dem Schicksal der beiden Liebenden auseinanderzusetzen und zeigt offen auf, dass das Liebesgl ück nicht ewig hält, sonder einer kurzen zeitlichen Begrenzung unterliegt: “und wann werden sie sich trennen?
- Bald.”
Der Dichter zweifelt an der Fähigkeit der Liebe ein “Halt” zu sein, in dem er in Vers dreiundzwanzig das Verb “scheinen” verwendet. Die Liebe ist ihm ke in Trost, sie ist ihm zu unsicher.
Während der Beschreibung des Zusammenseins der beiden Liebenden, gerät der Leser mit ihnen in eine Traumwelt. Zurückgeholt wird er durch den jähen Bruch von Harmonie und Bedrohung und durch den deutlichen Hinweis auf den nur kurzen Zeitraum, den Glück und Liebe währen. Die Liebenden jedoch verharren in ihrer sorglosen, vergessen lassenden Stimmung. Sie genießen den Zustand der völligen Hingabe und möchten nicht zurück in ihre Wirklichkeit. Der schäbige Zustand dieser wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, dass das Gedicht ursprünglich der Text eines Liedes der Oper “Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny” ist, dass inmitten eines Bordells gesungen wird.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Gedicht "Die Liebenden" von Bertolt Brecht?
Das Gedicht ist eine Aufforderung, den Flug einiger Kraniche zu beobachten. Es thematisiert das Zusammensein zweier Verliebter, symbolisiert durch Kranich und Wolke, wobei die Beständigkeit ihrer Liebe und ihre Herkunft in Frage gestellt werden.
Wie ist das Gedicht formal aufgebaut?
Das Gedicht besteht aus 23 Versen, überwiegend im fünfhebigen Jambus, mit dem Reimschema ababcbcdc. Die Kadenzen sind alle weiblich.
Welche sprachlichen Mittel werden im Gedicht verwendet?
Der Dichter spricht den Leser direkt an ("Sieh"). Die häufige Verwendung von "o" und des Diphthongs "ei" schildert die fließenden Bewegungen der Kraniche. Der Wechsel vom Präsens ins Präteritum unterstreicht die Beschreibung der Herkunft der Kraniche.
Welche Bedeutung hat das Wort "entflogen"?
"Entflogen" ist gleichzusetzen mit "Entfliehen" und deutet auf eine negative Herkunft hin.
Welche Rolle spielen Wiederholungen im Gedicht?
Wiederholungen der Wörter "Leben" und "gleich" sowie das Verb "teilen" verweisen auf die Gemeinsamkeit und Untrennbarkeit der Liebenden.
Was deutet auf einen Bruch der Harmonie hin?
Das Adverb "kurz" und die darauffolgenden Wörter "keines länger" deuten auf einen kommenden Bruch hin. Dieser wird jedoch durch positive Wörter wie "wiegen", "spüren" und "beieinander liegen" hinausgezögert.
Wie verändert sich die Sichtweise des Dichters im Gedicht?
Ab Zeile 13 äußert der Dichter seine eigenen Wünsche und Zweifel, was den endgültigen Bruch zwischen Harmonie und Negativem herbeiführt.
Welche Bedeutung haben die Wörter "Nichts" und "vergehen"?
Die Wörter "Nichts" und "vergehen" verstärken den Drift ins Negative und verschleiern das Ziel der Liebenden, was auf ein ebenfalls negatives Umfeld schließen lässt.
Wie äußert sich die Veränderung der Stimmung im Gedicht formal?
In Zeile 18 wechselt der fünfhebige Jambus zu einem Sechshebigen.
Welche Funktion hat das Gespräch des Dichters mit Wolke und Kranich?
Das Gespräch wirkt durch Wortauslassungen abgehackt und verdeutlicht die zeitliche Begrenzung des Liebesglücks. Die direkte Ansprache in Vers 21 bildet mit dem "sieh" der ersten Zeile einen Rahmen.
Was zweifelt der Dichter an?
Der Dichter zweifelt an der Fähigkeit der Liebe, ein "Halt" zu sein, und empfindet sie als unsicher.
Wie wird der Leser in das Gedicht einbezogen?
Der Leser wird zunächst in eine Traumwelt geführt und durch den jähen Bruch von Harmonie und Bedrohung zurückgeholt. Die Liebenden selbst verharren jedoch in ihrer sorglosen Stimmung.
Welchen Kontext hat das Gedicht?
Das Gedicht ist ursprünglich der Text eines Liedes aus der Oper "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" und wird inmitten eines Bordells gesungen.
Was ist das zentrale Thema des Gedichts?
Das Gedicht schildert den "Ausbruchsversuch" zweier Menschen aus ihrer Umgebung, die sich mangels Erfolg in der Realität ihren Phantasien hingeben.
- Quote paper
- Simone-Ella Fohr (Author), 2001, Brecht, Bert - Die Liebenden - Interpretation #, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103099