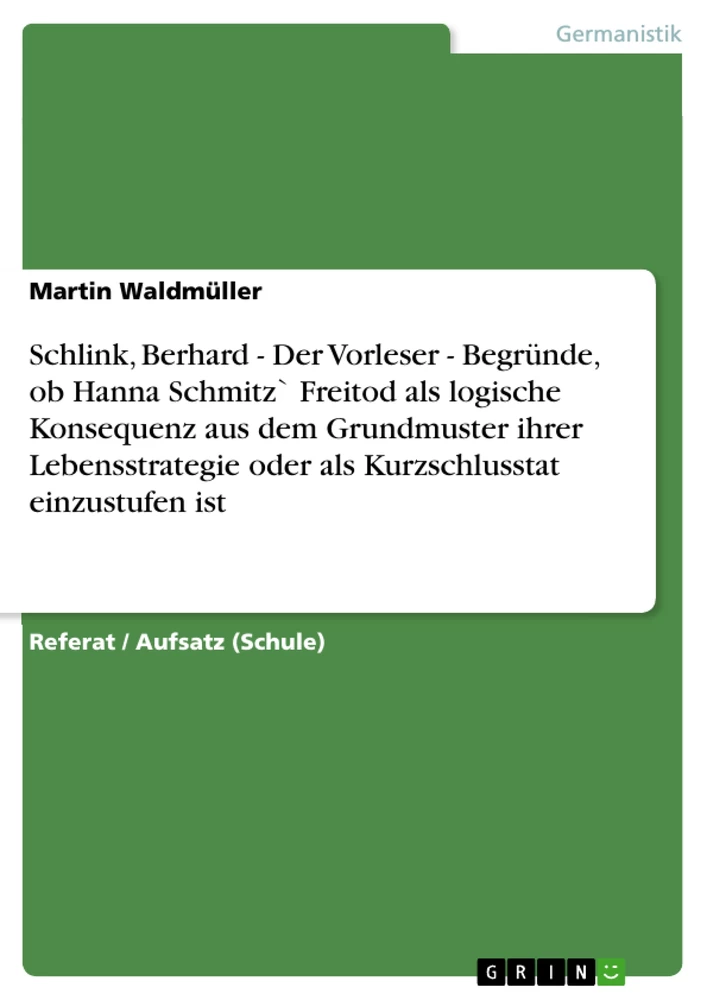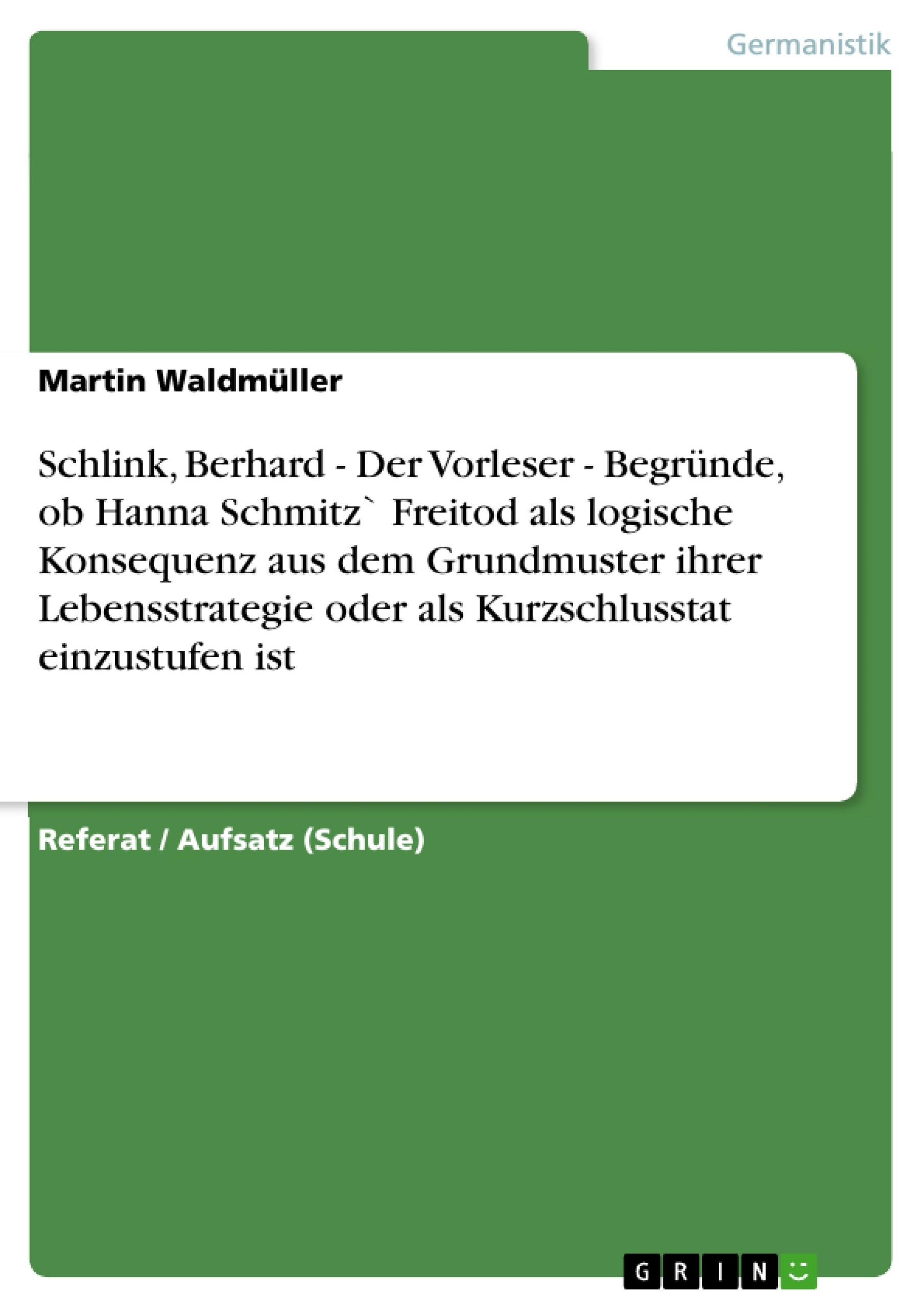Eine verhängnisvolle Begegnung, die Leben für immer verändert: Bernhard Schlinks Der Vorleser entführt in eine Welt aus Schuld, Scham und unausgesprochenen Wahrheiten. Michael Berg, ein fünfzehnjähriger Schüler, verliebt sich in die geheimnisvolle Hanna Schmitz, eine Frau von Mitte Dreißig. Ihre leidenschaftliche Affäre, geprägt von sinnlichen Ritualen und dem gemeinsamen Lesen literarischer Werke, findet ein jähes Ende, als Hanna spurlos verschwindet. Jahre später kreuzen sich ihre Wege erneut, als Michael als Jurastudent einen NS-Prozess beobachtet und Hanna auf der Anklagebank wiederfindet, beschuldigt, als KZ-Aufseherin an grausamen Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Doch hinter der Fassade der vermeintlichen Täterin verbirgt sich ein erschütterndes Geheimnis: Hanna ist Analphabetin. Um ihre Scham zu verbergen, nimmt sie eine falsche Schuld auf sich, ein stiller Pakt, der ihr Leben für immer bestimmen wird. Zerrissen zwischen Zuneigung und Entsetzen, versucht Michael, die Wahrheit ans Licht zu bringen, doch seine Bemühungen scheitern an Hannas unerbittlicher Selbstverurteilung. Der Vorleser ist ein beklemmendes Kammerspiel über die deutsche Vergangenheit, die Last der Schuld und die Schwierigkeit, mit den Untaten einer ganzen Generation umzugehen. Die Geschichte erkundet die komplexen Dynamiken von Liebe, Macht und Verantwortung, während sie die Frage nach individueller Schuld und kollektivem Versagen aufwirft. Schlink gelingt es, die moralischen Grauzonen des Holocausts auszuloten und die Leser mit unbequemen Fragen zu konfrontieren. Das Buch ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Schweigen, der Verdrängung und den lebenslangen Narben, die die Vergangenheit hinterlässt, und regt zur Reflexion über die Bedeutung von Erinnerung, Gerechtigkeit und Versöhnung an. Ein Roman, der lange nach dem Zuklappen nachhallt und dazu anregt, sich mit den dunklen Kapiteln der Geschichte auseinanderzusetzen und die Verantwortung jedes Einzelnen zu hinterfragen. Die Beziehung zwischen Michael und Hanna wird zum Spiegelbild einer ganzen Nation, die mit ihrer Vergangenheit ringt.
Schlink, Bernhard - Der Vorleser
Aufgabe: Begründe, ob Hanna Schmitz` Freitod als logische Konsequenz aus dem Grundmuster ihrer Lebensstrategie oder als Kurzschlusstat einzustufen ist
Der Roman „Der Vorleser“ von Bernhard Schlink erschien 1995 im Diogenes Verlag und beschreibt die „grausame Liebe“ (Hannes Hintermeier/Abendzeitung, München) zwischen dem fünfzehnjährigen Michael Berg und der sechsunddreißigjährigen Hanna Schmitz. Am Ende dieser Beziehung steht der Selbstmord von Hanna Schmitz, der die Frage aufwirft, ob ihr Selbstmord als logische Konsequenz aus dem Grundmuster ihrer Lebensstrategie oder als Kurzschlusstat einzustufen ist.
Im ersten Teil des Romans lernt der fünfzehn Jahre alte Mi- chael Berg zufällig die schon erwachsene Frau Hanna Schmitz kennen. Aus diesem Zusammentreffen entwickelt sich rasch eine Beziehung, die sich anfangs hauptsächlich auf sexuelle Kon- takte beschränkt, aber danach schnell zu einem Ritual wird, das nach dem Duschen und Lieben auch noch das Vorlesen von Michael beinhaltet. Im Laufe der Beziehung kommt es aber im- mer häufiger zu Streitereien zwischen den beiden, die auf ih- rer gemeinsamen Fahrradtour an Ostern den Höhepunkt finden. Die Liaison) zwischen beiden verschlechtert sich weiterhin und wird durch den unerwarteten Auszug von Hanna Schmitz ab- rupt beendet. Im zweiten Teil macht Michael Berg das Abitur und studiert anschließend Rechtswissenschaften. Aufgrund ei- nes Seminars nimmt der junge Mann an einem KZ-Prozess teil, der sich über viele Wochen hinzieht und bei dem er Hanna Schmitz nach ihrem Verschwinden das erste Mal wiedersieht. Hanna, die am Ende des zweiten Weltkrieg als KZ-Aufseherin gearbeitet hat, ist in dem Prozess eine der fünf Angeklagten, die des Todes von sechzig Frauen, die in einer Kirche verbrennen mussten, beschuldigt werden. Michael Berg erkennt während der Zeit dieser Verhandlung aufgrund des Verhaltens von Hanna, dass sie Analphabetin ist. Hanna Schmitz wird im Laufe des Prozesses immer mehr die Hauptschuld aufgedrängt. Schließlich wird sie von dem Richter zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Im dritten Teil des Buches wird Michael Berg Re- ferendar und heiratet die Juristin Gertrud, mit der er auch eine gemeinsame Tochter bekommt. Diese Beziehung scheitert aber, und Michael arbeitet wieder an Universitäten und ande- ren Forschungseinrichtungen, wo er sich mit dem Recht im dritten Reich beschäftigt. Acht Jahre nach der Verurteilung von Hanna beginnt Michael Berg, Bücher laut zu lesen und auf Kassette aufzunehmen, die er dann Hanna ins Gefängnis schickt. Er bekommt nach einigen Jahren Briefe von Hanna Schmitz, die in der Zwischenzeit lesen und schreiben gelernt hat. In ihnen antwortet sie auf Michaels Sendungen. Im fol- genden Jahr soll Hanna Schmitz entlassen werden, und Michael wird gebeten, sich um eine Wohnung und eine Arbeitsstelle für sie zu kümmern. Michael Berg besucht die Gefangene vor ihrer Entlassung und stellt an ihr Veränderungen fest. Am Tag ihrer Freilassung wird Hanna Schmitz erhängt aufgefunden. Michael erhält Geld von Hanna, das er einer Frau übergeben soll, die als Mädchen den Brand in der Kirche überlebt hat. Michael er- füllt den letzten Wunsch von Hanna und schreibt viele Jahre später diese Geschichte auf.
Um auf diese Thema näher einzugehen, sollte man sich zuerst einmal die Frage stellen, was einen Menschen dazu veranlassen kann, einen Selbstmord zu begehen. Eine Ursache für einen Su- izid wäre eine schwere bzw. tödliche Krankheit, aber auch große Probleme, wie Scheidung oder Tod eines Nahestehenden, die das Leben für den Betroffenen unzufrieden oder sogar un- erträglich machen, können einen Menschen in Verzweiflung bringen und ihm den Lebenssinn nehmen. Oft finden Menschen aus solchen Situationen keinen Ausweg mehr und leiden unter schweren Depressionen. Manchmal leidet der Betroffene auch an einer großen Schuld, wie an dem Tod eines Menschen oder an der Behinderung eines Menschen, und gibt sich dadurch kein Recht mehr auf einen Platz auf dieser Erde. Jedoch ist der Suizid eines Menschen nicht immer eine logische Konsequenz aus seinem Verhalten und Taten in seinem Leben, sondern manchmal auch eine nicht lang überdachte Kurzschlusstat, die aus einer bestimmten Situation heraus entsteht.
Auf der einen Seite gibt es einige Gründe dafür, dass der Selbstmord von Hanna Schmitz eine Kurzschlusstat ist und nicht als logische Konsequenz aus dem Grundmuster ihrer Le- bensstrategie einzustufen ist. So gibt sie ihr Leben auch nicht während ihrer langen Zeit im Gefängnis auf, denn sie versucht die „[eintönige] Arbeit“ (S. 196, Z. 15) im Gefäng- nis als „eine Art Meditation“ (S. 196, Z. 15-16) zu nutzen. Sie behält auch weiterhin ihren Lebensstil bei, denn sie ach- tet nach wie vor auf ihre Gepflegtheit und so sie ist auch während der größten Zeit, die sie im Gefängnis verbringt von „peinlicher, gepflegter Sauberkeit“ (S. 196, Z. 23) und trotz ihrer „kräftigen Gestalt“ (S. 196, Z. 22) bleibt sie während dieser Zeit schlank. Sie bringt es sogar durch ihre freundli- che Art (vgl. S. 196, Z. 16-17) zu einem „[besonderem] Anse- hen“ (S. 196, Z. 17) unter den anderen inhaftierten Frauen. Hanna gilt im Gefängnis sogar als Autoritätsperson (vgl. S. 196, Z. 18) und wird bei Probleme um Rat gefragt. Sie meis- tert die Situation im Gefängnis, was dafür spricht, dass sie keinen Grund gehabt, hat sich umzubringen. Auch der Umgang mit Problemen ändert sich während ihrer Zeit im Gefängnis, denn sie versucht nicht mehr, wie sie es früher immer getan hat, den Problemen auszuweichen und vor ihnen wegzulaufen. Ein Beispiel hierfür ist, dass Hanna Schmitz während der Zeit im Gefängnis das Lesen und Schreiben lernt. So stellt sie sich dem großen Problem ihres Lebens, dem Analphabetismus, der ihr das ganze Leben lang viele Probleme, wie das Wechseln ihrer Arbeitsplätze und vor allem das Leugnen ihres Analpha- betismus, gebracht hat. Sie versucht den Analphabetismus zu bewältigen, obwohl ihr das Schreiben viel „Kraft und Kampf“ (S. 178, Z. 20) kostet. Die Tatsache, dass sie jetzt lesen und schreiben kann, gibt ihr wieder neuen Kraft und Lebens- mut, denn sie ist „einfach stolz“ (S. 195, Z. 15) auf sich, was sie sogar dazu veranlasst, auch anderen „ihre Freude [mitzuteilen]“ (S. 195, Z. 16). Dieses neue Gefühl, des Le- sens und Schreibens mächtig zu sein, gibt ihr soviel Lebens- freude, dass sie sogar zu ihrem früheren Analphabetismus steht, und das müsste sie eigentlich von dem Gedanken sich umzubringen weit entfernen. Diese neugewonnene Lebensfreude zeigt sich auch in den kleinen Zetteln, die sie über ihrem Bett aufgehängt hat, denn die kurzen Gedichtszeilen wie „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“ (S. 194, Z. 15-16) zeugen von ihrer Freude an der Na- tur (vgl. S. 194, Z. 17-18). In den letzten Tages ihres Le- bens soll sie, nach den Worten der Leiterin des Gefängnisses, wie immer gewesen sein (vgl. S. 197, Z. 6). Ebenso redet Han- na am Tag vor ihrem Selbstmord noch über den Tag ihrer Frei- lassung mit Michael, denn sie fragt ihn, „was [sie] morgen machen [sollen]“ (S. 190, Z. 30). Sie zeigt Lust auf das Le- ben nach dem Gefängnis, indem sie „gleich“ (S. 190, Z. 30) nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis mit ihm etwas unter- nehmen will, z.B. in den Wald oder an den Fluss gehen (vgl. S. 191, Z. 1-2). Weiterhin handelt Hanna in vielen Situatio- nen unüberlegt, wie bei der Fahrradtour an Ostern, wo sie Mi- chael Berg den ledernen Gürtel durch das Gesicht zieht (vgl. S. 54, Z. 20-22). Auf diese Kurzschlusstat reagiert sie dann mit einer starken Emotionsänderung, denn sie „klammert[...] sich“ dann an Michael Berg, „seufzt [...] tief und ku- schelt[...] sich in [seine] Arme“(S. 55, Z. 12), bevor sie sich dann lieben (vgl. S. 55, Z. 17). Die wiedergewonnene Le- bensfreude und das Erlernen des Lesens und Schreibens, sowie ihre starken Emotionsschwankungen und Kurzschlusstaten, zei- gen, dass Hanna Schmitz’ Freitod möglicherweise eine Kurz- schlusstat ist.
Auf der anderen Seite gibt es viele Gründe dafür, dass Hanna Schmitz’ Freitod eine logische Konsequenz aus dem Grundmuster ihrer Lebensstrategie ist. Hanna Schmitz stellt sich im größ- ten Teil ihres Lebens nicht den Problemen, die auf sie zukom- men, sondern versucht ihnen auszuweichen oder sogar vor den Schwierigkeiten ihres Lebens davonzulaufen. Dieser Umgang mit Problemen zieht sich fast durch das ganze Leben von Hanna, und hat somit schwerwiegende Auswirkungen auf ihren Lebens- verlauf. Diese Grundeinstellung in ihrer Lebensstrategie, Problemen aus dem Weg zu gehen und sich ihnen nicht zu stel- len, bringt in ihr Leben immer wieder neue Probleme, die ei- gentlich nur aufgrund dieser Flucht vor Schwierigkeiten ent- standen sind. So ergibt sich eine Reaktionskette von Proble- men, die auf diese fatale Lebensstrategie zurückzuführen ist und an deren Ende der Freitod von Hanna Schmitz steht. Um nun verstehen zu können, warum Hanna Schmitz sich selbst umge- bracht hat, muss man nun alle Probleme der Reihe nach be- trachten, die aufgrund ihres typischen Umganges mit ihnen entstehen.
Eines der größten Probleme, das Hanna Schmitz bedrückt, ist ihr Analphabetismus. Sie schämt dafür und versucht daher, alles dagegen zu tun, dass irgendwer von ihrem Analphabetis- mus erfährt. So stellt sie sich auch hier wieder nicht diesem Problem, sondern versucht es zu umgehen. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf ihre Beziehung zu Michael Berg, denn sie kann so nie ehrlich zu ihm sein. Dies zeigt sich darin, dass Hanna Michael nie etwas von ihrem Analphabetismus er- zählt. Hanna kann also nicht einmal ihrem engsten Vertrauten von ihren Problemen und Sorgen erzählen. Sie ist eine ver- schlossene Person, wenn es um ihre Persönlichkeit geht. Dies zeigt sich auch darin, dass Hanna und Michael erst nach ein paar Tagen über ihre Vornamen reden, nachdem sie schon einige Male mit einander geschlafen haben. Als Michael Berg sie nach ihrem Namen fragt fährt sie hoch (vgl. S. 34, Z.29) und sieht ihn „misstrauisch an“ (S. 35, Z. 1-2). Da diese Beziehung nicht auf gegenseitiger Ehrlichkeit basiert, und anscheinend auch nicht dazu geeignet ist, mit dem Partner über die eige- nen Probleme zu reden, kommt der Verdacht auf, dass Hanna Schmitz sich nur auf die Beziehung eingelassen hat, um etwas über Literatur zu erfahren. Dies wird darin deutlich, dass sie schon bald das Vorlesen in den Vordergrund ihrer Bezie- hung stellt, denn als Michael Berg sie einmal besucht, und er sie küssen will, sagt sie zu ihm, dass er ihr „zuerst ... vorlesen“ (S. 43, Z. 13) muss. Dass das Vergnügen beim Vorle- sen eigentlich zum größten Teil auf der Seite Hannas liegt, ist offensichtlich, denn Michael Berg verlangt das Vorlesen einige Konzentration ab (vgl. S. 43, Z. 20) und nimmt ihm die „Lust“ (S. 43, Z. 17). So wird das Vorlesen in das Ritual „Duschen, lieben und noch ein bisschen beieinander liegen“ (S. 43, Z. 21-22) miteinbezogen und bekommt einen immer höhe- ren Stellenwert in der Beziehung. Hier zeigt sich wieder die Dominanz von Hanna, denn sie setzt fest, was in ihrer Bezie- hung wichtig ist, auch oft gegen den Willen Michaels. Viel- leicht ist diese dominante Stellung von Hanna Schmitz nur darauf zurückzuführen, dass sie dadurch, dass sie ihren Prob- lemen aus den Weg geht, mit ihrem eigenen Leben nicht zufrie- den ist. Durch diese Unzufriedenheit entwickelt sie eine Wut gegen andere Menschen, die ein besseres Leben als sie führen können. Da sie aber Analphabetin ist, ist sie den meisten Menschen unterlegen. So kann sie also ihre innere Wut nur ge- genüber schwächere Personen zeigen. Dies erklärt auch, warum sie als erwachsene Frau sich auf eine Beziehung mit einem Fünfzehnjährigen einlässt. Diese Wut drückt sich in dieser Beziehung in Hannas Dominanz aus, zum Beispiel als sie von der Arbeit nach Hause kommt und ihn nicht richtig beachtet. Und sie beleidigt ihn damit tief, dass sie zu ihm sagt, dass es seine Sache ist was er macht, und ihr das ihr das egal ist (vgl. S. 48, Z. 16-17). Sie kann diese Wut leicht an ihm aus- lassen, denn sie weiß, dass er abhängig ist von ihr, und sie mit ihm so umgehen kann, wie sie will. Allerdings hat sie große Probleme damit, Michael Berg in manchen Bereichen un- terlegen zu sein. Ein Beispiel hier für ist die gemeinsame Fahrradtour an Ostern: Als Michael in der früh aufsteht, um ihr das Frühstück zu bringen, hinterlegt er ihr einen Zettel. Als Hanna Schmitz aufwacht und den Zettel vorfindet, muss sie erkennen, dass sie hier Michael Berg unterlegen ist und sie steht so „zitternd vor Wut [und] weiß im Gesicht“ (S. 54, Z. 16) vor ihm, als er zurück kommt und zieht ihm sogar einen „ledernen Gürtel [...] durchs Gesicht“ (S. 54, Z. 20-22). Ih- re Dominanz zeigt sich ebenso in den Streitereien zwischen den beiden Hauptfiguren des Buches, da das Diskutieren über die Streitereien „nur zu weiterem Streit“ (S. 50, Z. 20) führt und sie Michael so weit bringt, dass er in Streitpunk- ten nachgibt, denn „wenn sie [ihm] droht ... [hat er] sofort bedingungslos kapituliert“ (S. 50, Z. 8-9).
Ihr Verdrängen von Problemen hat aber auch Auswirkung auf ihr öffentliches Leben. Dadurch, dass sie des Lesens und Schrei- bens nicht mächtig ist, und dieses auch nicht lernt, ist sie im Alltagsleben ziemlich hilflos. Dies kann man schon an ganz einfachen Dingen, wie das Orientieren auf einer Karte oder dem Anmelden in Hotels sehen. So muss Michael Berg diese Sa- chen für sie auf ihrer Fahrradtour übernehmen. Hanna erklärt ihr Verhalten dadurch, dass sie es einmal mag, sich „um nichts zu kümmern“ (S. 54, Z. 6-7) und sie ihm vertraut, dass er das richtig macht (vgl. S. 52, Z. 26). Ebenso kann Hanna Schmitz keine höheren Jobs annehmen, in denen man Lesen und Schreiben beherrschen muss, und so kann sie nur Arbeit von niedrigem Niveau finden. Als ihr dann angeboten wird, sie zur Fahrerin auszubilden, reagiert sie wieder mit ihrer herkömm- lichen Lebensstrategie. Anstatt ihrem Arbeitgeber mitzutei- len, dass sie Analphabetin ist, weicht sie diesem Problem wieder aus und kündigt ihre Arbeitsstelle ohne Grund, denn „sie schmeißt alles hin“ (S. 80, Z. 11). Auch gegenüber Mi- chael Berg macht sie darüber keine Andeutung, denn dieser er- kennt erst bei Hannas Prozess, dass „sie sich der Beförderung bei der Straßenbahn entzogen [hat, da sie] ihre Schwäche, die sie als Schaffnerin verbergen [konnte] ... bei der Ausbildung zu Fahrerin offenkundig geworden wäre“ (S. 127, Z. 5-8). Han- na Schmitz geht sogar so weit, um ihrem Problem aus dem Wege zugehen, dass sie von einem auf den anderen Tag auszieht, denn auf einmal „[ist] sie weg“ (S. 79, Z. 1).
Ihr Ausweichen von Problemen hat auch Auswirkungen auf Hanna, in der Zeit des dritten Reiches. Hanna Schmitz wech- selt ihren Arbeitsplatz, wie sie es auch in der Zeit macht, in der sie mit Michael Berg zusammen ist, weil ihr bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber Siemens eine höherer Job als Vorar- beiterin angeboten wird (vgl. S. 91, Z. 28-30 und S. 127, Z8- 10). Um ihren Analphabetismus nicht zugeben zu müssen, gibt sie nun ihren Job bei Siemens auf und wird Aufseherin in ei- nem Konzentrationslager. Dort nimmt sie, wie sie es später auch mit Michael Berg machen wird, junge Mädchen aus den KZs zu sich auf, damit sie ihr vorlesen (vgl. S. 112, Z. 11). Auch hier kann man wieder sehen, wie gerne sie die dominante Rolle spielen will, denn sie nimmt besonders gern die „schwa- chen und zarten“ (S. 112, Z. 2) Mädchen zu sich auf. Schließ- lich hat sie im Endeffekt auch noch einen Teil der Schuld an dem Tod der sechzig Mädchen und Frauen, die in der Kirchen umgekommen sind.
Betroffen ist die ehemalige Aufseherin durch ihr Grund- problem auch während des Prozesses, den sie kann nicht einmal die Anklageschrift lesen. So weiß sie wiederum nicht genau die Anklagepunkte und kann sich somit nicht gut auf den Pro- zess einstellen. Sie könnte jedoch den Richter auch fragen, ob ihr jemand die Anklageschrift vorliest, da sie Analphabe- tin ist, jedoch widerspricht sie dem Richter nicht, als die- ser ihr vorwirft, dass „sie die Anklage lange genug studieren [hätte] können“(S. 104, Z. 6-7). Hanna Schmitz hat also auch während der Zeit ihres Prozesses immer noch nicht den Mut ge- funden ihren Analphabetismus zuzugeben, was schließlich so- weit führt, dass sie zugibt „den Bericht geschrieben [zu ha- ben] (S. 124, Z. 17), als der Staatsanwalt vorschlägt einen Sachverständigen hinzuziehen, der die Schriften der Angeklag- ten mit der Schrift des Berichts vergleicht, um herauszufin- den welche der Angeklagten den Bericht geschrieben hat (vgl. S. 124, Z. 7-9). So lädt Hanna Schmitz den Großteil der Schuld auf sich und wird zur Hauptschuldigen. Hinzukommt, dass sie als einzige einen „[jungen] Verteidiger“ (S. 92, Z. 6) hat, und die anderen Angeklagten ihr die Hauptschuld ge- ben. So erhält Hanna bei der Urteilsverkündung auch die höchste Strafe: lebenslänglich. Dies lässt erkennen, dass Hanna Schmitz lieber eine lebenslängliche Gefängnisstrafe auf sich nimmt, anstatt ihre Angst, sich den Problemen zu stel- len, zu überwinden und ihren Analphabetismus zuzugeben.
Während der Zeit im Gefängnis ist Michael Berg nach wie vor der Mensch, der Hanna Schmitz am nähesten steht, und der Einzige, mit dem sie Kontakt außerhalb des Gefängnisses hat: Michael schickt ihr Kassetten zu, und Hanna antwortet in kleinen Briefen auf seine Sendungen, nachdem sie schreiben gelernt hat. So ist es nicht verwunderlich, dass man Michael Berg informiert, als Hanna Schmitz freigelassen werden soll. Hanna Schmitz hängt wahrscheinlich immer noch sehr an Michael Berg, denn sie hat „einigen Aufwand getrieben ... um von dem Foto [von Michael Berg, das über ihrem Bett hängt,] zu erfah- ren und es zu bekommen“ (S. 194, Z. 30 - S. 195, Z. 1). Dies zeigt sich auch daran, dass Hanna Schmitz sich freut, ihn wieder zu sehen, denn in ihrem Gesicht glänzt Freude auf, als sie Michael Berg das erste mal im Gefängnis begegnet (vgl. S. 184, Z. 21 - S. 185, Z. 1). Die männliche Hauptfigur des Bu- ches gibt ihr jedoch nicht mehr den Platz in seinem Leben, den Hanna sich erhofft, sondern er billigt ihr nur noch eine kleine Nische in seinem Leben zu (vgl. S. 187, Z. 5-6). Hanna Schmitz macht auch nur gegenüber Michael Berg eine kleine An- deutung, dass sie sich umbringen wird, denn ihre letzten Be- gegnung im Gefängnis klingt wie eine Verabschiedung für im- mer: Hanna Schmitz sagt zu Michael Berg „mach’s gut“ (S. 188, Z. 21), obwohl sie sich nach ein paar Tagen schon wieder se- hen würden. Ebenso gibt Hanna ihm zu verstehen, dass ihr nächstes Zusammentreffen nicht laut und lustig (vgl. S. 188, Z. 129)sein wird, sondern „ganz still“ (S. 188, Z. 14).
Die Gefängniszeit ist für Hanna Schmitz die Zeit, in der sie beginnt, ihre Lebensstrategie zu ändern und die dadurch ent- standenen Probleme zu verarbeiten. Ihr erster Schritt hierfür ist, dass sie lesen und schreiben lernt. Sie geht im Gefäng- nis also ihren Analphabetismus an, der sie das ganze Leben lang darin gehindert hat, an höhere Arbeitsstellen zu gelan- gen und sie immer wieder dazu gebracht hat, umzuziehen. So lernt sie lesen und schreiben, obwohl ihr das viel Kraft a- berverlangt, denn „man [sieht] den Widerstand, den Hanna ü- berwinden [muss], um die Linien zu Buchstaben und die Buch- staben zu Wörtern zu fügen“ (S. 177, Z. 15-18). Sie beginnt jetzt sogar ein großes Problem ihrer Vergangenheit aufzuar- beiten, was eigentlich ganz und gar gegen ihren ehemaligen Umgang mit Problemen spricht: Hanna Schmitz lässt sich von ihrer Gefängnisleiterin Bücher über KZs geben (vgl. S. 194, Z. 2-4). Aber da sie ihre Vergangenheit noch genauer untersu- chen will, fängt sie an vor allem Bücher über Frauen, Gefan- gene und Wärterinnen, in KZs (vgl. S. 194, Z. 5-6) zu lesen. Bei der Aufarbeitung dieses Problems erkennt sie ihre Schuld, die sie am Tod der vielen Frauen hat, die in der Kirche ver- brannt sind. Dies wird bei dem letzten Zusammentreffen von Hanna und Michael im Gefängnis deutlich, als sie mit ihm das erstemal über ihre Vergangenheit spricht, denn sie sagt zu ihm, dass nur die Toten von ihr Rechenschaft fordern können (vgl. S. 187, Z. 22-23). Sie meint damit, dass das „Gericht [...von ihr] nicht Rechenschaft [...] fordern [kann]“ (S. 187, Z. 21-22), sondern nur die Frauen, die in der Kirche ums Leben gekommen sind, berechtigt sind, bei ihr Vergeltung zu suchen. Sie gibt ihm damit auch ihre Einsamkeit zu verstehen. Die weibliche Hauptfigur gibt auch Antwort darauf, warum sie im Gefängnis angefangen hat, sich den Problemen zu stellen: Vor dem Prozess kann sie ihre Gedanken von den toten Frauen noch verdrängen, denn sie sagt zu Michael, dass sie „vor dem Prozess [die toten Frauen] ... noch verscheuchen [gekonnt hat]“ (S. 187, Z. 26-28). Im Gefängnis jedoch kann die Inhaf- tierte dann ihre Gedanken nicht mehr von den toten Frauen fern halten, denn sie sagt, dass die toten Frauen „jede Nacht [kommen], ob [sie] sie haben [will] oder nicht“ (S. 187, Z. 25-26). Diese Gedanken zwingen sie also sich mit ihrer Ver- gangenheit zu beschäftigen und so muss Hanna Schmitz ihrer alte Lebensstrategie aufgeben, sich mit diesem und den ande- ren Problemen beschäftigen, aber auch schreiben und lesen lernen, um in Büchern etwas über das 3. Reich erfahren zu können. Als Hanna Schmitz sich dann ihrer großen Schuld am Tod der vielen Frauen bewusst wird, gibt sie ihr Leben auf. Dies fällt einem zuerst äußerlich auf, denn sie wäscht sich von da an nur noch selten, isst mehr und fängt an dick zu werden und zu riechen (vgl. S. 196, Z. 24). Dadurch verliert sie auch ihre Autorität gegenüber den anderen Gefangenen, denn die Leiterin des Gefängnisses sagt zu Michael Berg, dass Hanna „die anderen Frauen nicht mehr beeindruckt hat“ (S. 3- 4). Aber Hanna verändert nicht nur Äußeres, sondern zieht sich immer mehr in ihr Inneres zurück, als ob ihr „der Rück- zug ins Kloster nicht mehr genügt, als gehe es selbst im Kloster noch zu gesellig und geschwätzig zu und als müsse sie sich daher weiter zurückziehen“ (S. 196, Z. 26-29). Hanna zieht sich in eine Welt zurück, in der sie keiner „mehr sieht und Aussehen, Kleidung und Geruch keine Bedeutung mehr haben“ (S. 196, Z. 30 - S. 197, Z. 1), so dass sie sich nur auf die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit konzentrieren und nicht von Nebensächlichkeiten abgelenkt werden kann, die sie am Nach- denken hindern können.
Dass Hanna Schmitz’ Freitod keine Kurzschlusstat ist, sondern eine logische Konsequenz aus dem Grundmuster ihrer Lebens- strategie, und ihr Wirken im KZ sowie ihr folgender Selbst- mord eine für einen Außenstehenden nicht nachvollziehbare Tat ist, erkennt man daran, dass Hanna Schmitz bei ihrer letzen Begegnung mit Michael Berg zu ihm sagt, dass sie „immer das Gefühl [gehabt habe], dass [sie] ohnehin keiner [verstehe], dass keiner weiß, wer [sie sei] und was [sie] dazu gebracht [habe]“ (S. 187, Z. 17-19). Diese Aussage lässt erkennen, dass man Hanna Schmitz so genau kennen muss wie sie sich selbst, damit man verstehen kann, was sie dazugebracht hat, sich umzubringen. Deshalb habe ich ihr Leben genau unter- sucht, ebenso wie ihre Schwierigkeiten, die aus ihrem Auswei- chen von Problemen entstanden sind, und bin schließlich zu dem Ergebnis gekommen, dass Hanna Schmitz Freitod eine logi- sche Konsequenz aus dem Grundmuster ihrer Lebensstrategie ist: Ihr Umgang mit Problemen hat Auswirkungen auf die Bezie- hung zu Michael Berg, ihr Berufsleben, ihre Zeit während des dritten Reiches, den Verlauf des Prozesses und die Zeit im Gefängnis. So ist nicht nur die Zeit im Gefängnis und die Zeit im dritten Reich ausschlaggebend für den Freitod Hanna Schmitz’, sondern wirken auch die anderen genannten Komponen- ten auf Hanna ein, beeinflussen folglich auch ihr Verhalten, und sind somit auch wichtig für die Begründung Hanna Schmitz’ Freitodes.
Nun stellt sich noch die Frage, warum Hanna Schmitz sich erst am Tag ihrer Entlassung umbringt, und nicht schon, als sie ihre Schuld am Tod der Frauen erkennt. Um das zu verstehen, muss man zwischen Ursache und Auslöser unterscheiden, denn die Ursache ihres Freitods ist die Schuld am Tod der Frauen in der Kirche und der Auslöser die Entlassung aus dem Gefäng- nis, die wieder Probleme mit sich bringen würde. Hanna Schmitz hat Angst, dass ihre alten Probleme wieder zurückkom- men, wenn sie aus dem Gefängnis heraus kommt, denn für nie- manden ist es leicht, wenn er nach einer langen Gefangen- schaft zurück in die Freiheit kommt (vgl. S. 190, Z. 24-28). Ein weiterer Grund dafür, dass der Auslöser für ihren Frei- tod die Entlassung gewesen ist, ist die Tatsache, dass Hanna „Schmitz [noch] nicht gepackt [hat] (S. 193, Z. 13). So kann man sagen, dass nur der Zeitpunkt ihres Selbstmordes eine Kurzschlusstat ist.
Erst durch die Erarbeitung des Grundes von Hanna Schmitz’ Freitod habe ich die Person Hanna Schmitz genauer verstehen können und eine Antwort auf ihr oft Fragen aufwerfendes Ver- halten bekommen. Ich glaube, um das Verhalten von Hanna Schmitz erklären zu können und so auch den Sinn dieses Buches verstehen zu können, bedarf es mehr, als das Buch einmal ge- lesen zu haben. Die Schwierigkeit bei diesem Buch liegt si- cher nicht an dem Schreibstil und an dem Verstehen des In- halts, sondern eher darin, die Zusammenhänge der einzelnen Reaktion folgern und begründen zu können. So hat mich dieses Buch nicht nur dadurch fasziniert, dass es durch eine so scheinbar einfache Sprache die Geschichte zweier Menschen so real darstellen kann, sondern auch daran, dass hinter dieser einfachen Sprache eine Geschichte zum Vorschein kommt, die politische Aktualität besitzt sowie die Vergangenheit Deutschlands beinhaltet.
Hiermit versichere ich, dass ich diese vorliegende Arbeit eigenständig erstellt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe.
Weinsfeld, Freitag, 9. März 2001 ___________________________
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse des Romans "Der Vorleser" von Bernhard Schlink?
Die Analyse beschäftigt sich mit der Frage, ob der Freitod von Hanna Schmitz als logische Konsequenz aus ihrer Lebensstrategie oder als Kurzschlusstat einzustufen ist. Der Roman handelt von der Beziehung zwischen dem 15-jährigen Michael Berg und der 36-jährigen Hanna Schmitz, und die Analyse untersucht die Gründe und Umstände ihres Selbstmordes am Ende der Geschichte.
Wie wird die Beziehung zwischen Michael Berg und Hanna Schmitz im ersten Teil des Romans beschrieben?
Im ersten Teil entwickelt sich eine Beziehung zwischen Michael und Hanna, die anfangs sexuell geprägt ist, sich aber bald zu einem Ritual entwickelt, das Vorlesen beinhaltet. Es kommt zu Streitereien, und Hanna verlässt Michael unerwartet.
Was geschieht im zweiten Teil des Romans?
Michael studiert Jura und nimmt an einem KZ-Prozess teil, bei dem er Hanna wieder begegnet. Sie ist als ehemalige KZ-Aufseherin angeklagt. Michael erkennt, dass Hanna Analphabetin ist, und sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt.
Wie gestaltet sich der dritte Teil des Romans?
Michael wird Referendar, heiratet und bekommt eine Tochter, aber die Ehe scheitert. Er beschäftigt sich mit dem Recht im Dritten Reich. Er beginnt, Hanna im Gefängnis Kassetten mit vorgelesenen Büchern zu schicken, woraufhin Hanna, die inzwischen lesen gelernt hat, ihm Briefe schreibt. Vor ihrer Entlassung kümmert sich Michael um Wohnung und Arbeit für sie. Am Tag ihrer Freilassung wird Hanna tot aufgefunden.
Welche Argumente sprechen dafür, dass Hanna Schmitz' Selbstmord eine Kurzschlusstat war?
Während ihrer Haft behält Hanna ihren Lebensstil bei, achtet auf ihre Sauberkeit, versucht, die Arbeit als Meditation zu nutzen, und genießt Ansehen unter den Mitgefangenen. Sie lernt lesen und schreiben, was ihr neuen Lebensmut gibt. Sie redet am Tag vor ihrem Selbstmord über ihre Zukunft nach dem Gefängnis.
Welche Gründe sprechen dafür, dass Hanna Schmitz' Selbstmord eine logische Konsequenz ihrer Lebensstrategie war?
Hanna weicht Problemen aus, insbesondere ihrem Analphabetismus, was zu Schwierigkeiten in Beziehungen, im Berufsleben und während des Dritten Reiches führt. Ihr Verhalten im KZ und während des Prozesses tragen zu ihrer Schuld bei. Sie ist nicht in der Lage ihren Analphabetismus zuzugeben und nimmt lieber eine lebenslange Gefängnisstrafe auf sich.
Welche Rolle spielt der Analphabetismus von Hanna Schmitz in ihrem Leben?
Ihr Analphabetismus führt zu Scham, Heimlichkeit und Problemen in Beziehungen und im Berufsleben. Sie kann keine höheren Jobs annehmen und weicht Schwierigkeiten aus, anstatt sie anzugehen. Er trägt auch zu ihrer Verurteilung im KZ-Prozess bei, da sie zugibt den Bericht geschrieben zu haben, um ihrem Analphabetismus nicht preiszugeben. Sie hat Angst sich ihren Problemen zustellen, was zu fatalen Entscheidungen und schließlich zu ihrem Tod führt.
Wie verarbeitet Hanna Schmitz ihre Vergangenheit im Gefängnis?
Sie beginnt, ihre Lebensstrategie zu ändern und ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Sie lernt lesen und schreiben und beschäftigt sich mit Büchern über KZs. Sie erkennt ihre Schuld am Tod der Frauen in der Kirche.
Warum begeht Hanna Schmitz Selbstmord am Tag ihrer Entlassung?
Die Ursache für ihren Selbstmord ist die Schuld am Tod der Frauen, der Auslöser ist die Entlassung aus dem Gefängnis, die neue Probleme mit sich bringen würde. Sie hat Angst vor dem Leben in Freiheit und den damit verbundenen Herausforderungen. Der Zeitpunkt ihres Selbstmordes kann als Kurzschlusstat angesehen werden.
Was ist die abschließende Bewertung des Autors zur Analyse von Hanna Schmitz' Freitod?
Der Freitod von Hanna Schmitz ist eine logische Konsequenz aus dem Grundmuster ihrer Lebensstrategie. Ihr Umgang mit Problemen hat Auswirkungen auf die Beziehung zu Michael Berg, ihr Berufsleben, ihre Zeit während des Dritten Reiches, den Verlauf des Prozesses und die Zeit im Gefängnis.
- Quote paper
- Martin Waldmüller (Author), 2001, Schlink, Berhard - Der Vorleser - Begründe, ob Hanna Schmitz` Freitod als logische Konsequenz aus dem Grundmuster ihrer Lebensstrategie oder als Kurzschlusstat einzustufen ist, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103022